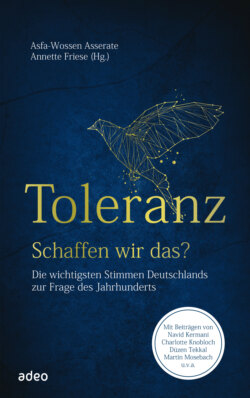Читать книгу Toleranz - schaffen wir das? - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Menschenrechte und Menschenpflichten
ОглавлениеHeute stehen wir am Ende der Entwicklung der friedlichen Erfolgsgeschichte der EU. Das europäische Wir ist gespalten; was vor Kurzem noch als Konsens gelten konnte, stößt heute an klare Grenzen der Zustimmung. Das Modell der Zivilgesellschaft sieht sich inzwischen durch das Gegenmodell einer ‚unzivilen‘ Gesellschaft infrage gestellt. Daran ist nicht zuletzt das Internet beteiligt, in dem die Meinungsfreiheit zur Meinungsenthemmung verkommen ist und das kräftig zur Entfesselung von Hass, Hetze und Gewalt beiträgt. Demagogen haben Konjunktur, Hassrhetorik mit Shitstorms und Morddrohungen breiten sich aus, und in Schockstarre erleben wir, wie sich die Gewalt in Form von politischen, rassistischen und antisemitischen Anschlägen ausbreitet.
Auf diese Entwicklung habe ich mit meinem Buch über Menschenrechte und Menschenpflichten reagiert. An die Stelle eines Plädoyers für eine deutsche Leitkultur, die die einen immer schon besitzen und die anderen jetzt schnell lernen müssen, setzte ich dabei die Suche nach einem neuen Gesellschaftsvertrag mit Regeln für ein friedliches Miteinander und dem Respekt gegenüber dem Anderen, also Formen des Umgangs und Anstands, die für alle gelten. Dabei schien es mir wichtig, nicht von dem auszugehen, was uns unterscheidet, sondern von dem, was wir gemeinsam haben und was alle brauchen. Mir ging es um gelebte Demokratie im Alltag und Verhaltensregeln in der Ehe und Familie, aber auch vor der Haustür, auf der Straße, in der Nachbarschaft, den Städten, Gemeinden und Vereinen und natürlich auch in den Schulen.
Während es ganze Bibliotheken über die Menschenrechte gibt, gibt es bisher noch gar nichts zu den Menschenpflichten. Dabei sind sie eine ganz wichtige Ergänzung zu den Menschenrechten und haben seit 2015 auf dem Höhepunkt der Migrationsbewegung nach Europa eine höchst aktuelle Bedeutung gewonnen. Die Menschenrechte enthalten ja den Paragraphen 14, das Recht auf Asyl im Fall politischer Verfolgung, als Grundlage für die massenhafte Ankunft von Geflüchteten an den europäischen Grenzen. Was sich dann aber im Einzelnen an den Grenzen und bei der Ankunft im Zielland abspielte, fand in der Willkommenskultur im Rahmen eines uralten Katalogs von Menschenpflichten statt: Bedürftige bekamen zu essen und zu trinken, sie wurden neu eingekleidet und erhielten ein Dach über dem Kopf. Diese Menschenpflichten sind uns aus den ältesten Texten der Menschheit gut bekannt und reichen in alle Kulturen und Religionen der Welt zurück.
Ein konkretes Beispiel für Menschenpflichten sind die praktischen Lebensweisheiten der alten Ägypter, die Selbstbeherrschung und Bescheidenheit zu zentralen Aspekten ihrer Selbstdarstellung gemacht haben. Man ging in dieser Kultur von einer Ungleichverteilung von Macht und klaren Hierarchien aus. Diejenigen, die in Machtpositionen gelangt waren, hatten deshalb aber auch die Verantwortung, im sozialen Raum das Prinzip Gerechtigkeit (Ma’at) umzusetzen, das zugleich das Prinzip der Weltordnung spiegelt. Diese Ordnung war fragil, denn sie wurde immer wieder durch Gier und Gewalt, Hochmut und persönliche Bereicherung gestört. Die Ungleichheit musste durch gute Taten kompensiert werden, und hier öffneten sich erhebliche Handlungsspielräume. Das folgende Beispiel stammt aus einem Beamtengrab aus der 5. Dynastie aus dem 25. Jahrhundert vor Christus:
„Ich sprach Recht zwischen zwei Wütenden,
sodass sie zufrieden auseinander gingen.
Ich habe den Elenden errettet vor dem,
der mächtiger war als er.
Ich habe dem Hungrigen Brot gegeben
und Kleider dem Nackten,
eine Überfahrt dem Schiffbrüchigen,
einen Sarg dem, der keinen Sohn hatte,
und ein Schiff dem Schifflosen.
Ich habe meinen Vater geehrt
und wurde von meiner Mutter geliebt,
ich habe ihre Kinder aufgezogen.
So spricht er, dessen schöner Name Scheschi ist.“8
Das Christentum hat das Gebot der Nächstenliebe aus der jüdischen Tradition übernommen und in einem Katalog von Tugenden festgeschrieben, der alt- und neutestamentliche Gebote umfasst. Im Matthäusevangelium werden diese Tugenden gleich viermal nacheinander wiederholt: einmal in positiver, einmal in negativer Form und zweimal im Fragemodus. Eindrücklicher kann man einen prägnanten Inhalt nicht ins Gedächtnis der Menschen schreiben. Es sind die folgenden sechs Handlungen, die die Gesegneten von den Verdammten unterscheiden. Ich erinnere Sie an die Rede von Jesus im Matthäusevangelium, Kap. 25,35:
„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben;
ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt;
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben;
ich war krank und ihr habt mich besucht;
ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“
Und der Refrain lautet jedes Mal:
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
Diese Taten sind durchs Mittelalter als die „Sieben Werke christlicher Barmherzigkeit“ überliefert und auch immer wieder bildlich dargestellt worden – eine erstaunliche Parallele zu den altägyptischen Lebensregeln:
1 die Törichten ermahnen
2 die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken
3 die Nackten kleiden
4 den Obdachlosen Quartier geben
5 die Kranken besuchen
6 die Gefangenen besuchen
7 die Toten bestatten
Die Menschenrechte und die Menschenpflichten ergänzen sich. Die Menschenrechte sind politisch und gelten vertikal zwischen einer politischen Instanz und dem Einzelnen. Sie garantieren explizit die Grundlagen friedlichen Zusammenlebens. Aus der Achtung vor dem Leben und der Würde eines jeden Menschen leiten sich Rechte ab, die für alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität oder Rasse gelten sollen: das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, das Verbot von Sklaverei und Folter, Gedanken- und Glaubensfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung, Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohlbefinden.
Die Menschenpflichten sind sozial und gelten horizontal zwischen Mensch und Mitmensch. Sie umfassen das, was Thomas Mann einmal „das Abc des Menschenanstands“ genannt hat. Auch diese Menschenpflichten sind formuliert und deklariert worden. Diese Erklärung wurde 1997 vom ‚Interaction Council‘ aufgesetzt und „den Vereinten Nationen und der Weltöffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt“. Die Erklärung verschwand aber in einer Schublade, zu der Diskussion ist es bisher nicht gekommen. Ich meine, es ist an der Zeit, auch diese Erklärung über den gegenseitigen Respekt und die Umgangsformen in der Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen und sie endlich als das, was sie sind, nämlich ein uraltes Weltkulturerbe, anzuerkennen.