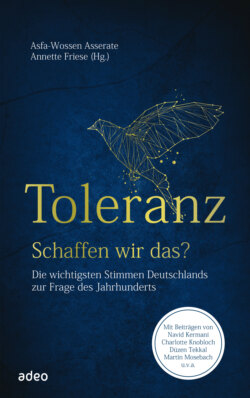Читать книгу Toleranz - schaffen wir das? - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das erste ‚Flucht-und-Migrationsdenkmal‘ in Deutschland
ОглавлениеWie aktuell diese Thematik heute ist, möchte ich am Beispiel des ersten deutschen ‚Flucht-und-Migrationsdenkmals‘ zeigen. 2017 fand in Kassel die Documenta statt. Einer der Teilnehmer war der nigerianisch-amerikanische Künstler Olu Oguibe, der einen 16 Meter hohen Obelisken aus Granitplatten auf dem belebten Königsplatz in der Mitte der Stadt aufstellte. Im unteren Viertel war eine Inschrift in goldenen Großbuchstaben eingraviert. Der Text aus dem Matthäusevangelium war auf den vier Seiten des Obelisken in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch zu lesen. Er lautete: „Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt.“ Nach dem Ende der Documenta entschieden Bürger der Stadt, dass der Obelisk an seinem Standort bleiben solle, und man sammelte Spenden, um das Kunstwerk zu kaufen. So verblieb der Obelisk in der Stadt und wurde zum ersten Migrationsdenkmal in Deutschland. Durch seine herausragende Sichtbarkeit machte er Schlagzeilen und wurde zum Anstoß für eine erhitzte Debatte.
Das Kunstwerk ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist es erstaunlich, dass in einer säkularen Gesellschaft ein Künstler heute mit seiner Arbeit einen Bibelvers in den öffentlichen Raum stellt, der ja von anderen Symbolen wie den Botschaften der Werbung und den Logos der Markt-Gesellschaft dominiert wird. Zweitens und vielleicht noch erstaunlicher ist, dass dieser Bibelvers, der ja Teil des christlichen und westlichen kulturellen Gedächtnisses ist, von einem Teil der ansässigen Bevölkerung als eine unerträgliche Provokation empfunden wird. Tatsächlich haben sich die Vertreter der AfD sehr ablehnend gegenüber dem Obelisken geäußert. „Herr Oguibe sollte sein Kunstwerk lieber einpacken, anstatt unsere schöne Stadt mit diesem unsäglichen Thema zu gängeln!“ Sie sprachen in Bezug auf diese Kunst von „Entstellung“ und prangerten den Obelisken als ein Herrschaftssymbol an.
Im Zuge der Debatte verwandelte sich der Obelisk geradezu in ein Fieberthermometer, an dem die Erhitzungsgrade der Positionen ablesbar waren. Der SPD-Bürgermeister gab schließlich dem Druck nach und ließ das anstößige Denkmal entfernen. Das geschah ausgerechnet am 3. Oktober 2018. Er wählte das symbolische Datum der Wiedervereinigung, um zu zeigen, dass ein solches Denkmal nicht ins Zentrum einer deutschen Stadt passt.
Inzwischen liegt der Obelisk abgebaut an einem sicheren Ort und erwartet geduldig sein weiteres Schicksal. Etliche Städte im Ausland haben schon Interesse an dem Kunstwerk angemeldet. Doch auch in Kassel war das Drama noch nicht zu Ende. Es wurde nämlich ein neuer Standort für den Obelisken auf der sogenannten Treppenstraße gefunden. Sie hat einen engen Bezug zur Geschichte der Kunst und zur Documenta. Im April 2019 wurde der Obelisk am neuen Ort tatsächlich wieder aufgestellt. Damit hat sich seine Bedeutung etwas verschoben: Was auf dem Königsplatz ein öffentliches Denkmal war, ist auf der Treppenstraße eine Kunstaktion.
Dieses Denkmal wurde von einem Künstler mit einer Migrationsgeschichte geschaffen. Der Satz aus dem Matthäusevangelium „Ich war ein Fremder und ihr habt mich beherbergt“ ist ja aus der Perspektive eines Migranten gesprochen. Oguibe hat seine Gedanken zu diesem Werk folgendermaßen zusammengefasst: „Der Obelisk ist eine zeitlose Form, eine Form, die aus dem Altertum stammt, ursprünglich kam sie aus Afrika. Sie reiste um die Welt. Wir nutzen sie in diesem Zusammenhang, um ein universelles, zeitloses Prinzip in die Zukunft zu projizieren: die Idee der Barmherzigkeit und Gastfreundschaft gegenüber Fremden.“
Tatsächlich ist das Besondere an diesem Denkmal, dass es ein Symbol der Sieger, der Macht und der imperialen Herrschaft radikal umwidmet und zum Träger einer ganz anderen zeitüberdauernden Botschaft macht, nämlich die der Menschenrechte und Menschenpflichten. Aus der Sicht des Künstlers transportiert der Kasseler Obelisk noch eine andere Botschaft, und das ist die Dankbarkeit gegenüber Gastgebern.
Ich zitiere eine längere Reflexion des Künstlers: „Denn ich glaube, Barmherzigkeit und Gastfreundschaft bedürfen letztendlich der Reziprozität. […] Ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass Gastgebern Kosten erwachsen. Freundlichkeit ist nicht umsonst. Ich interessiere mich mehr für die positive Geschichte der Stadt, eine Stadt, in der Fremde, Besucher, Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt eine Heimat fanden. Das wollen wir anerkennen. Seine Tür einem Fremden zu öffnen ist ein Akt des Vertrauens. All das ist verwoben in den Text, der für die Inschrift gewählt wurde. Er bekräftigt die Notwendigkeit der Gastfreundschaft, er bekräftigt die Notwendigkeit der Reziprozität, der Anerkennung, dass Nächstenliebe ein Vertrauensakt ist. Wenn solche Fremde in eine Gemeinschaft kommen, bringen sie auch etwas mit. Sie bringen Fähigkeiten, sie bringen Diversität, Kultur, sie bringen Küche. So erweitern sie die Gemeinschaft, sie bereichern die Gemeinschaft, […] sie bereichern die menschliche Erfahrung. Für mich ist das Ziel, einen Raum zu hinterlassen für Reflexion, für Einkehr, vielleicht sogar für Debatte um die Fragen der Gastfreundschaft und Dankbarkeit.“9
Wir haben es hier also nicht nur mit einem Denkmal zu tun, sondern obendrein mit einem ‚Dank-mal‘. Gleichzeitig ist der Obelisk aber auch ein Symbol für den Fremden, er ist selbst ein Fremdkörper, der die Gemüter erregt, erhitzte Debatten auslöst und aus dem öffentlichen Raum entfernt werden muss. Kunstwerke sind symbolische Objekte und Stellvertreter; sie haben die Kraft, etwas sinnlich sichtbar zu machen, was sich unsichtbar in der Gesellschaft abspielt. An Oguibes Obelisken wurde symbolisch ausagiert und vollzogen, worum es in der Debatte geht: um Integration oder Ausgrenzung, um Diversität und Teilhabe oder Abschottung in einer homogenen Gemeinschaft. Alles, was mit dem Obelisken zusammenhing, war symbolisch, einschließlich seines Abbaus. Das Loch, das im Boden zurückblieb, wurde umgehend als eine ‚Wunde‘ wahrgenommen; es lagen Blumen an dieser Stelle als Zeichen der Trauer und Empathie.
Genau dafür sind Kunstwerke da: Sie können die unterschiedlichen ausgesprochenen und unausgesprochenen Gefühle in einer Gesellschaft an die Oberfläche bringen, indem sie ihnen eine konkrete Gestalt geben und damit sichtbar und hörbar machen. Sie verhelfen ihnen obendrein zu einer Geschichte, die den Konflikt formt, indem sie Worte, Gefühle, Stellungnahmen und Handlungen provozieren. In Kassel sind manche der Meinung, dass das umstrittene ‚Flucht-und-Migrationsdenkmal‘ die lebendigste und interessanteste Debatte seit den Aktionen von Josef Beuys ausgelöst hat.