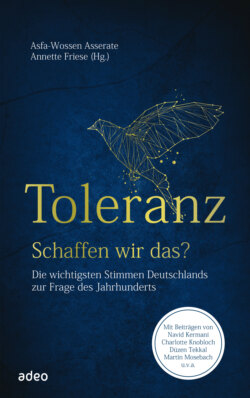Читать книгу Toleranz - schaffen wir das? - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Respekt und Gemeinsinn Erster Teil: Respekt
ОглавлениеDer Schriftsteller, Journalist und Verleger Joseph Addison, der im England des beginnenden 18. Jahrhunderts mit seinen neuen Journalen viel für die Ausbreitung des Lesens getan hat, beschrieb auch die Börse in London, das ökonomische Zentrum der damaligen Welt, als Mittelpunkt eines neuen globalen Welthandels.
„Ich empfinde ein grenzenloses Wohlbehagen, wenn ich mich unter die verschiedenen Agenten des Handels mische. […] Mal bin ich zusammengeworfen mit einer Gruppe Armenier, mal verliere ich mich in einer Menge von Juden, und mal find ich mich unter den Holländern. Ich bin abwechselnd Däne, Schwede, Franzose und komme mir vor wie jener antike Philosoph, der auf die Frage nach seiner Herkunft antwortete, er sei Weltbürger.“ 1
In der Welt, die Addison beschreibt, haben die Händler größere Bedeutung für die Gesellschaft gewonnen als ihre politischen Herrscher. Handel fördert nach Addison den sozialen Gemeinsinn (common sense), der auf ein bürgerliches ökonomisches Gemeininteresse (common interest) gegründet ist. Geld, das wird deutlich, neutralisiert Fremdheit und schafft neue Bedingungen für interkulturelle Kommunikation und Interaktion. Man kann in dem Maße höflich miteinander umgehen, ja man kann sich sogar imaginativ mit allen Fremden identifizieren, indem man sich als Teil eines neuen, übergeordneten Ordnungs- und Sozialzusammenhanges des globalisierten Welthandels erfährt.
Auch die Schriften des Philosophen Shaftesbury handeln von diesem Konzept von Sozialität, das fundamentalistische Werte ausschließt und als ein Zusammenhang von ökonomischer Selbstregulierung und individueller Selbststeuerung konzipiert ist. Er verwirft nach Whig’scher Manier jegliche Form der Außensteuerung.2 An deren Stelle tritt die Ökonomie der ‚invisible hand‘ und die Selbstkontrolle des Individuums.
Ich möchte hier Addisons Beschreibung des kosmopolitischen London mit Ulrich Becks Beschreibung der ‚Weltgesellschaft‘ fast 300 Jahre später vergleichen: „Was die Menschen scheidet – religiöse, kulturelle und politische Unterschiede –, ist an einem Ort, in einer Stadt, immer öfter sogar in einer Familie, in einer Biografie präsent.“ Beck spricht auch von einer „Multiplen Welten-Gesellschaft“, in der „Vielfalt ohne Einheit“ herrscht.3 In dieser Gesellschaft „wächst zusammen, was nicht zusammengehört“; Fremdes und Eigenes bestehen nebeneinander in widerspruchsvoller Vielfalt und Andersheit. Die multikulturelle Weltgesellschaft, so fügt er hinzu, sollte nicht mit dem Wort ‚kosmopolitisch‘ verklärt werden; „sie führt weder zu einer Vermischung der Kulturen noch automatisch zu einem höheren Niveau des Verstehens und der Toleranz, sondern oft genau im Gegenteil zu Abschottungen und Xenophobie“.4
Diese Sätze über die Dynamik der Globalisierung wurden 1998 geschrieben; nach dem 11. September 2001 war es ohnehin nicht mehr nötig, vor Verklärung und Euphorie zu warnen. Die Flugzeuge, die damals am heiteren Morgenhimmel in Manhattan einschlugen, zerstörten genau das Zentrum des Welthandels, das Addison Anfang des 18. Jahrhunderts als kosmopolitischen Ort par excellence bewundert und gepriesen hatte. Die Aktien, die dort gehandelt, und die enormen Vermögen, die in der frühkapitalistischen Ära dort gemacht wurden, beruhten weitgehend auf dem Sklavenhandel und der Ausbeutung der Kolonien.
Die Utopie vom Handel als einheitsstiftendem Rahmen und „common interest“ einer globalisierten Welt erweist sich im Nachhinein als ein halbiertes Bild von der Geschichte, das die traumatischen Erfahrungen ihrer Opfer konsequent ausblendet. Nachdem inzwischen auch die fundamentalistischen Werte zurückgekehrt sind, die Aufklärer des 18. Jahrhunderts wie Shaftesbury verbannt hatten, ist auch der Terror wieder Teil des Alltags geworden.
Angesichts der schrillen Differenz von kulturellen Lebensformen und religiösen Überzeugungen, die auf engstem Raum zusammentreffen, muss nach einem neuen gesellschaftlichen Rahmen gefragt werden, der das friedliche Koexistieren der Menschen auf dem geschrumpften Globus regeln kann. Dafür möchte ich den Begriff ‚Respekt‘ als Ergänzungsbegriff zu ‚Höflichkeit‘ einführen. ‚Respekt‘ wird gebraucht als eine neue Form interkultureller Höflichkeit. Richard Sennett hat darauf hingewiesen, dass es modernen Gesellschaften „an positiven Ausdrucksformen für Respekt und die Anerkennung von anderen über soziale Grenzen hinweg“ 5 mangelt. Bevor wir entscheiden können, ob der Begriff Respekt eine neue Rolle spielen kann, müssen wir zunächst auf seine Bedeutung und Geschichte eingehen.