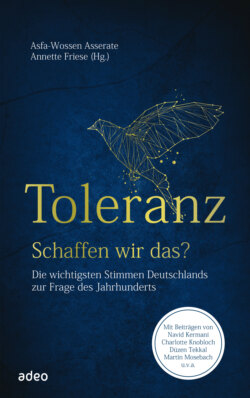Читать книгу Toleranz - schaffen wir das? - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWie kann das friedliche Zusammenleben der Religionen in Deutschland gelingen?
Anmerkungen zur Aufklärung
Die politische Linke hat sich immer eine Nähe zur Aufklärung zugutegehalten. Zur Aufklärung gehörte auch eine Privilegierung des wissenschaftlichen Denkens gegenüber Traditionen und – als Traditionsbestandteil – der Religion. Damit kann auch eine Religionsfeindlichkeit verbunden sein. Diese können wir in Teilen der französischen Aufklärung finden, wir finden sie ebenso in Teilen der Linken.
Obwohl das jetzt überraschen mag, ist dies nicht das Interessante. In der Regel finden wir im Aufklärungsdenken eher eine Ignoranz oder Geringschätzung der Religion. Das beginnt schon bei Thomas Hobbes, der die aristotelisch-scholastische Tradition und die Theologie in einem Abwasch für untauglich erklärt, eine Grundlage für ein vernünftiges Staatswesen zu bilden. Sein Argument, mit dem er der Tradition die Geschäftsgrundlage glaubt entziehen zu können, besteht darin, dass es eben nicht um das höchste Gut gehe, das im Staat zu verwirklichen sei, sondern um die Minimierung des Schlechten, das Menschen sich zufügen könnten.
Es geht der Aufklärung darum, durch eine „Wissenschaft vom Menschen“ dessen Wesen zu erkennen und dadurch Gesellschaft und Staat so einzurichten, dass die Verhältnisse diesem Wesen gerecht werden. Weil beispielsweise die Menschen gewalttätig sein können, muss es einen Gewaltmonopolisten geben, der die Rechtsordnung durch Gewaltandrohung stabilisiert und Gewaltanwendung durch andere bestraft. So würde, so Hobbes, die Gesellschaft friedlich, bürgerlicher Wohlstand, Wissenschaft und Kultur könnten blühen.
Selbstverständlich haben Hobbes und Nachfolger zugleich betont, gute Christen zu sein. Das demonstrierten sie durch Bibelzitate, allerdings nur, wo es gerade passte. Offenbar scheint es für die Aufklärung denkbar, dass ein Staat ohne Bezug auf religiöse und andere traditionale Autoritäten gegründet werden kann und Religion zugleich weiterlebt.
Hegel und Marx präzisieren diesen Umstand dahingehend, dass es gerade die Pluralität von Konfessionen sei, die es erforderlich mache, dass sich der Staat von einer religiösen Legitimationsbasis entfernen und seine Legitimation als genuin politisch suchen müsse. Aber es bleibt weiterhin unklar, auch bei Hegel und Marx, wie mit der Religion selbst zu verfahren sei. Sicher würde aus Hegel’scher Perspektive zu sagen sein, dass nicht jeder Philosoph sein müsse; und das Allgemeine, das die Philosophie auf den Begriff bringe, würde die Religion immerhin zur Vorstellung bringen. Aber ein eigenes Recht wird ihr auch nicht zugesprochen. Noch unklarer ist das bei Marx. Vermutlich dachte dieser Theoretiker, dass die Notwendigkeit religiösen Denkens in einer befreiten Welt verschwinden würde und die Religion somit auch.
Der liberale Staat und der Vernunftgehalt der Religion
Obwohl ich nicht sonderlich religiös bin, möchte ich einen Gedanken zur Diskussion stellen, der sich in den religionsphilosophischen Überlegungen von Jürgen Habermas wiederfindet. Habermas stellt einen Zusammenhang zwischen dem Vernunftgehalt der Religion, den er allerdings etwas unbestimmt lässt, und dem Toleranz- und Neutralitätsgebot des liberalen Staates her. Ich werde seinen Gedankengang hier etwas vergröbern. Der liberale Staat, darin besteht seine Neutralität, bevorzugt keine Religion bzw. Weltanschauung. Zugleich fordert er Toleranz gegenüber der Ausübung des religiösen Glaubens ein.
Beides hat zur Voraussetzung, dass zu Religions- bzw. Weltanschauungsfragen längst ein gesellschaftlicher Dissens besteht. Wir haben also hier das Lagebild, das auch das Aufklärungsdenken bestimmte. Habermas unterstellt nun, dass die Gebote der Toleranz und der Neutralität vernünftig seien. Wenn nun ein Dissens über Weltanschauungs- und Religionsfragen nur ein Dissens über irrationale Glaubenssysteme wäre, ist nicht verständlich, was an Toleranz- und Neutralitätsgeboten sinnvoll sein soll. Habermas transformiert die politische Vernunft in eine zugerechnete Vernunft des Religiösen.
Worin könnte diese aber bestehen? Überzeugt das überhaupt, wenn man, wie Habermas über sich selbst sagt, in religiösen Dingen „unmusikalisch“ wäre? Ja, das kann unter bestimmten Bedingungen überzeugen.
Erstens besteht als Bürger eines demokratischen Gemeinwesens das Zugangsrecht zur Öffentlichkeit völlig unabhängig davon, welcher Konfession man angehört. Zweitens delegitimiert sich eine Stellungnahme zu Angelegenheiten öffentlichen Interesses nicht allein schon dadurch, dass ihr Sprecher einer bestimmten Religion oder Konfession zugehörig oder konfessionslos ist. Allerdings kann niemand darauf vertrauen, dass eine Überzeugung schon deshalb für andere verständlich oder gar verbindlich sein kann, nur weil sie auf religiösen Überzeugungen aufbaut. Es besteht hier also drittens die Pflicht zur Übersetzung in eine säkulare Sprache. Das mag wie eine Zumutung wirken, aber einer solchen haben sich auch andere zu unterwerfen: nämlich genau die Anders- oder Nichtgläubigen, die – viertens – akzeptieren müssen, dass nicht nur sie selbst etwas Sinnvolles beitragen könnten.
Das sind natürlich nur formale Anforderungen an eine vernünftige Debatte zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse. Aber wenn Religionen als Speicher von Traditionen hier produktiv wirken können, warum eigentlich nicht? In diesem Sinn, und vielleicht nur in diesem, kann man der These von Habermas, dass religiöse Überzeugungen einen gewissen vernünftigen Sinn haben, die Zustimmung nicht verweigern.
Die Folgerungen daraus, auch für die politische Linke, sind wichtig. Man darf aus weltanschaulichen Differenzen nicht nur kein Drama machen, man muss, im Gegenteil, die Bereitschaft zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die eben keine Abkapselung ist, wertschätzen. Vor dem historischen Hintergrund, dass es die kommunistische Linke war, die in zuweilen auch terroristischer Härte gegen die Religion vorging, scheint mir das besonders wichtig. Und natürlich ist das überhaupt kein Aufruf, ab jetzt zu frömmeln.
Religion und Fundamentalismus
Nun könnte man denken, dass ich hier für etwas werbe, das noch in weiter Ferne liegt. Aber die Verfassungsordnung unseres Landes ist die einer liberalen Demokratie. Es gibt das Neutralitätsgebot, es gibt ein Toleranzgebot etc. Dennoch erleben wir aus unterschiedlichen Gründen ein Erstarken fundamentalistischer Tendenzen insbesondere im Islam, aber auch im Christentum.
Im Christentum zeigt sich das in Aktionen wie den Demonstrationen von sich selbst so nennenden „Lebensschützern“, wo gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau massiv Stimmung gemacht wird, und „Therapeuten“, die „Heilung“ von Homosexualität anbieten. Übrigens sind diese „Lebensschützer“ alle nicht ansprechbar, wenn es um die Bekämpfung von Kinderarmut, um die Herstellung gesellschaftlicher Verhältnisse geht, in denen die Erfüllung des Kinderwunsches kein Armutsrisiko ist. Im Islam sehen wir das am politischen Islam bzw. Islamismus.
Ein grundsätzliches Problem der Religionen besteht in ihrem Anspruch, den menschlichen Lebensvollzug als Ganzes strukturieren zu wollen. Die Gebote beginnen eben mit „Du sollst“, und ein Katalog von Todsünden macht deutlich, was passiert, wenn man sich zu sehr von der empfohlenen Lebensführung entfernt.
Wenn religiöse Menschen, aus welchen Gründen auch immer, glauben, sich dogmatisch einer vernünftigen Debatte entziehen zu können und auf einem unbedingten Wahrheitsanspruch ihres Glaubens beharren, dann verletzen sie gerade ihren eigenen Vernunftanspruch. Mindestens eine der oben benannten vier Bedingungen der Diskussion scheuen sie. Da beginnt der Übergang in den Fundamentalismus. Von Gläubigen ist zu erwarten, dass sie akzeptieren können, dass der Anspruch der Religion, den Lebensvollzug in Gänze zu strukturieren, nicht mehr in toto erfüllt werden kann. In der individuellen Lebensführung schon, als Imperativ an andere schon nicht mehr.
Es ist die Aufgabe des Staates, der Gesellschaft und noch mehr der Religionsgemeinschaften, die fragilen Grenzen zwischen individueller Lebensführung und Forderungen an andere zu stabilisieren. Und natürlich kann das schiefgehen.
Schlussbemerkung
Die Frage nach einer „friedlichen Koexistenz“ unterschiedlicher Religionen und Konfessionen und konfessionsloser Menschen scheint angesichts des Aufstiegs fundamentalistischer Ideologien innerhalb des Christentums und des Islams ihren realen Grund zu haben. Zugleich ist vor einer Interpretation zu warnen, die Konflikte vor einem ausschließlich religiösen Hintergrund ausdeutet.
Wir würden uns doch sehr wundern, wenn die Konflikte innerhalb der Eurozone als Konflikte zwischen dem weitgehend protestantischen Norden und dem katholischen und orthodoxen Christentum des Südens Europas interpretiert würden. Jeder weiß doch, dass diese Konflikte nicht ohne ein ökonomisches Grundverständnis der Probleme, die eine Gemeinschaftswährung machen kann, auch nur angemessen begriffen werden können. Dennoch, obwohl wir das in diesem Fall wissen, tun wir manchmal so, als ließen sich alle Konflikte im Mittleren und Nahen Osten wie auch im nördlichen Afrika fast ausschließlich als religiöse Konflikte begreifen, so als gäbe es keine Staaten dort, die um Dominanz in der Region kämpften. Nein, das wäre zu oberflächlich.
Ähnlich oberflächlich, hier nun auch bösartig, ist Thilo Sarrazins Verächtlichmachung der Migrantinnen und Migranten muslimischer Herkunft. Irgendwie konstruierte er einen biologistischen Zusammenhang zwischen Religionszugehörigkeit und Intelligenz. Die Ideologiefunktion ist hier klar zu erkennen. Der deutsche Staat, über Jahrzehnte ein Integrationsverweigerer, hat vielen Menschen migrantischer Herkunft den sozialen Aufstieg verweigert, zumindest enorm erschwert. Mit einer letztendlich rassistischen Ideologie kann man diese sozialen Widersprüche zukleistern, denn der Kampf gegen soziale Ausgrenzung ist schwierig, Hetze gegen Arme und Migranten dagegen bequem. Hinzu kommt ein, auch durch Medien verbreitetes, Bild vom Islam, das eher ein Zerrbild ist. Das bevölkerungsreichste islamische Land – Indonesien – ist zum Beispiel eine Demokratie. Aber Demokratie ist nicht unbedingt das Erste, was einem einfällt, wenn man „Islam“ hört. Da denken viele eher an den Terror der Hamas oder des IS. An dieser Stelle ist Aufklärungsarbeit zu leisten und auch Medien sollten sich da von Klischees lösen.
Ausgrenzung führt auch zu Abgrenzung. Letztere kann Selbstbewusstsein und Durchsetzungswillen fördern, sie kann aber auch zur Realisierung jenes Klischees von den Parallelgesellschaften führen, vor denen Konservative Angst haben. Schließlich kann so auch ein Nährboden für Radikalisierungen entstehen. Wir haben das doch alles schon erlebt. Bei den Riots in den englischen Großstädten, bei Terroranschlägen in Paris auf das „Petit Cambodge“ und das „Bataclan“, wo es junge Franzosen waren, die auf junge Franzosen schossen. Aber fühlten sich die Täter so, als Franzosen? Als gleichgestellte Mitglieder in jener französischen Gesellschaft, aus der sie ihre Opfer ins Visier nahmen? Wir sind vielleicht noch nicht an jenem Punkt. Die Sarrazin-Debatte kam bei uns spät, in Frankreich ist die Rechte ganz anders drauf.
Ich will hier keine Predigt halten. Aber es ist aus meiner Sicht dringend erforderlich, sich nicht auf Konfessionen zu fixieren. Es kommt auch darauf an, das unter dem religiösen Bewusstsein liegende materielle Geschehen mit in den Blick zu nehmen. Denn so falsch ist das Marx’sche Diktum, wonach das Sein das Bewusstsein bestimme, nicht.
Wir haben Armut in unserem Land. Viele der Armen sind migrantischer Herkunft. Kindern aus Arbeiterfamilien und migrantischen Familien ist der soziale Aufstieg, der heute fast nur noch als Bildungsaufstieg organisierbar ist, vielfach versagt. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass Kinder unterschiedlicher Herkunft miteinander dieselbe Schule besuchen, mit- und voneinander lernen. Die Tendenz zur sozialen Trennung ist da.
Die Idee einer emanzipierten Gesellschaft ist noch nicht abgegolten. Dabei geht es nicht darum, Unterschiede einzuebnen. Es geht darum, dass entlang von Unterschieden – sei es Klasse, sei es Geschlecht, seien es Herkunftsmerkmale, seien es religiöse Unterschiede – keine Unterdrückung und Diskriminierung mehr stattfindet. An dieser Gesellschaft ist zu arbeiten, um zu verhindern, dass aus Unterschieden Hass wird.