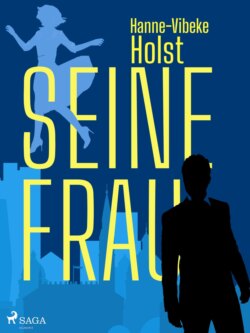Читать книгу Seine Frau - Hanne-Vibeke Holst - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinen wunderschönen!«, lächelt der Fahrradhändler, als ich eintrete. »Sie haben sich entschieden?«
Ich nicke zustimmend, ja, ich habe mich entschieden. Oder ich entscheide mich zumindest in diesem Augenblick, in dem es mir absolut einleuchtend erscheint, dass genau das das Richtige ist. Ein Fahrrad für meinen Mann zu kaufen. Als Weihnachtsgeschenk. Von meinem Ersparten. Wenn es eine Überraschung sein soll, kann ich nicht mit der Kreditkarte bezahlen, da er meine Kontoauszüge penibel durchgeht. Es ist schließlich sein Geld, wie er so gern betont. Und jetzt, wo er mehr Zeit hat, die täglichen Transaktionen mithilfe des Online-Bankings zu verfolgen, muss ich buchstäblich für jeden einzelnen Posten Rechenschaft ablegen. Spar, Rewe, Netto, Aldi – was mache ich mit dem ganzen Haushaltsgeld? Er ist schließlich selten zum Abendessen zu Hause und hat auch nicht den Eindruck, dass ich selbst viel feste Nahrung zu mir nehme. Was unausgesprochen heißt, dass ich mehr auf flüssige Sachen stehe und dass der Alkohol so viel kostet. Bald lässt er sich bestimmt die Kassenzettel vorlegen, was seinen Verdacht natürlich bestätigen und gleichzeitig meine Strategie zunichtemachen wird, die Beträge etwas nach oben abzurunden, sodass ich immer ein wenig Bargeld zur Seite legen kann. Inzwischen habe ich ein heimliches Guthaben von einigen Tausend, eine Reserve, um, ja, um was? Sehen wir der Wahrheit ins Gesicht, ich werde nie abhauen, also kann ich ruhig ein wenig davon für ein Fahrrad ausgeben, das ich ihm gern zu Weihnachten schenken möchte.
Ich habe es immer geliebt, Dinge für ihn zu kaufen – einen Schlips, ein Buch, einen Füller. Als würde er in dem Augenblick, in dem ich das Geschenk auswähle und in schönes Papier einpacken lasse, zu dem Mann, den ich in meinen Träumen in ihm sehe, dem Mann, der er in Wirklichkeit ist. Fein und einfühlsam, klug und musisch. Ich möchte ihm gern zeigen, dass ich weiß, dass er nicht so ist, wie er zusammen mit mir geworden ist. Vielleicht sind das eine Art Opfergaben, die ich ihm bringe. In den ersten Jahren war er überrascht und hat sich gefreut wie ein Kind, das es nicht gewohnt ist, solche Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war er schließlich auch nicht; er hat selbst erzählt, dass er in seiner Kindheit in dem afrikanischen Dorf fast keine Spielsachen hatte; hat erzählt, wie sie Spielzeugautos aus Stahldraht und Metallband gebastelt und Fußbälle aus mit Klebeband umwickelten Lappen hergestellt haben. Mit der Zeit begannen ihn meine kleinen Liebesbezeugungen, die er fortwarf oder nicht einmal auspackte, zu ärgern. »Was willst du dafür haben?«, fragte er, als gäbe es eine unausgesprochene Rückzahlungsforderung. Als drehe sich alles im Leben um Soll und Haben, Profit und Verlust. »Nichts, Schatz. Nur dich«, habe ich geantwortet. Wie dumm kann man eigentlich sein? Auf Dauer?
Inzwischen mache ich ihm nur noch selten Geschenke. Nur die rituellen zum Geburtstag und zu Weihnachten. Selbst da versuche ich, mich zu beherrschen und die Geschenkhysterie auf einem vernünftigen Niveau zu halten, wie er es auszudrücken beliebt. Somit ist das Fahrrad fast schon nicht mehr zu vertreten, aber ich kann der Versuchung nicht widerstehen, es ihm zu schenken. Ich glaube, es wird ihn freuen. Das jungenhafte Lächeln hervorzaubern, für das ich alles tun würde. Es ist ein klassisches schwarzes Raleighrad mit Trommelbremsen, gebraucht, aber gut instand gesetzt. Ich habe es im Fenster gesehen, und gestern bin ich hineingegangen und habe es reserviert. Der Fahrradhändler ist ein Einwanderer, sein Dänisch ist fehlerhaft, wenn auch erheblich besser als das seines Kompagnons. Ich bin mir nicht sicher, dass die beiden Vettern alles verstehen, was ich sage, aber sie teilen die Freude an meiner Idee.
»Sehr schönes Fahrrad«, betont der Fahrradhändler und holt es für mich herunter. Ich lege die Hand auf den Sattel, betätige die Klingel und rede zu viel, wie üblich, wenn ich endlich den Mund aufbekomme. Kann mich jedoch gerade noch bremsen, als ich ausplappern will, dass mein Mann das Fahrrad gut gebrauchen kann, weil ihm nicht länger ein Auto mit Fahrer zur Verfügung steht. Doch als der Fahrradhändler fragt, ob ich nicht auch einen Fahrradhelm für ihn haben will, kann ich mich nicht beherrschen, breche in Gelächter aus und sage, dass ich das bestimmt nicht will, weil er Politiker ist und sich ein Politiker mit Helm mit Sicherheit zur Witzfigur macht. Und der Fahrradhändler lacht hinter seinem Schnäuzer und fragt, ob ich vielleicht mit Per Vittrup verheiratet bin?
»Nein, nein!«, lache ich noch lauter. »Ich bin mit Gert Jacobsen verheiratet!«, sage ich, und der Fahrradhändler zeigt sich sofort äußerst imponiert und übersetzt alles seinem Kumpel, der anerkennend nickt. »Minister? Ja?« – und plötzlich geht es nicht mehr allein darum, einer etwas zu hektischen, nach Alkohol riechenden dänischen Frau ein gebrauchtes Fahrrad zu verkaufen, sondern einem berühmten Mann ein zukünftiges Kleinod zu liefern. Einem aus dem Fernsehen!
»Schloss Sie bekommen gratis«, beschließt der Fahrradhändler, als hätte er damit teil an der Berühmtheit, und obwohl ich protestiere, bleibt es dabei. Wir einigen uns, dass sie das Fahrrad am 23. Dezember liefern. Ich biete an, die Adresse selbst aufzuschreiben, womit ich erneut meine Voreingenommenheit demonstriere, denn der Fahrradhändler hat bereits C. F. Richsvej, Gert Jacobsen, korrekt und ohne Rechtschreibfehler notiert.
»Grüßen Sie Ihren Mann«, ruft mir der Fahrradhändler hinterher, als ich wieder auf dem Weg nach draußen bin, und ich senke das Kinn und lege mir verschwörerisch einen Finger auf die Lippen und sage »Sssst, das ist ein Geheimnis!« und trete lächelnd auf die Straße hinaus, stolz, die Frau eines berühmten Mannes zu sein. Und während ich mich unter den über der Straße schaukelnden Tannengirlanden mit den strahlenden elektrischen Lämpchen in Sternenform nach Hause kämpfe, wächst dieser Stolz, und ich erinnere mich, wie ich in der allerersten Zeit vor Stolz angeschwollen bin, wenn ich auf seinem Schoß saß, während er mit irgendeinem Typen aus dem Kollektiv diskutierte und ohne jede Anstrengung die meisten mundtot machte, wenn sie der Sozialdemokratie vorwarfen, revisionistisch zu sein, und das Folketing zum verlängerten Arm des Kapitals erklärten. Ich nahm nie an den Diskussionen teil, ich war schließlich nur die Liebste des Häuptlings, seine Squaw, und das habe ich geliebt. Mehr als alles andere habe ich genossen, dass die anderen Mädchen mich hassten, weil ich ihn erobert hatte, was jede von ihnen auch versucht hatte. Und wer hat ihn bekommen? Miss Danmark 1970! Das dumme Flittchen aus dem Südhafen, das hübsche Brüste, aber nie die Logik des Kapitals zu definieren gelernt hatte. Wie hielt es so ein begabter Typ überhaupt mit einer Blondine aus, die Sitation statt Situation sagte und ihm in keiner Weise ein intellektueller, feministischer Gegenpart sein konnte?
»Ha!«, rufe ich laut triumphierend bei der Erinnerung an die Pfeife rauchenden Frauenspersonen, schlage den Pelzkragen meines Mantels hoch und weiche einem von einer selbstbewussten Mutter energisch geschobenen Kinderwagen aus. Der Gedanke an das Fahrrad macht mich froh und gut gelaunt, als wäre es möglich, in die Zeit zurückzukehren, in der wir zusammen durch die Stadt geradelt sind und unsere Fahrräder mit ineinander verhakten Lenkern vor dem Haus des Volkes oder dem Montmartre gestanden haben, als wären sie zwei Liebende wie wir. Meins war lila, seins ein schwarzes Raleighrad wie das, das ich gekauft habe, denn als frisch gebackener cand.pol. und sozialdemokratischer Folketingkandidat konnte er schlecht wie ein Hippie aussehen. Das konnte ich auf Dauer natürlich auch nicht, nicht nachdem er gewählt worden war, wir geheiratet hatten und aus dem Kollektiv ausgezogen waren, doch unser erster Sommer hatte etwas Flowerpowerartiges, und wir auch. Es war der Sommer 1971, und ich hatte nicht gewusst, dass man so glücklich sein konnte.
Nun bin ich nicht mehr ganz nüchtern und trinke auch noch einen kleinen Tropfen aus der Mineralwasserflasche in der Tasche, sodass ich auf einer Wolke dieses entschwundenen Glücks nach Hause schwebe und mir noch immer verschworen zulächle, als ich aus alter Gewohnheit mein Spiegelbild in einem Schaufenster betrachte, während ich daran vorbeigehe. Ich sehe noch immer okay aus, jedenfalls angezogen, und völlig aufgehört, mir hinterherzupfeifen, haben sie noch immer nicht, die Handwerker. Auf die Entfernung gehe ich für zehn Jahre jünger durch, an einem guten Tag vielleicht sogar für zwanzig; dann kann es passieren, dass sie mir »Hey, Schöne!« hinterherrufen, auch die jungen. Vor allem, wenn ich die Haare offen trage und sie mich nur von hinten sehen. Von vorn, aus der Nähe, hapert es. Dann werden sie sauer, besonders wenn sie mich für ein junges Mädchen gehalten haben, das sich nun aus der Nähe als alte Schachtel erweist. Ich versuche, darüber zu lachen, aber natürlich tut es weh. Vor allem, wenn sie mir in einem gekränkten, aggressiven Tonfall »Weibsbild!« hinterherrufen, als hätte ich sie willentlich beleidigt und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Begierde geweckt.
Wie dem auch sei, heute bin ich gut gelaunt, und niemand soll meine Freude kaputt machen, ganz im Gegenteil, es gilt, dieses prickelnde Gefühl so lange wie möglich festzuhalten. Warum also nicht den Tag feiern und ein paar Blumen bei der netten Blumenhändlerin kaufen, die einen Strauß mit flammroten Amaryllis und Grün bindet und ihn mir zur Begutachtung hinhält und mir mit dem gleichen entgegenkommenden Respekt vier lackierte Kerzen für einen Adventskranz verkauft, den ich plötzlich Lust habe zu kreieren. Ein bisschen spät, da der zweite Sonntag im Advent bereits vorbei ist, doch die Blumenfrau versichert mir, dass ich nicht die Einzige bin, die etwas spät dran ist.
»Wir können schließlich nicht alles schaffen, nicht?«, lächelt sie, und ich erwidere das Lächeln und sage, nein, da hat sie recht, wir haben alle so viel zu tun. Noch besser gelaunt setze ich den Heimweg fort, kralle mich an dieses wunderbare Gefühl, eine ganz gewöhnliche, geschäftige Frau zu sein, den Kopf voll mit Weihnachtsvorbereitungen. Eine, die Plätzchen backt und Leberpastete selbst macht, die lange Listen mit Weihnachtsgeschenken für die große Familie schreibt. Ja, genau so eine, die sich auf das Sofa vor dem Kamin fallen lässt, während sie zu ihrem Mann sagt, Puh, war das voll im Kaufhaus!
Das Prickeln hält an bis zum C. F. Richsvej, wo es bereits nach wenigen Metern zerbirst und stattdessen zu Unruhe und Herzklopfen wird. Es ist erst Nachmittag; die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zu Hause ist, ist gering. Trotzdem, bei ihm kann man nie wissen. Meine Beine können sich mit dem Gehirn nicht einigen, ob sie langsamer oder schneller werden sollen, sodass mein sonst so dynamischer, vorwärts gerichteter Gang zögernd und unschlüssig wird wie der eines Tagelöhners. Erst als ich feststelle, dass das Auto nicht in der Einfahrt steht, atme ich durch und eile den Plattenweg und die Haustürstufen hoch und hole den Schlüssel aus meiner Tasche. Meine Hände zittern leicht, aber ich finde das Schlüsselloch und spüre die übliche Erleichterung, dass der Schlüssel passt. Das ist ein Zwangsgedanke von mir, dass ich eines Tages nach Hause komme und feststelle, dass er das Schloss ausgewechselt hat. Um mich auszusperren.
Kaum habe ich die Tür aufgeschoben, als ich auch schon das Telefon klingeln höre. Wieder rutscht mir das Herz in die Hose, und ich springe durch den Korridor in die Küche, wo ich mit einer hektischen Bewegung nach dem Wandtelefon greife, sodass mir der Hörer hinfällt und ich ein allzu kurzatmiges Hallo! herausbringe, während ich nach einer Erklärung suche, wie ich meine Abwesenheit rechtfertigen soll. Falls er mehrmals angerufen hat.
Aber es ist nicht Gert; es ist Ole-Stig, sein kleiner Bruder, der aus den USA anruft, um sich selbst für die Weihnachtsferien einzuladen.
»Falls es euch passt?«, fragt er mit dem deutlichen amerikanischen Akzent, den er sich nach zwanzig Jahren in San Francisco zugelegt hat. Ja, sicher, das passt ausgezeichnet! Nein, wir haben keine anderen Pläne, und ich weiß, dass Gert sich so freuen wird. Fast so sehr wie ich, die ich wieder Orgelbrausen und Schellengeläute höre, weil Ole-Stig vielleicht der Mensch auf der Welt ist, den ich am meisten mag. Der einzige Mann, bei dem ich mich sicher fühle. Wie ich ihm mehrmals in halb berauschtem Zustand versichert habe, würde ich glatt mit ihm durchbrennen, wäre er nicht schwul.
»Kommt Bob auch mit?«, frage ich hoffnungsvoll, denn wenn Ole-Stig nett ist, dann ist Bob lustig, scharfzüngig und witzig auf eine Woody-Allen-artige Weise, die selbst Gert zum Lachen bringt.
»Nein, der muss sich ums Geschäft kümmern«, klingt es knisternd über Satellit. »Du weißt doch, dass viele die Feiertage nutzen, um etwas für ihn zu tun!«
Er kichert mit einem typisch schwulen Kichern, und ich kichere mit, denn er spricht von Penisverlängerungen, dem Spezialgebiet der Klinik für plastische Chirurgie. Ole-Stig und Bob sind als Pioniere auf diesem Gebiet steinreich geworden, und Ole-Stig soll auch zu Hause »ein paar dänischen Kollegen auf die Sprünge helfen und ein paar Workshops abhalten«.
»Dann kann ich genauso gut business mit pleasure verbinden, nicht? Ein bisschen Weihnachten feiern, nicht? Weg von nine-eleven, you know ...«
Wir quatschen weiter über Terrorangst und amerikanischen Patriotismus, und ich verspreche, Ente mit Rotkohl und braunen Kartoffeln und der ganzen Schweinerei zu servieren, und Mandelreis natürlich. Mit einer Mandel drin. Ja, mit einer Mandel drin! Und mit einem Marzipanschwein, das der bekommt, der die Mandel hat und so weiter und so weiter, und es ist auf eine dahinplätschernde, oberflächliche Weise herrlich, bis er fragt, wie es Gert geht.
Meine Stimme ist angespannt, als ich ihm versichere, dass es Gert gut geht, dass er gut mit der Niederlage zurechtkommt und sich mit seiner neuen Rolle als politischer Sprecher arrangiert hat.
»Really? Er ist doch immer so ein lousy loser gewesen!«, sagt er mit brüderlichem Nachdruck. »Und wie geht es dir?«
»Mir?«, frage ich leichthin und versuche zu vergessen, dass Ole-Stig, der Outsider, alles sieht. Auch via Telefonkabel und Satellitenverbindung. Wenn er will. »Mir geht es auch gut. Ich bin zu Hause und mache es mir gemütlich, weißt du.«
»Ist er nett zu dir?«, fragt er.
»Ja, ja. Er ist nett zu mir«, lüge ich und beiße mir in die Lippe.
»Sonst bekommt er es mit mir zu tun! Mit dem Skalpell!«
»Ole-Stig, ich bitte dich!«, sage ich und sehe die Katastrophe so bildlich vor mir – das Skalpell, den chirurgischen Schnitt, den abgetrennten Penis in einer Stahlschüssel, fast kein Blut –, dass ich über mich selbst erschrocken bin. Deshalb beende ich das Gespräch, notiere mir die Ankunftszeit und verspreche, ihn am Flughafen abzuholen. Am 23. Dezember am frühen Morgen.