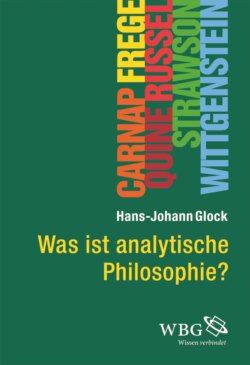Читать книгу Was ist analytische Philosophie? - Hans-Johann Glock - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Von der Sprache zum Geist
ОглавлениеFür den logischen Positivismus, für Wittgenstein und für die Sprachphilosophie war die Sprache wichtig, da sie ein Mittel zur Lösung philosophischer Probleme lieferte. Für den logischen Atomismus ebenso wie für Quine und den Essentialismus ist sie deshalb wichtig, weil sie einen Leitfaden zur Erfassung der ontologischen Konstitution der Welt liefert. Die Wende zur Sprache ermutigte indes auch ein Interesse an der Sprache als einem selbstständigen Gegenstand. Seit den 1960er Jahren ist es üblich geworden, die Sprachphilosophie (linguistic philosophy) unvorteilhaft mit der Philosophie der Sprache (philosophy of language) zu vergleichen (Searle 1969: 3–4; Dummett 1978: 441–443). Die Diagnose ergab zwei Unterschiede: Während die Philosophie der Sprache, ähnlich wie die Philosophie des Rechts, eine Disziplin ist, stellt die Sprachphilosophie eine Methode dar, nämlich zur Lösung von Problemen aus allen Bereichen der Philosophie. Zweitens geht die Sprachphilosophie so vor, dass sie Schritt für Schritt einzelne sprachliche Ausdrücke, Konstruktionen und Redewendungen untersucht, während die Philosophie der Sprache eine systematische Erklärung der Sprache erfordert. Sogar unter jenen, die darauf erpicht waren, sprachliche Analysen zur Auflösung philosophischer Probleme zu nutzen, hatten viele das Gefühl, dass es diesen Analysen ohne eine solche Erklärung an dem angemessenen Fundament fehlt.
Die Philosophie der Sprache ist an der Funktionsweise tatsächlicher Sprachen und nicht an der Konstruktion künstlicher Sprachen interessiert. Dadurch wird allerdings nicht festgelegt, welche Rolle dabei die formale Logik spielen muss. Strawson (1971: 171–172) wies auf das »homerische Ringen« zwischen formalen Semantikern hin, die die Sprache in erster Linie als ein abstraktes System komplexer formaler Regeln betrachten, und jenen, die sie primär als eine Art menschlicher Tätigkeit ansehen. Indes gibt es viele, die diese Kluft überbrücken. Dies gilt etwa für Quine und seinen Schüler Donald Davidson (1984b). Beide verbinden eine formale Semantik mit einem pragmatischen Schwerpunkt auf der Sprache als einer Form sozialen menschlichen Verhaltens. Während Quine letztlich jedoch an künstlichen Sprachen interessiert ist, war Davidson der bedeutendste Verfechter einer Bedeutungstheorie für natürliche Sprachen. Vor ihm galt es als Aufgabe einer Bedeutungstheorie, eine Analyse – in einem angemessen weiten Sinn – des Begriffs der Bedeutung (wie etwa in referentialistischen oder verifikationistischen Theorien und Gebrauchstheorien) zu liefern. Im Gegensatz zu solchen analytischen Theorien schwebt Davidson eine konstruktive Theorie vor, die nicht direkt erklärt, was Bedeutung ist, sondern stattdessen für jeden Satz spezifischer natürlicher Sprachen, wie etwa Suaheli, ein Theorem erzeugt, das die Bedeutung dieses Satzes näher beschreibt. Eine solche Theorie ist empirischer Natur, und ihre tatsächliche Konstruktion ist eine Aufgabe der empirischen Sprachwissenschaft. Die Aufgabe des Philosophen besteht darin, die Anforderungen zu erarbeiten, die derartige Theorien erfüllen müssen. Dies kann durch Tractatus-artige Betrachtungen über die wesentlichen Bedingungen der Sprache erfolgen. So wird etwa die Überlegung vertreten, dass die Sprecher einer Sprache eine potentiell unendliche Anzahl von Sätzen hervorbringen und verstehen können, und dass diese »semantische Produktivität« eine »kompositionale« Theorie erfordere, der zufolge die Bedeutung eines jeden Satzes durch seine Komponenten (aus einem endlichen Lexikon) und die Art ihrer Zusammensetzung festgelegt wird.
Nach Davidson erfüllt eine tarskische Wahrheitstheorie diese Forderungen, da sie mit einer endlichen Anzahl von Axiomen für jeden Satz von L die Ableitung eines »T-Satzes« erlaubt. Beispielsweise liefert eine Theorie für das Englische den Satz
(11) »Snow is white« ist wahr gdw Schnee weiß ist.
Während Tarski sich darum bemühte, eine Definition von Wahrheit zu liefern, verwendet Davidson T-Sätze, um die Bedeutung von Sätzen anzugeben, indem er bestimmt, unter welchen Bedingungen sie wahr sind. Anders als Tarski ist Davidson optimistisch, dass solche Theorien nicht nur für formale, sondern auch für natürliche Sprachen entwickelt werden können. Er vertritt die These, dass sie unter Bedingungen »radikaler Interpretation« (einer Variante der radikalen Übersetzung) empirisch bestätigt werden können, nämlich dann, wenn man die Bedingungen ermittelt, unter denen fremde Sprecher den Sätzen ihrer eigenen Sprache zustimmen.
Für Davidson ist es eine Voraussetzung radikaler Interpretation und deshalb des Verstehens generell, dass die Interpretierten im Großen und Ganzen wahre Überzeugungen haben. Diesem »Prinzip des Wohlwollens« zufolge können die Sprecher einer interpretierbaren Sprache nicht grundsätzlich Unrecht haben. Deshalb kann eine Bedeutungstheorie Fragen über die Realität beantworten, indem sie die logische Form natürlicher Sprachen ermittelt. Namentlich kann sie die Existenz von Ereignissen nachweisen, indem sie zeigt, dass uns bestimmte Folgerungsstrukturen unserer gewöhnlichen Rede ontologisch auf Ereignisse festlegen (1980: Kap. 7). Auch Dummetts Antirealismus (1978) betrachtet Bedeutungstheorien als Leitfäden zur Entdeckung metaphysischer Einsichten. Gegen Davidsons wahrheitskonditionale Semantik behauptet er jedoch, das die Bedeutung von Sätzen nicht durch die Bedingungen bestimmt werden, unter denen diese Sätze wahr sind (denn diese seien unabhängig von unserer Fähigkeit zu entscheiden, ob sie erfüllt sind), sondern durch die Bedingungen, »die ihre Behauptung rechtfertigen«.4
In anderer Hinsicht finden sich Davidson und Dummett auf derselben Seite wieder. Wie viele Ikonen der analytischen Philosophie Mitte des 20. Jahrhunderts (Wittgenstein, die Sprachphilosophie, Quine, Sellars), nehmen sie gegenüber der Sprache eine Perspektive der dritten Person ein und behaupten, dass die Bedeutung von Wörtern und Sätzen durch beobachtbares Verhalten bestimmt ist. Sie alle neigen dazu, der Sprache gegenüber dem Denken Priorität zuzuschreiben. Beide Behauptungen stehen allerdings mit einem einflussreichen Trend jüngeren Datums im Konflikt.
Das Schlagwort, die Bedeutung sei der Gebrauch, kam in Grices Theorie der konversationellen Implikaturen auf den Prüfstand. Grice behauptete, dass viele der von der Begriffsanalyse aufgezeigten Formen sprachlichen Gebrauchs semantisch irrelevant seien, da sie nicht von der Bedeutung der fraglichen Ausdrücke herrührten, sondern auf pragmatische Prinzipien zurückzuführen seien, durch die die sprachliche Rede generell bestimmt werde. Außerdem ist es ein verbreitetes Thema in der Sprachphilosophie, dass Sprache eine Form intentionalen Verhaltens darstellt. Dies bewog Austin zu der Überzeugung, dass die Philosophie der Sprache ein Zweig der Handlungstheorie sei. Grice und Searle führten diesen Vorschlag einen Schritt weiter und verwandelten sie auf diese Weise in einen Teilbereich der Philosophie des Geistes, indem sie nämlich semantische Begriffe auf psychologische wie die der Absicht reduzierten.
Griceschen Theorien zufolge leitet sich die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke von dem Gebrauch ab, den die Sprecher von ihnen machen. Die durch Chomskys »Revolution in der Linguistik« (1965) beeinflussten Ansätze haben sich ganz von der vernünftigen Vorstellung losgesagt, dass Bedeutung und Sprache ihre Wurzeln in der Verständigung haben. So argumentierte zum Beispiel Fodor (1975) dafür, dass sowohl die Bedeutung öffentlicher Sprachen als auch die Intentionalität des Denkens durch eine »Sprache der Gedanken« erklärt werden könne. Externe Sätze seien sinnvoll, weil sie mit internen Symbolen korreliert sind, satzähnlichen Repräsentationen im Gehirn, die unsere Gedanken konstituieren. Fodors »Gedankensprache-Hypothese« ist in hohem Maße repräsentativ für das gegenwärtige Denken. Sie rühmt den Vorrang des privaten Geistes gegenüber der öffentlichen Sprache, hält jedoch zugleich an der Maschinerie und dem Wortschatz der logisch-sprachlichen Analyse (wie Bedeutung und Inhalt) fest, da sie das Denken als einen Prozess logischer Berechnungen mithilfe interner Sätze betrachtet.
Durch diese Umkehrung der Wende zur Sprache ist die Philosophie des Geistes zum florierendsten Bereich der analytischen Philosophie geworden. Nach dem Krieg war der Anstoß zu ihr jedoch zunächst von Wittgenstein und Ryle gekommen.5 Der Hauptstrom der modernen Philosophie von Descartes bis zur Phänomenologie wird durchzogen von der Vorstellung, dass private Erfahrungen nicht nur die Grundlagen empirischen Wissens liefern, sondern auch die der Sprache. Es scheint, als könne die Bedeutung von Wörtern nur festgelegt werden, wenn der einzelne Sprecher diese mit Erfahrungen in Verbindung bringt, die nur er haben und kennen kann. Wittgensteins berühmtes Privatsprachenargument stellt diese Annahme in Frage (1953: §§243–314). Eine Namensgebung kann nur dann einen Maßstab für die Unterscheidung zwischen dem korrekten und inkorrekten Gebrauch eines Wortes festlegen und so diesem Bedeutung geben, wenn sie einem anderen erklärt und von ihm verstanden werden kann. Dieser Angriff auf den Cartesianismus wurde durch Ryles Kritik am Mythos des »Geists in der Maschine« verstärkt, die Vorstellung, Wahrnehmung und Handeln seien Fälle der Interaktion einer immateriellen Seele mit der physikalischen Welt.
Sowohl Wittgenstein als auch Ryle unterscheiden klar und deutlich zwischen der Erforschung kausaler Vorbedingungen geistiger Phänomene wie dem Feuern von Neuronen und der Analyse der mentalen Begriffe, welche die für mentale Phänomene konstitutiven Merkmale näher bestimmen. Der quinesche Naturalismus führte zu einer ganz anderen Betrachtungsweise, der zufolge die Philosophie des Geistes ein Zweig der Psychologie, Biologie oder Neurowissenschaft ist. Ihre weithin akzeptierte Aufgabe besteht darin, geistige Phänomene zu naturalisieren, d.h. zu zeigen, dass sie vollständig in den Begriffen der physikalischen Wissenschaften erklärbar sind.
Zwar wurden Wittgensteins und Ryles Angriffe auf den cartesischen Dualismus positiv aufgenommen, ihre Ablehnung der Ansicht, dass sich mentale Begriffe auf innere Zustände beziehen, die das äußerliche Verhalten verursachen, wurde hingegen zurückgewiesen, vor allem durch die »australischen Materialisten« wie Place, Smart und Armstrong (vgl. Baldwin 2001: 47–52, 201–203). Falls diese inneren Zustände nicht irreduzibel mental seien, müssten sie physikalischer Natur sein. Das Ergebnis war die Identitätstheorie von Geist und Gehirn: Der Geist ist mit dem Gehirn identisch, und die geistigen Eigenschaften sind mit neurophysiologischen Eigenschaften identisch. Die Identitätstheorie war dabei nicht als eine semantische oder analytische Reduktion gedacht, die zeigen sollte, dass Ausdrücke für Mentales dieselbe Bedeutung haben wie Ausdrücke, die sich auf neurophysiologische Phänomene beziehen. Stattdessen wurde sie als eine wissenschaftliche oder synthetische Reduktion vorgebracht, die auf aposteriorischen Entdeckungen beruht. Die Identität des Geistes mit dem Gehirn soll ihr zufolge der Identität zwischen Wasser und H2O entsprechen. Tatsächlich jedoch verband die Identitätstheorie die begriffliche Behauptung, dass sich Ausdrücke für geistige Phänomene auf innere Zustände beziehen, die Verhalten verursachen, mit der wissenschaftlichen Behauptung, dass diese kausale Rolle von neuronalen Zuständen gespielt wird.
Diese Verbindung kam alsbald zu Fall. So wiesen Putnam (1975: Kap. 18–21) und Fodor (1974) darauf hin, dass geistige Phänomene durch psychochemische Phänomene mehrfach realisierbar sind, nicht nur prinzipiell (da ein Mensch, ein Marsianer und ein Computer alle den gleichen Gedanken haben könnten), sondern tatsächlich, und nicht nur speziesübergreifend. Wenn verschiedene Testpersonen ein und dasselbe Problem lösen, werden dabei geringfügig unterschiedliche Teile des Gehirns aktiviert. Dies führte zu einer neuen Form des Materialismus. Dem Funktionalismus zufolge sind geistige Zustände funktionale Zustände einer Maschine. Nicht ein bestimmter physischer Prozess ist konstitutiv für ein geistiges Phänomen, sondern die kausale Rolle oder Funktion, die es innehat, eine Rolle, die in verschiedenen physischen Zuständen realisiert oder implementiert werden kann. Schmerz zum Beispiel kann nur mit derjenigen Funktion gleichgesetzt werden, die einen stimulierenden Input (z.B. eine Verletzung) mit einem Verhaltensoutput (z.B. Weinen) korreliert, nicht mit dem Feuern bestimmter Neuronen.
Die Identitätstheorie von Geist und Gehirn behauptet, Typen geistiger Zustände seien mit Typen neurophysiologischer Zustände identisch. Davidsons »anomaler Monismus« (1980) verabschiedet sich von dieser »Typ-Typ«-Identität, hält jedoch daran fest, dass jedes »Vorkommnis« (token), jeder konkrete Fall eines in einem Individuum vorkommenden geistigen Zustands oder Ereignisses mit einem einzelnen konkreten neurophysiologischen Ereignis oder Zustand identisch ist. Ebenso wie der Funktionalismus hält er an der Vorstellung fest, dass geistige Eigenschaften über physische Eigenschaften supervenieren. Während es zwischen einzelnen Individuen physische Unterschiede ohne geistige Unterschiede geben kann, kann es keinen geistigen Unterschied ohne einen physischen Unterschied geben.
Trotz seiner großen Popularität stieß der Funktionalismus an zwei Fronten auf Einwände. Auf der einen Seite wurde er dafür kritisiert, dass er der unauslöschlich subjektiven Natur des Geistes nicht gerecht werde. So brachten Thomas Nagel (1974) und Jackson (1986) das Argument vor, dass der Materialismus im Allgemeinen und der Funktionalismus im Besonderen die sogenannten »Qualia« nicht verständlich machen können, also den privaten Inhalt geistiger Phänomene. Auf der anderen Seite wurde dem Funktionalismus vorgeworfen, er könne die Intentionalität geistiger Phänomene nicht erklären. Searles »Chinese Room«-Argument macht von einem Gedankenexperiment im Stil der Begriffsanalyse Gebrauch, um zu zeigen, dass die bloße »syntaktische« Fähigkeit der Hervorbringung eines entsprechenden Outputs an Symbolen als Reaktion auf einen bestimmten Input kein genuines Verstehen der Welt oder Denken über die Welt ergibt, da diese Fähigkeit sogar in einem System vorliegen kann, das diese Leistungen bloß simuliert. Außerdem wurde von Externalisten bestritten, dass der Inhalt der Gedanken eines Individuums A ausschließlich durch seine intrinsischen (geistigen oder physiologischen) Eigenschaften bestimmt werde. Stattdessen hänge das, was A denkt, zumindest teilweise von Tatsachen »außerhalb« von A ab, die ihm oft unbekannt sind, Tatsachen die physische Umgebung von A betreffend (Putnam 1975: Kap. 8 und 12) oder seine soziale Umgebung (Burge 1979). Auch zwei physisch identische Individuen könnten unterschiedliche Gedanken haben. Wenn ein physischer Doppelgänger von mir auf der »Zwillingserde« Gedanken über die ihn umgebende durchsichtige, geschmacklose und trinkbare Flüssigkeit hat, so unterscheidet sich der Inhalt seiner Gedanken von meinen: Er kann keine Gedanken über Wasser haben, da er von XYZ umgeben ist und nicht von H2O.
Eine radikale, manche würden sagen, verzweifelte Reaktion auf die Probleme bestehender Spielarten des Materialismus ist der eliminative Materialismus (Churchland 1981). Er betrachtet unsere gewöhnlichen psychologischen Überzeugungen und Begriffe als Teil einer Theorie – »Alltagspsychologie« (folk-psychology) –, die schlicht falsch ist und sich auf keine realen Phänomene bezieht. Daher sollte die Alltagspsychologie durch eine wissenschaftlichere, rein neurophysiologische Theorie ersetzt werden. Wie Quines Nihilismus hinsichtlich der Bedeutung handelt es sich hierbei um eine Form des eliminativen Naturalismus. Aussagen, die Begriffe beinhalten, die innerhalb der Naturwissenschaft keinen Platz finden, insbesondere die über Denken und Bedeutung, werden nicht analysiert, auch nicht in dem schwächeren Sinn wissenschaftlicher Reduktion. Sie werden stattdessen einfach durch naturalistisch akzeptable Aussagen und Begriffe ersetzt.