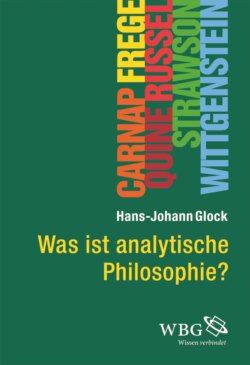Читать книгу Was ist analytische Philosophie? - Hans-Johann Glock - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. Wertfragen
ОглавлениеFür Moore war die Frage, wie »gut« zu definieren ist, das grundlegendste Problem der Ethik. Allerdings ließ ihn sein berühmtes Argument der »offenen Frage« zu der Schlussfolgerung gelangen, dass »gut« undefinierbar sei, da die Eigenschaft des Guten eine einfache Eigenschaft ist, die keinerlei Bestandteile besitzt. Man betrachte irgendeine Definition der Form:
(12) Gut ist X.
(Zur Liste der Kandidaten für »X« gehört »das, was Vergnügen bereitet«.) Was auch immer man für »X« einsetzt – abgesehen von »gut« –, es ist immer eine sinnvolle und in diesem Sinne eine »offene« Frage, ob (12) wahr ist. Selbst wenn die Dinge, die X sind, tatsächlich gut sind, kann »X« nicht dasselbe bedeuten wie »gut« und deshalb auch nicht dazu benutzt werden, »gut« zu definieren. Insbesondere muss jeder Versuch, »gut« durch natürliche Eigenschaften zu definieren, scheitern. Der gegenteiligen Ansicht gab Moore den Namen »naturalistischer Fehlschluss« (dt. 1970: 41/1903: 10–16). Gut ist eine nichtnatürliche einfache Eigenschaft, die uns durch eine Art von rationaler Intuition zugänglich ist. Nichtsdestoweniger superveniert diese Eigenschaft auf natürlichen Eigenschaften: Zwei Dinge, welcher Art auch immer, die genau dieselben natürlichen Eigenschaften hätten, wären demzufolge auch gleich gut.
Spätere analytische Philosophen tendierten zwar dazu, Moores Schlussfolgerung zu akzeptieren, dass moralische Eigenschaften nicht durch natürliche Eigenschaften analytisch definierbar sind, sie verwarfen jedoch seinen Intuitionismus. Das führte viele zu der Schlussfolgerung, dass moralische Urteile keine deskriptiven Urteile oder Tatsachenurteile und deshalb streng genommen überhaupt nicht wahrheitsfähig sind. Dem logischen Positivismus zufolge sind kognitiv sinnvolle Aussagen entweder analytisch oder a posteriori. Moralische Aussagen hingegen fallen unter keine der beiden Kategorien. Sie kamen zu dem Schluss, dass moralische Aussagen keine kognitive Bedeutung haben und dass ihre wahre Funktion nicht darin besteht, Tatsachenbehauptungen zu machen, sondern unsere Emotionen auszudrücken, insbesondere unsere Billigung oder Missbilligung (Ayer 1936: Kap. 6) Stevenson (1944) zufolge erklärt der Emotivismus ebenfalls, warum es zur intrinsischen Natur moralischer Aussagen gehört, das Handeln zu leiten, während Tatsachenbeschreibungen, was die Motivation angeht, neutral zu sein scheinen: Es wäre seltsam zu sagen: »Es wäre richtig zu Φ-en, aber ich bin in keiner Weise dafür zu Φ-en.«
Der Emotivismus läuft Gefahr, moralische Aussagen auf Ausrufe wie »Buh« oder »Hurra« zu reduzieren und somit die Rolle zu ignorieren, die die Vernunft in moralischen Auseinandersetzungen spielt. Mit diesem Defizit beschäftigte sich Hare, der einflussreichste Moralphilosoph unter den in Oxford wirkenden Begriffsanalytikern. Hares »universalem Präskriptivismus« zufolge gleichen moralische Aussagen eher Imperativen als Äußerungen von Emotionen: Ihr Zweck ist es, das Handeln zu leiten. Aber anders als Befehle sind sie universalisierbar: Wenn man eine Lüge moralisch verurteilt, ist man dazu verpflichtet, alle Lügen unter ähnlichen Umständen zu verurteilen. Die Frage, ob eine Person, die ein moralisches Urteil fällt, diese Art von Universalisierung widerspruchsfrei wünschen kann, lässt Raum für begründete Auseinandersetzungen, auch wenn es keine moralischen Tatsachen gibt.
Aufgrund dieses letzten Gesichtspunkts und trotz seiner kantischen Herkunft wurde der universale Präskriptivismus mit dem Emotivismus unter der Bezeichnung »Nichtkognitivismus« in einen Topf geworfen. Die Arbeiten von Hare bereiteten den Boden für die anschließende Debatte. Im Einklang mit der Wende zur Sprache beschränkte er die Moralphilosophie anfangs auf die »Metaethik«, eine Disziplin zweiter Ordnung, die keine moralischen Behauptungen aufstellt, sondern moralische Begriffe analysiert, den Status moralischer Urteile untersucht und die Strukturen moralischer Argumente darstellt. »Die Ethik, wie ich sie begreife, ist die logische Untersuchung der Moralsprache« (dt. 1983: 13/1952: v). Einen ähnlichen Anstoß für die Rechtstheorie und politische Philosophie gab H. L. A. Hart (1962). Durch die Analyse rechtlicher Begriffe versuchte er, unfruchtbare metaphysische Debatten über die Natur von Verpflichtungen und Rechte zu umgehen. Doch unter dem Einfluss wittgensteinscher Ideen verwarf er die Suche nach analytischen Definitionen zugunsten stärker kontextgebundener Erläuterungen der Rolle, die solche Begriffe im Rechtsdiskurs spielen.
Der Nonkognitivismus wurde zunächst von Begriffsanalytikern in Frage gestellt, die dessen Bild des moralischen Diskurses bezweifelten. Geach (1972: Kap. 8.2) brachte vor, dass es dem Vorkommen moralischer Aussagen in Schlussfolgerungen nicht gerecht werde, da Letztere wahrheitsfähige Sätze erforderten. Spätere Nonkognitivisten legten Wert auf die Tatsache, dass wir moralische Aussagen gewöhnlich wahr oder falsch nennen und dass der moralische Diskurs die vollständige Grammatik und Logik von Behauptungen aufweise. Foot und Warnock behaupteten, die scharfe Unterscheidung zwischen deskriptiven und präskriptiven Verwendungen der Sprache sei nicht haltbar. Zu den am weitesten verbreiteten moralischen Begriffen gehören »dicke Begriffe« wie Unhöflichkeit. Und Searle (1969: Kap. 8) vertrat die Auffassung, dass es durch Berufung auf institutionelle Tatsachen schließlich doch möglich sei, präskriptive Aussagen von deskriptiven abzuleiten, also ein »Sollen« von einem »Sein«.
Putnam (1981) wies in eine ähnliche Richtung, als er darauf beharrte, dass die Wissenschaftstheorie die Unterscheidung von Tatsachen und Werten nicht länger stütze, da die wissenschaftliche Forschung selbst auf Normen beruhe. Und McDowell (1998) und Wiggins (1991) drängten darauf, die nichtkognitivistische Dichotomie zwischen dem Subjektiven (Ausdruck, Präskription) und dem Objektiven (Beschreibung) zu überdenken, indem sie die Analogie zwischen Werten und sekundären Qualitäten wie Farben untersuchten. Ganz generell wurden Ähnlichkeiten zwischen moralischen Urteilen und Wahrnehmungsurteilen untersucht, und zwar durch eine Wiederbelebung des Intuitionismus, die vor allem in Großbritannien unter der Bezeichnung »Partikularismus« (Dancy 2004) erfolgte.
Zur gleichen Zeit standen sowohl der Nonkognitivismus als auch der Intuitionismus vor einer neuen, methodologischen Herausforderung. Können metaethische Fragen bezüglich der Logik des moralischen Diskurses überhaupt von substantiellen moralischen Fragen getrennt werden? Zum einen bewegte sich Hare selbst von einer angeblich neutralen Metaethik hin zu einer Position, die substantielle ethische (in seinem Fall utilitaristische) Schlussfolgerungen aus der Natur unserer moralischen Begriffe ableitete. Zum anderen wurde von quinescher Seite harsche Kritik an der Unterscheidung zwischen der Analyse von Begriffen und der Aufdeckung von Tatsachen laut (Harman 1977). Drittens rückten in den 1960er und 1970er Jahren Themen wie Krieg, nukleare Abschreckung, Abtreibung, ziviler Ungehorsam und die Zerstörung der Umwelt in den Vordergrund. Durch die Rebellion der Studenten übten diese Anliegen einen direkten Einfluss auf die Lehrpläne von Universitäten und die Forschung aus. Vielen Philosophen wurde klar, dass sie substantielle moralische Fragen mit sich bringen, die man weder religiösen Dogmen noch politischen Ideologien wie dem Marxismus überlassen konnte. Der Versuch, solche spezifischen moralischen Fragen auf rational verbindliche Weise zu beantworten, wurde »angewandte Ethik« genannt. Und schließlich wurde die Wiedergeburt der normativen Ethik vollendet durch die Einsicht, dass so etwas wie eine große normative Theorie jenseits der Begriffsanalyse nach wie vor möglich war. Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit (1972) war ein hochinteressanter Trendsetter. Sie läutete den Aufstieg der bisher in der analytischen Tradition vernachlässigten politischen Theorie ein. Rawls versuchte, ein Prinzip distributiver Gerechtigkeit zu verteidigen, indem er die Art von Regeln untersuchte, für die sich Akteure, die ihre zukünftige Stellung in einer Gesellschaft nicht kennen, rationalerweise aussprechen sollten. Rawls löste des Weiteren eine Wiederbelebung der kantischen Vorstellung aus, dass es jenseits der von der Entscheidungstheorie untersuchten instrumentellen Rationalität und unabhängig von einer kontroversen Ontologie moralischer Tatsachen so etwas wie objektive praktische Gründe für Handlungen gebe.
Diese Entwicklungen bedeuteten nicht das Ende der Metaethik, sondern führten stattdessen zu einer Verflechtung von metaethischen und ethischen Diskussionen. Darüber hinaus verlagerte sich der Schwerpunkt von spezifischen moralischen Begriffen hin zu Untersuchungen der Natur moralischer Rechtfertigung und des metaphysischen Status von Werten. Auf dieser Ebene machte sich auch der Naturalismus wieder geltend (vgl. Railton 1998). Eine Lesart vertritt die Auffassung, dass moralische Begriffe innerhalb eines naturalistischen Rahmens dann ihren Platz finden können, wenn wir den fehlgeleiteten Ehrgeiz aufgeben, sie zu analysieren. Moralische Prädikate erfüllen naturalistische Forderungen, da die Eigenschaften, die sie zuschreiben – z.B. einen Beitrag zum menschlichen Wohl zu leisten – in den besten Theorien der empirischen Wissenschaften eine Rolle spielen (Boyd, Sturgeon) oder weil sie Idealisierungen psychologischer Eigenschaften darstellen (Lewis, Harman). Es gibt jedoch noch eine gegensätzliche, eliminative Version des Naturalismus. Mackies »Irrtumstheorie« (1977) zufolge sind moralische Begriffe und Urteile tatsächlich deskriptiver oder Tatsachen behauptender Natur. Das Problem ist nach Mackie, dass den moralischen Begriffen in der Wirklichkeit nichts entspricht, was rein physikalischer Natur wäre. Daraus zieht er den beunruhigenden Schluss, dass alle unsere moralischen Urteile falsch sind.
Ein ähnlich bilderstürmerischer Angriff auf die Voraussetzungen moralischer Diskussion wurde von zeitgenössischen Nietzscheanhängern wie MacIntyre (1984) und Williams (1985) vorgebracht. Sie behaupteten, die Philosophie habe nicht die Kraft, die durch den Niedergang der Religion hinterlassene moralische Lücke zu füllen. Was alle wichtigen Positionen in der normativen Ethik vereint, ist die Forderung nach einer objektiven, rationalen und unpersönlichen Bestätigung. Aber das Festhalten am Projekt einer philosophischen Ethik sei, so die Anhänger von Nietzsche, zweifelhaften Ursprungs und nicht praktikabel, zudem fehle es ihm an Glaubwürdigkeit. Obwohl sie weniger vernarrt in die Wissenschaft sind als die Naturalisten, weist ihre Argumentation in einer Hinsicht doch in eine ähnliche Richtung. Sogar was Wertfragen angeht, so heißt es, ist die Philosophie keine autonome Disziplin. Vielmehr muss sie durch andere Arten des Diskurses ergänzt werden, sei es durch die Naturwissenschaft, die Sozial- und Geschichtswissenschaften oder sogar durch Kunst und Religion.
2 Einer revisionistischen Lesart zufolge hat Russells Ontologie zu keiner Zeit nichtexistierende Entitäten eingeschlossen (Griffin 1996; Stevens 2005: Kap. 2). Es gibt Textpassagen, die verneinen, dass z.B. Chimären Dinge sind, die durch Begriffe bezeichnet werden. Russell vertrat allerdings auch die Meinung, dass »in einem gewissen Sinne nichts etwas ist«, und schrieb: »Was auch immer Gegenstand des Denkens sein oder in einer wahren oder falschen Proposition vorkommen oder als eines gezählt werden kann, nenne ich einen Term … jeder Term hat Sein, d.h. in irgendeinem Sinne ist er. Ein Mann, ein Augenblick, eine Zahl, eine Klasse, eine Beziehung, eine Chimäre oder irgendetwas anderes, das man nennen kann, ist sicherlich ein Term; und zu bestreiten, dass dieses oder jenes Ding ein Term ist, muss immer falsch sein« (1903: 73, 43). Griffin versucht diese Liste zu entschärfen, indem er darauf beharrt, dass Russell hier nur aus Versehen von Termen spricht, obwohl er eigentlich von denotierenden Ausdrücken sprechen will. Aber das kommt nicht in Frage, da die Aufzählung wesentlicher Bestandteil einer Schlüsselpassage ist, in der der Begriff eines Terms von Russell erklärt wird. Man beachte außerdem, dass die orthodoxe Interpretation mit Russells eigener späterer Deutung seiner Entwicklung übereinstimmt.
3 Der Erste, der den Gegensatz zwischen den Philosophien der »idealen« und der »normalen« Sprache aufbrachte, war Gustav Bergmann, der selbst ein Philosoph der idealen Sprache war (Rorty 1967: 6–7, 15–24).
4 Außerdem sind sie sich darüber uneinig, wie der Herausforderung zu begegnen ist, nichtdeklarative Sätze durch Wahrheits- oder durch Behauptungsbedingungen verständlich zu machen (vgl. Glock 2003a: 159–165).
5 Doch Broad 1925 ahnte bereits die nachfolgende Debatte über den Platz des Geistes in der physikalischen Welt voraus.