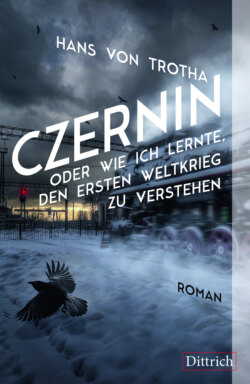Читать книгу Czernin oder wie ich lernte, den Ersten Weltkrieg zu verstehen - Hans von Trotha - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
18
ОглавлениеFür den 3. Dezember hatte das Hofprotokoll die Übergabe des Beglaubigungsschreibens angesetzt. Das dabei entfaltete Zeremoniell wirkte so aufgesetzt bombastisch wie die Bukarester Architektur.
Neben König Carol und Königin Elisabeth residierten am Hof Kronprinz Ferdinand und Kronprinzessin Maria. Carol und Elisabeth hatten eine Tochter gehabt. Sie war im Alter von drei Jahren gestorben, ein Verlust, der die Mutter die Flucht in eine Welt hatte antreten lassen, die besser war als jene, in der sie sich tagtäglich bewegte. Bei der Besetzung der Position eines Thronfolgers war es zu handfesten Meinungsverschiedenheiten zwischen König und Königin gekommen. Beide hatten eigene Verwandtschaft im Auge. Die Wahl fiel schließlich auf einen Neffen des Königs, Ferdinand von Hohenzollern, der in Bukarest als weit weniger bemerkenswert galt als seine Frau Maria, Missi genannt, eine geborene Prinzessin Sachsen-Coburg-Gotha. Sie muss von berückender Schönheit gewesen sein, als sie in jungen Jahren in Bukarest einzog. Und sie war blond.
Während der Kronprinz seine Favoritinnen vorzugsweise aus dem Kreis der Offiziersgattinnen rekrutierte, betrachtete Kronprinzessin Maria das diplomatische Corps als ihr Revier. Aufgrund des häufigen Personalwechsels in dieser ansonsten interessanten Vorauswahl war eine langjährige Konstante dann doch ein Mann vor Ort, Prinz Barbu Stirbey, der allgemein als Vater von Prinzessin Ileana galt. Kronprinz Ferdinand hingegen hielt über Jahre der Gattin des Obersten Preban so etwas wie die Treue, einer ehemaligen Hofdame seiner Frau, die jene schon mal vorschickte, wenn es darum ging, die Standhaftigkeit einer aktuellen Eroberung auf die Probe zu stellen. Es war eine harte Probe.
Der neue Gesandte traf zunächst im Thronsaal auf den König und den Kronprinzen, überreichte die Beglaubigung und wechselte ein paar Worte mit den Herren, die für diese Zeremonie den Orden vom Goldenen Vlies angelegt hatten. Czernin konnte den Blick lange nicht von dieser Dekoration abwenden. Sodann wurde der Gesandte in einen kleineren Saal geleitet, wo die Königin und die Kronprinzessin ihn erwarteten. Auf beide war Czernin besonders neugierig. In Kronprinzessin Maria stand ihm das leibhaftige Pendant zur sagenhaften Fama überirdischer Schönheit und erotischer Unersättlichkeit gegenüber, eine Fallhöhe, die mathematisch Enttäuschung nach sich ziehen musste. Auch jetzt noch, gegen Ende ihrer Dreißiger, mochte eine sinnliche Ausstrahlung von der schlanken, selbstbewussten Frau ausgehen, die wohl etwas mit den hungrigen blauen Augen zu tun hatte. Czernin erreichte sie nicht. Umgekehrt legte die Kronprinzessin ein schwer zu übersehendes Desinteresse an den Tag. Da ihr die Übergabe eines Beglaubigungsschreibens vor allem als Musterung in eigener Sache diente, zog sie sich angesichts des unbefriedigenden Ergebnisses rasch zurück; Königin Elisabeth hingegen freute sich stets aufrichtig über die Begegnung mit einem Menschen. All die Liebe, die sie ihrem Kind nicht schenken durfte, hielt sie für die Welt bereit. Es rührte Czernin, wie die fast erblindete Dame, sie stand in ihrem siebzigsten Jahr, sich mühte, ein Gegenüber anzustrahlen, das sie allenfalls schemenhaft wahrnehmen konnte. Lange hielt sie seine Hand in der ihren.
Von ihr sprach man überall in Europa. Die geborene Prinzessin von Wied wirkte vielseitig in ihrem Land, das sie als Einzige am Hof tatsächlich als das ihre betrachtete. Im Krieg kümmerte sie sich um Verwundete und zeichnete andere, die es ihr gleichtaten, mit dem Elisabeth-Orden aus. Im Frieden gründete sie Schulen, um Bukarester Mädchen vor einem Leben auf der Straße zu bewahren. All dies tat sie als Königin Elisabeth. Ihre wahre Bestimmung aber fand sie in den Worten, mit denen sie Weiten schuf, in denen andere Gesetze walteten und die dennoch ebenso wirklich waren wie Tod, Krieg und Elend, nur schön. Unter dem Namen Carmen Sylva schrieb sie Versepen, Romane, Märchen, Gedichte und Erzählungen. Einer ihrer Gedichtbände war von der Académie francaise ausgezeichnet worden. Czernin hatte einige ihrer Bücher in der Hand gehabt, sich aber in der Regel auf seine alte Angewohnheit beschränkt, den ersten und den letzten Satz zu lesen. Marie las mehr. Sie verstand davon auch etwas. Die Versepen Sappho und Hammerstein waren nicht so ihre Sache, aber sie mochte den Märchenkreis Leidens Erdengang und die Gedichtzyklen Mein Rhein, Meine Ruh’ und Unter der Blume. Auch die Romane Feldpost und Deficit hatte Marie gelesen. In Arbeit war, das hatte der freundliche Buchhändler in Wien nach einem Blick in die Kataloge gesagt, eine auf fünf Bände angelegte Ausgabe der gesammelten Essays unter dem Titel Geflüsterte Worte.
Die Königin forderte den Gesandten auf, neben ihr in einer Ecke des Saals Platz zu nehmen, wobei sie ihr himmelblaues Gewand wellenreich um sich drapierte. Czernin sagte, wie sehr Marie sich darauf freue, Ihre Majestät kennenzulernen.
»Ihre Majestät oder Carmen Sylva?«, fragte sie, wobei sie zu laut lachte. »Vielleicht kann sie mir ja helfen, Ihre liebe Frau«, fügte sie in ernstem Ton hinzu. »Es gibt hier so viel zu tun. Wenn man die Mittel hätte, lieber Graf.«
Auch die Königin neigte dazu, das Wort zu behalten. Doch bei ihr wurde Czernin nicht ungeduldig. Ihm war, als lese er in einem fantastischen Roman, in dem jede Wendung jederzeit für möglich gehalten werden musste.
»Sind Sie reich, Graf? Unlängst fragte mich ein Neffe: Liebe Tante, wann wirst du dir endlich einen neuen Hut kaufen? Ich antwortete ihm: Ich habe gar nicht das Geld dazu. Hätte ich aber die dazu nötigen hundert Francs übrig, würde ich mir keinen neuen Hut anschaffen, sondern ich würde mit dieser Summe eine ganze Familie aus dem Elend retten.«
Gestik und Mimik waren theatralisch, wirkten aber wie gebremst.
»Graf«, die ernste Anrede begleitete einen erneuten Stimmungswechsel, »ist Ihnen aufgefallen, wie viele Blinde es hier in Bukarest gibt? Überall sieht man sie. Und sie sehen dich nicht. Wäre ich eine reiche Amerikanerin und hätte Millionen, ich würde Tausende von diesen unglücklichen Menschen glücklich machen.«
Eine angespannte Stille bemächtigte sich des großen, kalten Raums, stand dieses Schicksal derjenigen, die da sprach, doch offensichtlich unmittelbar bevor. Sie richtete sich auf, breitete die Arme aus und begann, kreisende Bewegungen mit ihnen zu vollführen, was ihr Gewand wieder in Bewegung versetzte. »Dieses Kleid ist wie das Meer. Und das Meer ist das Leben.«
Czernin bewunderte pflichtschuldig das Kleid und, um der Verlegenheit zu entkommen, mit einiger Überzeugung ein Bild, das hinter der Königin an der Wand hing, ein Seestück, das aus der Masse der mediokren Gemälde herausstach, die er im Schloss sonst gesehen hatte.
»Mein Meer. Ist es nicht herrlich?« Sie wandte sich dem Bild zu. »Wie schön, dass es Ihnen aufgefallen ist. In Konstanza im Hafen, da habe ich eine ganz kleine Villa. Die steht am Ende eines vorspringenden Kais. Sie liegt mitten im Meer.«
Die Königin stand direkt vor dem Bild, dessen beherrschende Farben Blau, Grau und Grün waren. »Das Meer lebt. Wenn es ein Symbol gäbe für den Begriff der Ewigkeit, so wäre es das Meer. Unendlich in seiner Größe und ewig in seiner Bewegung.«
Die alte Dame hob die Hände und berührte die dick aufgetragene Farbe. Czernin wäre fast aufgesprungen, um das Kunstwerk zu schützen.
»Ein trüber Tag mit Wind. Einer nach dem anderen kommen die gläsernen Wasserberge herangewälzt, überstürzen sich und brechen sich an dem felsigen Strande.«
Der Maler hatte bei der Ausarbeitung der Schaumkronen, in denen sich Grau und Weiß mit jenen Farben mischten, aus denen das Wasser sonst zusammengesetzt war, die Farbe dick auf die Leinwand aufgetragen, sodass man sie wohl tatsächlich erfühlen konnte.
»Und das Meer atmet. Flut und Ebbe sind seine Atemzüge. So arbeitet es Tag und Nacht, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert. Es kümmert sich nicht um die vergänglichen Wesen, die sich die Herren der Welt nennen, diese Eintagsfliegen, die kommen und die wieder gehen, kaum dass sie gekommen. Denn das Meer hat Zeit. Auf tausend Jahre mehr oder weniger kommt es ihm nicht an.«
Da stand die alte Dame in ihrem blauen Gewand vor dem so lebendig auf die Leinwand gebrachten Meer wie eine Priesterin am Altar, berührte sacht die Farbe und sprach fest und pathetisch.
»Aber einmal, ganz plötzlich beginnt das Meer zu wandern. Eines Tages erhebt sich irgendwo aus dem Meere das Land. Seine Geburt hat revolutionären Charakter, Erdbeben, speiende Krater, stürzende Städte und sterbende Menschen – aber neues Land ist da.«
Czernin war sich nicht sicher, ob mit seiner Anwesenheit noch gerechnet wurde. Er begann, sich zu genieren. Ein Zeichen konnte er der Königin nicht geben. Unterbrechen durfte er weder die Königin noch Carmen Sylva. Da beschloss er, sich dezent zu entfernen. Zwischen den nackten Wänden hallten die Schritte, so vorsichtig er auch auftrat.