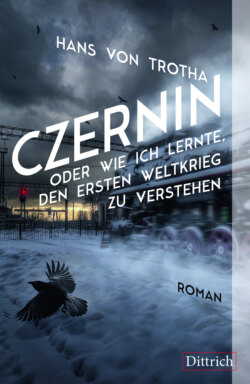Читать книгу Czernin oder wie ich lernte, den Ersten Weltkrieg zu verstehen - Hans von Trotha - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
22
ОглавлениеZu Weihnachten kam die Familie. Der Orientexpress hatte wie immer Verspätung. Warten auf Marie und die Kinder war nicht so schlimm wie Warten sonst. Und schließlich fuhr er heran, der schwere eiserne Zug. Trotz der vielen Reisen blieb Czernin gefangen von dem Bild der schwarzen ungestümen stählernen Masse, die eine enorme Kraft zum Stillstand zwang, wogegen sie sich mit aus Nüstern und Ventilen gestoßenen Wolken zu wehren schien. Vielleicht berührte ihn der Anblick so sehr, weil er darin die beiden Seiten erkannte, die ihn im Widerstreit bisweilen aufzureiben drohten, die Kraft, die weiter drängte, und die enorme Konzentration von Energie, die er immer wieder aufzubringen hatte, um sie im Zaum zu halten.
Der Dampf verzog sich und gab das Bild seiner fünf ihm über den Asphalt rufend und lachend entgegenstürmenden Kinder frei. Czernin kam es vor wie eine Filmaufnahme, in zu langsamer Geschwindigkeit auf dem Apparat gespielt. Der Moment hätte ewig währen dürfen. Ja, der wäre es gewesen. Czernin juchzte laut, als er das erste der Kinder hochhob, woraufhin die anderen die gleiche Behandlung einforderten. So warf er alle fünf nacheinander in die Höhe, juchzte jedes Mal, verlor dabei den Hut, der den Bahnsteig entlangrollte. Dann hob er, in Schwung und Übermut geraten, juchzend auch die Mutter in die Höhe, während die Bagage um den Hut kämpfte. Der Älteste, der den Wettbewerb naturgemäß gewann und die Trophäe auf dem jugendlich schönen Kopf trug, war schon fünfzehn, das Mädchen keine zwei Jahre jünger. Noch ein Moment, dann wäre sie fast Frau. Er hätte doch gern noch eine Tochter gehabt. Zwischen all den Energiebündeln, denen die Natur die Aufgabe eingepflanzt hatte, sich zu nehmen, was zu bekommen war, um dann herauszufinden, ob sich nicht noch mehr erkämpfen ließ, Maritschy. Man sah ihr nicht an, dass sie fünf Kindern das Leben geschenkt hatte. Sie hatte selbst etwas von ihrer Mädchenhaftigkeit bewahrt, als weigere sie sich, angesichts der an ihr zerrrenden Jugend die letzte Erinnerung an die eigene preiszugeben. Czernin wurde leicht ums Herz, weil wieder familiäre Umstände eintraten.
Die Kinder waren zwischen allerlei Geheul begeistert vom neuen Zuhause. Das fremdländische Flair legte sich wie Zuckerguss auch über Gegenstände und Verrichtungen des Alltags, die man sonst kaum wahrnahm. Marie taxierte sie auf die Folgen hin, die sie für ihr Leben haben würden, und kam zu einer nüchterneren Bilanz. Aber Leben hieß, sich arrangieren. Und Czernin versprach ihr einen glücklichen Sommer. Er wusste, die kleine Villa in Sinaia war ganz nach ihrem Geschmack.
Über die Weihnachtstage versuchte jeder nach seiner Façon, sich an die neuen Räume und Wege, an die Gegenstände und Gerüche sowie an die Menschen, die jetzt mit ihnen den Haushalt teilten, zu gewöhnen. Czernin hatte einen besonders großen glitzernden Baum in die Halle der Gesandtschaft hieven lassen, um Heimweh prophylaktisch zu begegnen. Diplomatie war Prävention. Sie feierten ein vom Fremden verzaubertes Fest. Das verdrängte Maries sorgenvolle Überzeugung, die schönste Zeit ihres Familienlebens hinter sich zu haben. Sie war auf der Zugfahrt nagender geworden, je unausweichlicher sich der Orientexpress in den Balkan hineingearbeitet hatte. Das Gefühl kehrte mit Macht zurück, als sich alle nach den Feiertagen daranmachten, in der Fremde zu Hause zu sein.
In der Gesandtschaft war man zum Jahreswechsel mit der Ablösung der Regierung beschäftigt. Der erfahrene König hatte recht behalten. Ministerpräsident Maiorescu demissionierte am 30. Dezember. Jetzt herrschte erst einmal Stillstand, solange sein Nachfolger Bratianu die vielen zu vergebenden Posten vergab und die damit einhergehenden Angebote sichtete.
Czernin musste herausfinden, wie es um den Vertrag stand. Der König wich aus. Bei seiner letzten Audienz hatte der Gesandte scheinbar arglos den Vorschlag gemacht, das Bündnis bekannt zu machen und von den Parlamenten ratifizieren zu lassen. Die Geschwindigkeit, in der die Farbe aus dem Gesicht des Königs wich, war bei allen geschraubten Beteuerungen der beste Beweis, dass der Vertrag nicht mehr war als ein inhaltsloser Fetzen Papier. Das herausgefunden zu haben, war allerdings gewiss nicht das diplomatische Meisterstück, das die Welt von Czernin erwartete.
Die ganz große Chance kam ausgerechnet in Person des ausgewiesenen Österreichverächters und Ungarnhassers Nikolai Filippescu, eines exponierten Vertreters des Bukarester politischen Sumpfes. Bei ihm schienen Fäden aus den unterschiedlichsten Richtungen zusammenzulaufen. Er bat den k.u. k Gesandten, über den er sich schon vielfach lästerlich ausgelassen hatte, um ein Gespräch, streng vertraulich, an geheimem Ort. Was dieser Filippescu zu sagen hatte, verschlug Czernin den Atem.
Sie saßen im einzigen Zimmer einer Jagdhütte vor den Toren Bukarests, einem feuchten, modrig stinkenden Raum, der notdürftig von einem undichten Kanonenofen mit Wärme versorgt wurde. Niemand durfte von der Zusammenkunft erfahren. Vor der Tür, es hatte am Morgen zu schneien begonnen, warteten die Fahrer in den Wagen. Sie kannten sich. Da aber ihre Herren als verfeindet galten, zogen sie es vor, einander zu ignorieren. In Hut und Mantel saßen die Feinde auf dreibeinigen Holzschemeln in der Nähe des Ofens und beäugten sich misstrauisch.
Filippescu eröffnete die Partie.
»Sie haben ein Problem. Ich habe die Lösung.«
Czernin kam sich ein wenig deplatziert vor mit dem Pelzkragen, den Gamaschen und der feinen rotbraunen Aktentasche, die er unnützerweise auch hierher mitgenommen hatte.
»Es würde mich wundernehmen, wenn es Sie störte, wenn ich rauchte.«
Der verkorkste Satz verriet Nervosität. Czernin holte das silberne Etui aus der Innentasche des gefütterten Mantels, klappte es auf, nahm eine Zigarette heraus und klopfte mit ihr aufs Etui, das er schon wieder wegstecken wollte, als Filippescu mit einer Bewegung signalisierte, er wolle auch.
»Siebenbürgen.« Mit dem Wort, an dem Czernin den matt farbigen Klang mochte, hatte Filippescu ein Problem allenfalls benannt, gewiss keines gelöst.
»Ihr gebt uns Siebenbürgen. Wir geben euch Rumänien.«
Jetzt wäre Czernin an der Reihe gewesen. Aber zu diesen ebenso dürren wie wirren Worten fiel ihm nichts ein.
»Siebenbürgen inklusive. Sie verstehen.«
Eine Ahnung durchzuckte den Gesandten. Er saugte hastig an der Zigarette.
»Ganz richtig. Sie haben mich ganz richtig verstanden.«
Hatte er etwas gesagt?
»Rumänien vereinigt sich mit Siebenbürgen. Und das ganze Rumänien, mit Siebenbürgen, vereinigt sich mit der k.u.k. Monarchie. Man kann ja an ein Verhältnis denken, wie es Bayern zum Deutschen Reich hat. Das biete ich an. Jetzt.«
Czernin war sprachlos.
»Die Brüder in Siebenbürgen haben das Recht, sich mit ihrem Land zu vereinigen. Ohne diese Vereinigung wird es nie einen echten Frieden geben zwischen den Ungarn und den Rumänen. Vielleicht zwischen den Ländern, nie zwischen den Menschen. Aber wir können das große Rumänien unter die schützenden Flügel der großen Monarchie geben. Wir können das.«
Czernin rauchte längst wieder. Er war außer sich. Das war die Lösung. Für Siebenbürgen, für Rumänien, für Österreich. Und für ihn der Durchbruch. Der erste Triumph. Er, Graf Ottokar Czernin, war der Pate einer Volte, die die Landkarte Europas schlagartig veränderte. Als Czernin sich wieder im Griff hatte, stand er auf.
»Ich werde mich melden.«
Draußen war die Welt weiß verschneit und weit.
Tisza war außer sich. Wutentbrannt eilte er nach Wien und stellte den ahnungslosen Kaiser. Bis zu diesem war die kühne Vision des Großdiplomaten in Bukarest noch gar nicht vorgedrungen, Minister Berchtold hatte die Idee erst einmal für sich behalten, weil er sie für nicht besonders realistisch hielt. So erfuhr Seine Majestät von dem Vorschlag in der wutverzerrten Version, in der der Ungar ihn ein für alle Mal zertrümmert wissen wollte. Der Kaiser zögerte keinen Augenblick, sich hinter seinen ungarischen Ministerpräsidenten zu stellen.
»Wie blöd kann man sein?« Czernin dachte es natürlich nur. »Ohne dass es weh tut.« Vielleicht sagte er es halblaut in seinem Arbeitszimmer oder, wenn die Wut zu sehr in ihm aufheulte, auch zu Hause vor sich hin. In Pest, am Ballhausplatz, in Schönbrunn, Idioten allenthalben. Er wünschte ihnen einen großen Krieg an den Hals, jetzt, ohne sich Rumäniens sicher zu sein, ohne die Beziehungen zu Bulgarien als möglicher Alternative ausgebaut zu haben. Da würden Deutschland und Österreich-Ungarn ganz schön bleich aussehen. Dann würden sie sich danach sehnen, sie hätten auf ihn gehört. Aber bitte. Er hatte ihnen die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert. Und sie mussten sie ausschlagen. Imbezile! Marie bat, er möge vor den Kindern nicht so viele von den kräftigen Ausdrücken verwenden. Sie nahm die schlechte Laune mit der ihr eigenen Demut hin. Das war nicht immer leicht. In der letzten Zeit hatte sie immer wieder ein Unwohlsein verspürt, sich sogar übergeben müssen. Dabei hatte sie sich an das scharfe Essen eigentlich gewöhnt. Es war auch nicht weiter schlimm, zumal sie ansonsten ausgesprochen vergnügt war.
Der Gesandte weilte gerade in Konstantinopel bei Botschafter Markgraf Pallavicini, als der Ruf Tiszas einging, Czernin möge sich umgehend in Budapest einfinden. So reiste der gleich weiter in die Höhle des Löwen und machte sich auf einiges gefasst. Jedoch, wiederum empfing Tisza ihn freundlich, wenn auch die Worte, mit denen er den Vorstoß Czernins zu Staub zertrat, an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen.
Nach Beendigung des Gesprächs begleitete Tisza seinen Besucher zur Tür. Bevor er zur Klinke griff, hielt er Czernin sacht am Ellenbogen fest. In seinem Blick hätte man lesen können, dass ihn etwas drückte.
»Eins noch, Czernin, und nehmen Sie es mir nicht übel. Nehmen Sie es als Zeichen der Freundschaft.«
Sie hatten wahrlich genügend unangenehme Dinge besprochen. Was konnte da noch Grund für eine derart verschämte Unsicherheit sein?
»Am Ballhausplatz hat man sich, wie soll ich sagen, noch nicht an Ihren … Ton gewöhnt.«
An seinen Ton gewöhnt?
»Also, wie soll ich sagen. Ihre Berichte fallen auf.«
Das war ja auch das Mindeste. Sie waren gut.
»Man echauffiert sich manchmal ein wenig. Verstehen Sie?«
Czernin verstand kein Wort.
»Es fiel das Wort unbotmäßig.«
Es fiel das Wort unbotmäßig?
»Es ist ja nur ein Hinweis, Czernin. Machen Sie sich nicht zu viel daraus. Es könnte aber sein, dass Sie sich Scherereien ersparen, wenn Sie, ach, wenn Sie sich einfach an die Form halten und insgesamt ein wenig … nun ja … Also, mit der Apodiktik müssen Sie ein bisschen aufpassen, Czernin.«
Als Tisza realisierte, dass der andere trotzig weiter so tun wollte, als verstünde er nicht, gab er sich einen Ruck.
»Mein Gott. Wenn Sie meinen, der Vertrag zwischen uns und Rumänien ist nur noch ein wertloser Fetzen Papier, dann ist das vielleicht korrekt, man kann es aber auch in anderen Worten sagen, nicht wahr? Einfach in ein paar anderen Worten.«
Czernin war längst dunkelrot angelaufen. In seiner Kehle rasselte es. Dafür hatten sie Zeit. Damit beschäftigte sich Wien. Sie wollten, dass er sich verstellte, einen der Kriecher aus ihm machen, die sie selbst waren.
»Ich verstehe, Exzellenz«, sagte er schmallippig, »Sie legen mir die Demission nahe. Und ich werde sie selbstverständlich einreichen, sobald Bukarest erreicht ist.«
»Um Gottes willen, bloß nicht! Nur ein bisschen Zurückhaltung, das ist alles. Vielleicht ein bisschen länger überlegen, ein bisschen langsamer schreiben. Das kann doch nicht so schwierig sein. Aber sonst bleib, wie du bist, um Gottes willen. Wir brauchen Leute wie dich. Wir haben nicht viele. Das weißt du so gut wie ich. Reiß dich halt ein bisschen zusammen. Das ist alles. Aber bleib vor allem, wie du bist.«
Stephan Tisza hatte ihn, per du, seiner höchsten Wertschätzung versichert. Angesichts dieses Ereignisses konnte Czernin dessen Anlass leicht verdrängen. Im Zug dachte er nicht über die Idioten am Ballhausplatz nach, schon gar nicht über die Demission, nicht einmal darüber, dass die Fahrt so lange dauerte. Er war erfüllt von Freundschaft und wild entschlossen, sich dieses Hochgefühl nicht von ein paar Wiener Trotteln eintrüben zu lassen. Das bisschen Selbstbeherrschung, da hatte Stephan Tisza schon recht, war er der Geschichte schuldig.
Zu Hause angekommen, strahlte er immer noch wie ein frisch verliebter Knabe. Seine eigene Rosigkeit erfüllte ihn so sehr, dass er die Maries nicht bemerkte. Am Ende des Soupers fiel es ihm dann doch auf.
»Was schaust du so?«, fragte er.
»Es gibt noch etwas anderes als die Diplomatie, Lieber«, sagte Marie. Sie saßen am großen Esstisch. Die Kinder waren im Bett. Vor ihnen standen Dessertschalen, aus denen sie gerade eine köstliche Charlotte gegessen hatten. Sie hatten von Fürstenberg einen wunderbaren Koch geerbt. Er stammte aus Komotau in Böhmen und verstand es, die österreichische, die böhmische und die balkanische Küche perfekt zu amalgamieren. Wenn der Hausherr gut gelaunt war, kündigte er gern an, seinen Koch als Inkarnation des reformierten Kaiserreichs in Wien öffentlich zur Schau zu stellen.
»Ich weiß«, grummelte Czernin.
»Ich weiß, dass du das weißt. Aber es gibt etwas, das weißt du noch nicht.«
»Was ist schon wieder passiert? Eines der Kinder?«
»Hm. Wenn man so will, ja.«
»Welches?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Was soll das?« Wenn er etwas hasste, waren es Andeutungen.
»Wer hat was angestellt?«
»Vielleicht wird es ja noch ein Mädchen. Wie du es dir immer gewünscht hast.«
Marie stand auf, legte die Serviette auf der weißen Tischdecke ab und ging lachend auf ihn zu. Er blieb sitzen, öffnete die Arme. Sie setzte sich auf seinen Schoß und sah ihm in die Augen. Sanft streichelte er ihren Bauch.
»Es ist ein Mädchen«, flüsterte er, »ich spür’s.«