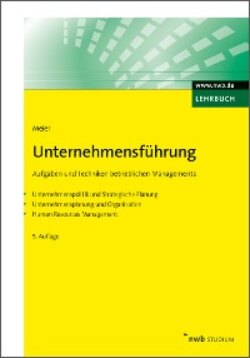Читать книгу Unternehmensführung - Harald Meier - Страница 10
1.1.3.5 Shareholder Value- und Stakeholder-orientierte Unternehmenspolitik
ОглавлениеTraditionelle Unternehmensbetrachtungen konzentrieren sich auf das Innenleben der Unternehmen, z. B. die optimale Kombination der Produktionsfaktoren zur Gewinnmaximierung (vgl. faktortheoretischer Ansatz, Kap. 1.1.1). Entsprechend werden auch die konstitutiven Bedingungen (z. B. Unternehmensstandort, -rechtsform) optimierend betrachtet ohne ihre gesellschaftliche Relevanz. In den letzten Jahren wird i. d. R. in der Diskussion einer gesellschaftsrelevanten Unternehmensführung immer mehr zwischen zwei Polaritäten der Unternehmenspolitik unterschieden:
| Shareholder-Value-Ansatz, |
| Stakeholder-orientierte Unternehmenspolitik. |
Während der Shareholder-Value-Ansatz als Stabilisierungspolitik die Interessen der Shareholder (Eigenkapitalgeber) sowie teilweise von Fremdkapitalgebern (abhängig von der Form und Fristigkeit des Fremdkapitals) in den Vordergrund des Unternehmensinteresses stellt und sich auf die Bestands- und Überlebenssicherung des Unternehmens konzentriert, zielt der Stakeholder-Ansatz als Entwicklungspolitik vornehmlich auf die Interessen aller Stakeholder des Unternehmens (z. B. Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Kapitalgeber) ganzheitlich bzw. je nach Stakeholder-politischer Ausrichtung auf eine langfristige Unternehmensentwicklung.
In der Realität bewegen sich Unternehmen als Folge der für das Unternehmen relevanten Situationsfaktoren und unternehmenspolitischen Entscheidungen oft zwischen beiden Polaritäten. Diese können zeitweise schwerpunktmäßig verfolgt werden oder in großen Unternehmen in verschiedenen Unternehmensbereichen unterschiedlich gewichtet sein.
Shareholder-Value-Ansatz (Stabilisierungspolitik)
Es ist allgemein üblich, Unternehmenserfolge durch Vergleiche mit der Vorperiode oder einem Planbudget zu ermitteln. Wie hoch das investierte bzw. eingesetzte Kapital effektiv verzinst ist, kommt dabei i. d. R. nicht zum Ausdruck. Für die Eigenkapitalgeber oder Eigentümer des Unternehmens steht aber oft die tatsächliche Vermögens- und Ertragssituation im Vordergrund des Interesses. Der Shareholder Value (nach A. Rappaport) bezeichnet den Anteil des Eigenkapitals am Wert des Unternehmens (vereinfacht ausgedrückt ist der Shareholder Value der Unternehmenswert - Fremdkapital). Ziel ist die Steigerung des Unternehmenswerts und damit des Eigenkapitals. Dargestellt wird dies meist durch den Cashflow als Discounted Cashflow (DCF) oder durch Kennzahlen wie Economic Value Added (EVA) und Cashflow Return on Investment (CFROI).9)
Merkmale des Shareholder-Value-Ansatzes
| Ziel ist vornehmlich die Bestands- und Überlebenssicherung des Unternehmens. |
| Interessen der Eigenkapitalgeber (Shareholder) sowie teilweise der Fremdkapitalgeber (abhängig von Form und Fristigkeit des Fremdkapitals) stehen im Vordergrund. |
| Man zielt auf eine möglichst kurzfristige Unternehmenswertsteigerung bzw. kurzfristige Gewinnmaximierung und -abschöpfung. |
| Entsprechend sollen bestehende Erfolgspotenziale des Unternehmens gehalten, abgeschöpft oder ausgebaut werden. |
| Dies erfordert als Situationsfaktoren z. B. relativ stabile Märkte bzw. Umwelt, überschaubare Erfolgsfaktoren sowie eine starke Macht der Eigenkapitalgeber im Unternehmen. |
| Die Shareholder Value-orientierte Unternehmenspolitik wird entsprechend auch oft als stabilitätsorientierte oder konservative Unternehmenspolitik bezeichnet. |
Stakeholder-Orientierung (Entwicklungspolitik)
Die traditionell eindimensionale Betrachtung unternehmerischer Zielsetzungen, i. d. R. der Eigenkapitalrentabilität, wird immer mehr in Frage gestellt. In den meisten Unternehmen spielt der Fremdkapitalanteil eine dominierende Rolle bei der Unternehmensfinanzierung (z. B. Kredite als angespartes gesellschaftliches Vermögen). Auch gibt es in den meisten Unternehmen eine Trennung zwischen Eigentum und Verfügungsgewalt (Anteilseigner und Management). Dazu existieren viele rechtsstaatliche Ansprüche gesellschaftlich relevanter Einzel- oder Gruppeninteressen (z. B. Mitarbeiterinteressen durch Mitbestimmung, Interessenverbände und Behörden) und gesellschaftlich anerkannte moralische Ansprüche.
Merkmale der Stakeholder-Politik
| Ziel ist in erster Linie eine langfristige Unternehmensentwicklung, wobei zus. zu den Interessen der Kapitalgeber gleichwertig die Interessen der Betroffenen im Unternehmens sowie von außen (z. B. Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) in den Fokus der Unternehmensführung rücken. |
| Unternehmenspolitik zielt so besonders auf die Suche und Schaffung von neuen unternehmerischen Erfolgspotenzialen, wofür als fördernde Situationsfaktoren dynamische und komplexe Märkte und Umwelten gelten, z. B. bzgl. Nachfrage, Werten, Technik, Politik. |
| Entsprechend wird dieser Ansatz auch oft als entwicklungsorientierte oder progressive Unternehmenspolitik bezeichnet. |
Kritik am einseitig orientierten Shareholder-Value-Ansatz
Wenn auch in den 1990er Jahren der Shareholder-Value-Ansatz für viele Unternehmen das Maß aller Dinge erfolgreicher Unternehmensführung war, indem sich Unternehmenserfolg am steigenden Wert der börsennotierten Aktien ablesen ließ, ist zu bedenken, dass sich Unternehmenswerte nicht nur auf Aktienindizes beschränken. Außerdem sind Kursschwankungen nicht allein Ergebnis mehr oder weniger erfolgreicher Unternehmensführung. So wird die Börse erfahrungsgemäß nach einem mehrjährigen Boom auch wieder stagnieren. Würde der Shareholder Value ein ideales Steuerungsinstrument der Unternehmensführung, setzt das voraus, dass er eine definierte Zielgröße oder Instrumentarium ist. Die Funktion und die Interessen der Shareholder sind aber in den Unternehmen sehr unterschiedlich. Die Kapitalgeber haben u. a. eine Finanzierungsfunktion für das Unternehmen, womit sie auch eine Risikofunktion übernehmen und indirekt auch eine betriebliche Leistungsfunktion. Das Interesse der Kapitalgeber ist nach Art und Anzahl der Interessen am Unternehmen aber sehr unterschiedlich. Auch sind von den ca. 1,8 Mio. Unternehmen in Deutschland nur ca. ein Sechstel Kapitalgesellschaften, und davon ist nur ein Bruchteil börsennotiert. Deshalb stellt sich auch die Frage, was der Shareholder Value sein muss. Ist es der notierte Börsenkurs (seine Differenz oder Entwicklung), die erwirtschaftete Rendite (Gewinn oder Dividende) oder der Cashflow? Zusammenfassend kann man feststellen, dass auch die Entwicklung der unterschiedlichen Shareholder-Interessen sehr dynamisch und vielfältig ist, dass die relativ kurzfristige Betrachtung eines Shareholder Value der strategischen Unternehmensführung widerspricht und die Interessen (und damit die Macht) der Stakeholder immer mehr zunehmen.
Beispiel: Eine Kritik an diesem Prinzip formulierte schon H. Ford, einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Unternehmer im 20. Jh. (s. a. Kap. 7.1: Der Fordismus): Wie heißt der Leitgedanke der Industrie … der wahre Leitgedanke heißt nicht Geldverdienen. Der industrielle Leitgedanke erfordert Schaffung einer nützlichen Idee und deren Vervielfältigung ins Abertausendfache, bis sie allen zugute kommt … Produzieren und wieder produzieren; ein System ersinnen, aufgrund dessen das Produzieren zu einer hohen Kunst wird; die Produktion auf eine Basis stellen, die ein ungehemmtes Wachstum und den Bau immer zahlreicherer Werkstätten, die Hervorbringung immer zahlreicherer nützlicher Dinge ermöglicht – das ist der wahre industrielle Leitgedanke. Aus der Spekulation anstatt aus der Arbeit Gewinn schlagen, bedeutet jedoch die direkte Verneinung des industriellen Gedankens … Hier möchte ich gleich bemerken, dass ich es nicht für richtig halte, übermäßige Gewinne aus unseren Wagen zu erzielen. Ein mäßiger Gewinn ist berechtigt, ein allzu hoher nicht. Dabei ist es auch von jeher mein Prinzip gewesen, die Preise der Wagen so rasch herabzusetzen, als die Produktion es irgend erstattete, und den Vorteil davon den Verbrauchern und den Arbeitern zukommen zu lassen … Eine solche Politik harmonisiert allerdings nicht mit der allgemeinen Ansicht, dass ein Geschäft so geleitet werden müsste, dass die Aktionäre eine möglichst große Summe Bargeld aus ihm herausziehen können. Ich kann daher Aktionäre im üblichen Sinne des Wortes nicht brauchen – sie helfen nicht, die Gelegenheit zur Dienstleistung zu vermehren. Mein Ehrgeiz geht vielmehr darauf aus, immer mehr Arbeiter zu beschäftigen, und, so weit es in meiner Macht steht, die Wohltaten des industriellen Systems, dass wir zu begründen versuchen, immer weiteren Kreisen zugute kommen zu lassen. Wir wollen helfen, Existenzen und Häuser aufzubauen. Dazu ist es nötig, dass der größere Teil des Gewinnes wieder in ein produktives Unternehmen zurückfließt. Daher ist bei uns kein Platz für nicht mitarbeitende Aktionäre.10)
Und der langjährige Daimler-Benz Vorstand und spätere Vorstandsvorsitzende E. Reuter formulierte: In Wirklichkeit kann der Wert eines Unternehmens eben nicht mit der Latte der Aktienkurse gemessen werden … diskutieren deswegen längst über Bewertungskriterien, die sich nicht an den kurzfristigen Zufälligkeiten von Börsenspekulationen, sondern an der längerfristigen Entwicklung eines Unternehmens ausrichten und damit auch die Berücksichtigung von strategischen Entscheidungen ermöglichen, die nach der Natur der Sache Vorleistungen für eine erfolgreiche Verbesserung der Wettbewerbssituation ermöglichen.11)
Noch deutlicher drückt es der bekannte deutschsprachige Managementforscher F. Malik aus: Die Mehrheit des deutschen Top-Managements und seiner Consulting-Entourage orientiert sich seit Jahren unkritisch an amerikanischen Managementpraktiken. Statt selbst darüber nachzudenken, was richtiges Management ist, wird jede Mode imitiert … Die Doktrin des Shareholder Values ist als Theorie der Unternehmensführung eine der schädlichsten Irrlehren, die je entwickelt wurden … dass die Anwendung dieser Theorie zum Gegenteil dessen führte, was sie versprochen hat: Zu einer Orgie von Bilanzschönung und Bilanzfälschung, Desinformation des Publikums, Wertevernichtung und Bereicherungsexzessen – systemimmanent und nicht etwa als vereinzelte Pannen. Und weiter: Zweck des Unternehmens ist die Transformation von Ressourcen in Nutzen für den Kunden … als einzig richtiger Unternehmenszweck, womit er den gängigen Theorien der Unternehmensgewinnmaximierung oder -wertsteigerung direkt widerspricht.12) Für ihn gilt Kundennutzen statt Shareholder Value und Konkurrenzfähigkeit statt Wertsteigerung. Damit ist der Gewinn nicht das Unternehmensziel sondern nur ein (zwangsläufiges) Ergebnis) eines richtigen Zwecks.13)
Entsprechend dieser inzwischen weit verbreiteten Kritik wird der Shareholder Value-orientierte Ansatz in den letzten Jahren immer öfter als langfristige Orientierung dargestellt, die auch Stakeholder-Interessen einbeziehen sollte.