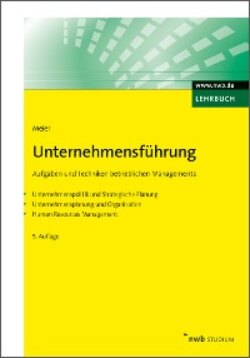Читать книгу Unternehmensführung - Harald Meier - Страница 8
1.1.3.3 Unternehmenspolitik
ОглавлениеDer Begriff Politik hat eine breite gesellschaftliche Bedeutung – vom bewussten Durchsetzen eines Willens (engl. politics) bis zum geschickten Agieren und Reagieren auf Herausforderungen (engl. policy making). Im Unternehmen bewegt sich die Unternehmenspolitik damit in den Dimensionen der willentlichen Gestaltung der Unternehmensziele und der Anpassung an interne und externe Rahmenbedingungen bzw. Einflüsse. Unternehmenspolitik beinhaltet somit eine umfassende langfristige Zielplanung für das Unternehmen und die Art und Weise, wie in Situationen relevanter Einflüsse hierauf reagiert wird. Unternehmenspolitik ist damit ein der Unternehmensplanung vorgelagerter Prozess, der dann in der nachgelagerten Planung operationalisiert und in Teilpläne gegliedert wird (z. B. Entwicklungs-, Produktions-, Finanz-, Personal-, Absatzplanung).
Einflüsse auf die Unternehmenspolitik
Die Vielfältigkeit der Einflüsse auf die Unternehmenspolitik kommt schon durch die vielfältigen und teilweise auch unterschiedlichen internen und externen Anspruchsgruppen zum Ausdruck. Sie entstehen sachlich z. B. aus der Unternehmenstätigkeit bzw. -kultur und der Unternehmensentwicklung (z. B. Unternehmenshistorie, Standort, Kommunikationskultur mit dem Betriebsrat, Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterqualifikation) und aus der Unternehmensumwelt, wie z. B. Märkte (Kapital-, Arbeitsmarkt …), Systeme (Rechts-, Steuer-, politisches System …) und gesellschaftliche Trends (Technologie, Wertewandel, Demografie …). Die Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seiner Umwelt sind unmittelbar durch die Marktaktivitäten des Unternehmens begründet und mittelbar durch die Unternehmensumwelt.
Ansprüche interner und externer Interessengruppen an Unternehmen
| Management (Arbeitszufriedenheit, hohes Einkommen, Selbstentfaltung, soziales Prestige, Einfluss und Macht, Bildungsmöglichkeiten, Karriere …), |
| Mitarbeiter (Arbeitszufriedenheit durch hohes Einkommen, soziale Sicherheit, Selbstentfaltung, gesunde Arbeitsbedingungen, Bildungs- und Karrieremöglichkeiten, soziale Kontakte …), |
| Belegschaftsgruppen (gruppenspezifische Ziele, z. B. der leitenden Angestellten, Jugendlichen, Frauen), |
| Eigenkapitalgeber (hohe Eigenkapitalrentabilität und Gewinnausschüttung, Vermögenssicherung/-zuwachs, Einfluss auf Unternehmensentwicklung …), |
| Fremdkapitalgeber (Sicherheit der Kredittilgung und Zinszahlungen), |
| Kunden (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Liefersicherheit, Nebenleistungen, Service, Beratung, Kundenkredite …), |
| Lieferanten (Zahlungsfähigkeit, anhaltende Liefermöglichkeit, günstige Konditionen …), |
| Konkurrenten (fairer Wettbewerb, Förderung des allgemeinen Branchenimage, Zusammenarbeit …), |
| öffentliche Hand (Staat, Land, Kommune: Abgaben und Steuern, Arbeitsplatzsicherung, Umweltschonung, Einhaltung von Gesetzen, regionale gesellschaftliche Interessen, Unterstützung der Wirtschaftspolitik …), |
| Tarifpartner (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften: Einhaltung und Mitgestaltung der Tarifverträge, Verhandlungsfairness …). |
| Weitere Interessengruppen sind u. a. Parteien, Kirchen, Kartellpartner, Verbände, die aus ihrer jeweiligen wertorientierten Sicht Ansprüche an Unternehmen formulieren (z. B. Einhaltung der Verbandstandards und Verträge, Engagement …). |
Einflussvariablen aus der Unternehmensumwelt
| Aufgabenumwelt (Märkte, Lieferanten/Kunden, Kapitalgeber …), |
| ökonomische Umwelt (gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen, Branchenentwicklung, Arbeitsmarkt, Finanzmärkte …), |
| rechtliche Umwelt (Steuer-, Umwelt-, Verbraucher-, Patentrecht, Unternehmensverfassung …), |
| gesellschaftliche Umwelt (Wertvorstellungen, Bildungssystem und -niveau, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung, Einkommensverteilung …), |
| technische Umwelt (Innovationsentwicklung, Entwicklung der Informations- und Kommunikationssysteme …), |
| politische Umwelt (politische Willensbildung und Stabilität, Organisation des Gesellschaftssystems, Entwicklung des Politiksystems …), |
| ökologische Umwelt (Entwicklungen an den Rohstoffmärkten, ökologisches Gleichgewicht …). |
Beispiel: Unternehmensführungsrelevante Entwicklungen (Robert Bosch)6)
Umweltentwicklungen
| Überraschend schnelle Erholung der Weltwirtschaft: Zuwachs der weltweiten Wirtschaftsleistung um 4 %, |
| grundsätzlich positive Aussichten trotz vorhandener Risiken, |
| Schwellenländer in Asien und Südamerika dienten als Wachstumstreiber; in den USA blieb der Zuwachs hinter den Erwartungen zurück, |
| Erholung des Kfz-Markts, insb. bei Kleinfahrzeugen, |
| verzögerte Verbesserung der Lage der spätzyklischen Investitionsgüterindustrie, |
| sich abzeichnender Klimawandel und Verknappung fossiler Energieressourcen, |
| demografischer Wandel hin zu einer immer älteren Gesellschaft, |
| wachsende Bedeutung von Dienstleistungen, Software und kundenspezifischen Gesamtlösungen, |
| Sparmaßnahmen zur Haushaltssanierung in europäischen Ländern. |
Unternehmensentwicklungen
| Kräftige Erholung der Bosch-Gruppe, Umsatz übertraf das Vorkrisenniveau von 2007, |
| besonders starkes Wachstum in den Unternehmensbereichen Kfz-Technik und Industrietechnik, |
| weiterer Ausbau der Präsenz in den Schwellenländern Asiens, |
| starker Anstieg des Umsatzes der Bosch-Gruppe in der Region Asien-Pazifik sowie in Südamerika, |
| umfangreiche Sparmaßnahmen und Halten der Kernbelegschaft, |
| Ausbau der Präsens auch in Südamerika, Mittel- und Osteuropa, aber auch Afrika/naher Osten, |
| fokussierte Diversifizierung verbunden mit einer hohen Innovationskraft, |
| Ausbau der Geschäftsfelder regenerative Energien und Telemedizin, |
| Bündelung der Internetexpertise in der Bosch Software Innovations GmbH. |