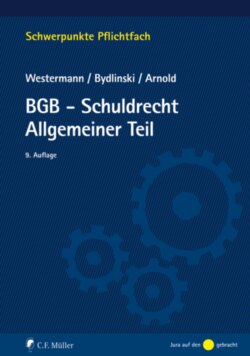Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Verhältnis zu anderen Generalklauseln
Оглавление30
§ 242 ist in der Rechtsanwendung oft schwer von der ergänzenden Vertragsauslegung (§§ 133, 157) abzugrenzen. Die Funktion der ergänzenden Vertragsauslegung ist es, vertragliche Lücken zu schließen. Die hM verortet sie bei § 157.[62] Maßgeblich ist dabei nach einer vom BGH in stRspr verwendeten Formel, welche Regelung die Parteien bei sachgerechter Abwägung der beiderseitigen Interessen nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte als redliche Vertragspartner getroffen hätten, wenn sie den von ihnen nicht geregelten Fall bedacht hätten.[63] Maßstab der Korrektur soll der sog „hypothetische Parteiwille“ bei Vertragsschluss sein. Das lässt sich am ehesten als Topos für objektiv gebotene gerechte Ergänzungen verstehen.[64] Denn auch die ergänzende Vertragsauslegung ist ein Akt richterlicher Rechtsschöpfung: Was die Parteien wirklich gewollt hätten, wissen wir nicht.[65] Deshalb sind auch für die Lückenschließung durch ergänzende Vertragsauslegung letztlich dieselben materiellen Gerechtigkeitskriterien wie bei § 242 maßgeblich.[66]
31
§ 242 steht auch in einer gewissen Nähe zu § 138.[67] In ihrer Rechtsfolge ordnen die §§ 134, 138 die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts an, während § 242 in den Rechtsfolgen flexibler ist. Grundsätzlich lässt § 242 die Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts unberührt. Teilweise wirken § 138 und § 242 auch zusammen, um einen Lebenskomplex angemessen zu regulieren. Ein Beispiel bieten Eheverträge, in denen beide Normen in einem Ergänzungsverhältnis stehen: Wenn Eheverträge schon im Zeitpunkt ihres Zustandekommens zu einer einseitigen Lastenverteilung führen, können sie gem. § 138 nichtig sein. § 242 ermöglicht dagegen eine Ausübungskontrolle, wenn sich die einseitige Lastenverteilung erst aus späteren Entwicklungen ergibt.[68] Das Beispiel zeigt, dass § 242 gerade auch dann eingreifen kann, wenn ein Rechtsgeschäft nicht schon wegen Sittenverstoßes nichtig ist.
32
Auch § 226 (Schikaneverbot) und § 826 (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) sind mit dem Prinzip von Treu und Glauben verwandt. § 226 wird indes tatbestandlich eng interpretiert und greift nur ein, wenn der einzige Zweck des Handelns in der Schadenszufügung liegt. Die Norm ist deshalb in der Praxis wesentlich weniger bedeutsam als § 242. § 826 setzt im Gegensatz zu § 242 keine rechtliche Sonderverbindung voraus. Die Norm führt zu einem Schadensersatzanspruch, und zwar – anders als § 823 – auch bei reinen Vermögensschäden ohne Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter. Die Tatbestandsvoraussetzungen sind allerdings eng.[69]