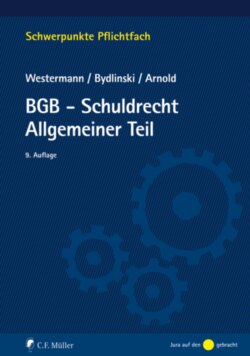Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Grundprinzip
Оглавление49
Schuldverhältnisse verbinden zwei Personen durch aufeinander bezogene und miteinander korrelierende Rechte und Pflichten. Der Witz des Schuldrechts besteht gerade in dieser Fokussierung auf nur zwei Personen, die durch das Schuldverhältnis rechtlich in einer „engeren“ Verbindung stehen als sie es ohne Schuldverhältnis würden. Die wechselseitigen Rechte und Pflichten bestehen deshalb auch grundsätzlich nur in der Relation dieser beiden Personen (Relativität der Schuldverhältnisse). Wer dem Schuldverhältnis nicht angehört, bleibt von diesen Rechten und Pflichten grundsätzlich unberührt: Weder kann er Rechte aus ihm ableiten, noch treffen ihn Pflichten wegen des Schuldverhältnisses anderer. Vertragliche Abmachungen gehen Außenstehende nichts an.[127] Wenn ich ein Auto bei einem Münsteraner Autohändler kaufe, gibt mir dieser Kaufvertrag vertragliche Ansprüche nur gegen den Autohändler. Ich kann meine Rechte aus dem Kaufvertrag nicht dem Hersteller gegenüber geltend machen. Natürlich kann der Hersteller sich in einem eigenen Vertrag mir gegenüber verpflichten; das geschieht in der Praxis häufig (selbständige Garantien). Dazu tritt, unter bestimmten Voraussetzungen, die Produzentenhaftung.[128] Und denkbar sind auch, wie etwa im Diesel-Abgasskandal relevant, deliktische Ansprüche.[129] Auch für diese gilt freilich, wie für gesetzliche Schuldverhältnisse allgemein, die Begrenzung der Rechtsfolgen auf die durch sie gebundenen Parteien.
50
Schuldrechtliche Forderungen sind deshalb auch nicht als absolutes, gegenüber allen wirkendes Recht iSd § 823 Abs. 1 geschützt.[130] Das zeigt sich beispielsweise beim Doppelverkauf:
In Fall 4 scheitert der Anspruch der B auf Übergabe und Übereignung aus § 433 Abs. 1 S. 1 gegen A an § 275 Abs. 1. Sie könnte zwar sekundärrechtliche Ansprüche geltend machen, etwa aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 oder § 284, aber das entspricht nicht ihrem Rechtsziel. Im Verhältnis zu C steht die Relativität der Schuldverhältnisse vertraglichen Ansprüchen entgegen: Der Kaufvertrag zwischen A und B gibt B keine Rechte gegen C. Der Kaufvertrag zwischen A und B geht C nichts an. Auch § 823 Abs. 1 hilft B nicht weiter: Die aus dem Kaufvertrag resultierenden Rechte sind relative Rechte und damit gerade keine absoluten, allen gegenüber geschützten Rechte iSd § 823 Abs. 1. B verbleibt allein § 826, um von C doch noch die Herausgabe des Gemäldes zu erreichen. Die Hürden der Norm sind aber hoch, denn § 826 setzt eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung voraus. Die Norm kann eingreifen, wenn C im Einzelfall A zum Vertragsbruch überredete und ihn von allen Ansprüchen der B freistellte, nur um diese zu schädigen.[131] Davon ist hier nicht auszugehen, weshalb sich B mit Schadens- bzw Aufwendungsersatz begnügen muss.