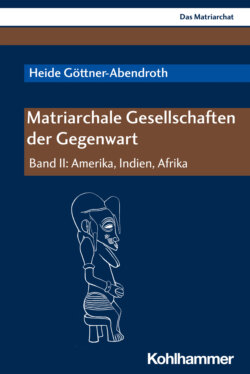Читать книгу Matriarchale Gesellschaften der Gegenwart - Heide Göttner-Abendroth - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Die Kuna, das »Goldene Volk«
ОглавлениеDie zirkumkaribische Zone erstreckt sich über die Antillen-Inseln und entlang der Nordküste Südamerikas, die dem Karibischen Meer zugewandt ist: Kolumbien, Venezuela, Guayana. Sie umfasst auch die Landengen Mittelamerikas: Panama, Costa Rica, Nicaragua, schließt ebenso die Halbinsel Yucatán ein und reicht über die Landenge von Tehuantepec bis nach Mexiko hinauf (Karte 3). Dieses gesamte Gebiet besaß eine dichte indigene Bevölkerung und große Bevölkerungszentren. Die einzelnen Kulturgruppen hatten sich zwar auf verschiedene Weise an die sehr unterschiedliche natürliche Umgebung angepasst, sie zeigten aber viele gemeinsame Züge, die in den frühen geschichtlichen Phasen der Anden-Kultur vorhanden waren. Es muss also kontinuierliche Auswanderung vom Andengebiet über Nordkolumbien nach ganz Mittelamerika hinein stattgefunden haben, wobei die Wanderungsbewegung auch hier von Süd nach Nord ging. Diese frühen Kulturen erstreckten sich einst von den Anden über das Maya-Gebiet bis nach Mexiko.1
Die Träger dieser zirkumkaribischen Kultur waren die Stämme der Arawak, deren matriarchale Sozialordnung und Kultur weiteste Verbreitung fanden und auch in der gesamten Zone rings um die Karibik prägend gewesen sind.2 Ecuador und Kolumbien waren das Ausstrahlungsgebiet ihrer Lebensform, deren Kulturmuster große Teile Südamerikas umfassten und auch in Mittelamerika die Grundlage für spätere Entwicklungen bildeten. Auch in Mittelamerika waren die Dörfer oder kleine Dorfverbände die politische Einheit, die sich um religiöse Zentren bildeten und als autonome Dorf-Republiken funktionierten. Die effiziente Ökonomie beruhte auf Ackerbau, besonders mit einer sehr alten Maissorte; er wurde je nach den Bedingungen ohne oder mit Terrassenbau und Bewässerungssystemen ausgeführt, zu denen Dämme, Kanäle und Aquädukte gehörten. Heilige Hügel, steinerne Altäre und Zeremonialplätze, die sogenannten »Ballplätze«, sowie steinerne Ahnenfiguren waren überall in der Region bekannt.3
Karte 3: Mittel- und Nordamerika. Einwanderungen von Süden und von Norden
Doch auch in Mittelamerika drängten – wie schon in Südamerika – zahlreiche Karibenstämme nach, nach denen die zirkumkaribische Zone den Namen »Karibik« erhielt. Sie vermischten sich teilweise mit den Arawak und nahmen Aspekte von deren Kultur an. Diese Situation wurde wiederum überlagert von den frühen Formen der Chibcha-Gesellschaft, die eine Verbindung aus Arawak, Kariben und anderen Stämmen war. Während ihr kulturelles Zentrum in Kolumbien sich allmählich patriarchalisierte, behielten ihre Außenbezirke, die weit nach Mittelamerika hineinreichten, die ältere, matriarchale Sozialform bei. Aber mit der Invasion der Europäer und den damit verbundenen Zerstörungen der indigenen Kulturen wurde diese Situation nachhaltig verändert. Dennoch sind einige weit voneinander getrennte indigene Volksgruppen bestehen geblieben, die ihr uraltes, matriarchales Erbe noch heute bewahren.4
Am nächsten benachbart zu den alten Kulturzentren Kolumbiens lebt das Volk der Kuna. Sie gelten als Nachkommen der Chibcha und sprechen noch heute die Chibcha-Sprache; früher besaßen sie eine viel höhere Kultur, bevor sie unter den Druck vonseiten der europäischen Eroberer gerieten.5 Durch ihren erbitterten Widerstand und die Unzugänglichkeit ihres Gebietes gelang es ihnen, autonom zu bleiben und wenigstens die Grundzüge ihrer Kultur zu retten. Sie bewohnten früher das ganze Gebiet der Landenge von Darien, das von Kolumbien bis zum Isthmus von Panama (heute Kanalzone) reicht. Diese Gegend ist durch Sümpfe, Urwälder und Moskitos so unwirtlich, dass sogar der »Pan-American Highway«, die große Straße von Alaska bis Feuerland, hier unterbrochen ist. Damit ist diese Region auf der ganzen Länge völlig straßenlos.6
Die Kuna konnten hier, verborgen im Urwald und an versteckten Flussläufen, lange ihre kulturellen Traditionen fortführen. Sie bewegten sich mit ihren Einbaumkanus auf den Flüssen im Inland von den Darien-Bergen bis zur Küstengegend von Panama. Doch zuletzt mussten sie das Festland verlassen; sie flohen vor den Spaniern auf die San Blas-Inseln vor der atlantischen Küste des Isthmus von Darien (siehe Karte 3). Eine Malaria-Epidemie, die ihre Dörfer auf dem Festland dezimiert hatte, soll ebenfalls zu ihrer Flucht auf die Inseln beigetragen haben. Sie besiedelten diese flachen Koralleninseln, wo beständig eine frische Brise weht und schlanke Kokospalmen wachsen. Wegen des Seewinds und der Vegetationsarmut ist das Klima auf den Inseln viel besser und bietet Schutz vor Mücken. Heute bewohnen die San Blas-Kuna fünfzig der 400 Inseln, die sich zwischen dem Golf von San Blas und dem Kap Tiburón wie Perlen an einer Kette in Sichtweite der Küste hinziehen, vor dem offenen Meer durch ein großes Barriere-Riff geschützt.
Einige Tausend von ihnen sind im Innern der Landenge geblieben, wo sie als Hochland-Kuna in freiwilliger Isolation leben. Andere siedeln entlang der Küste, die Küsten-Kuna, wo sie von den San Blas-Kuna täglich besucht werden. Die Frauen fahren mit ihren Kanus zu den Küstendörfern in Sichtweite um frisches Wasser zu holen, und die Männer kommen in ihren Booten wegen Holz und anderer notwendiger Dinge, die man auf den trockenen Koralleninseln nicht findet. Dabei meistern die Frauen die Kunst des Navigierens mit den starken Mahagoni-Einbaumbooten genauso glänzend wie die Männer.7
Auf der ganzen Länge des Isthmus von Darien, dessen Territorium zum größeren Teil zum Staat Panama, zum kleineren Teil zu Kolumbien gehört, variiert die Anzahl der Kuna (nach verschiedenen Quellen) zwischen 30.000 Einheimischen im Jahr 1993 und 60.000 im Jahr 2006. Ihr Volk ist eins der größten in Mittelamerika, das seine indigene Kultur bewahren konnte. Sie nennen ihr Land »Kuna Yala«, das sie 1925 der Regierung von Panama mithilfe der USA abgetrotzt haben. Kuna Yala ist politisch unabhängig und sie hüten es so streng, dass niemand, der sie besucht, über Nacht dort verweilen darf. Ihre gegenwärtige Politik ist sehr geschickt, so dass sie ihre eigene Kultur beibehielten und zugleich von den Panama-Offiziellen, den christlichen Missionaren und sogar den Ethnologen als »modernisiert« betrachtet werden. Auch diese Bezeichnung halten die Kuna für das Resultat ihrer erfolgreichen Diplomatie und sind, zu Recht, stolz auf ihren gleichermaßen kreativen wie konservativen Umgang mit modernen Zeiten.8
Dennoch haben sich viele von ihnen heute kulturell angepasst, insbesondere wegen der missionarischen Aktivität der katholischen Kirche, dem städtischen Lebensstil in Panama City und der Zunahme des Tourismus.9 Aber der Fokus meiner Analyse liegt hier auf ihrer traditionellen Kultur, die Jahrtausende lang praktiziert wurde und die heute noch in den Walddörfern auf dem Festland und auf vielen Inseln lebendig ist.
Sie selbst nennen sich Olodule, das »Goldene Volk«, und manches in ihrem Erscheinungsbild bestätigt diesen Namen. Sie sind kleine, doch kräftige Menschen mit bronzener Hautfarbe und dichtem, schwarzen Haar. Unter ihnen gibt es viele Albinos, die sie »Mondkinder« nennen und denen sie besondere spirituelle Fähigkeiten zuschreiben.10 Bevor christliche Missionsschulen bei ihnen errichtet wurden, trugen die Männer nichts bis auf eine goldene Penishülle und Federschmuck, heute gehen sie in den billigsten Kleidungsstücken der westlichen Zivilisation. Die Frauen hingegen sind gut gekleidet. Früher gingen sie bis auf einen langen Wickelrock auch nackt, doch sie waren vom Kopf bis zu den Hüften mit kunstvoller Körperbemalung geschmückt, deren phantastische Formenvielfalt sie selbst entwickelten und auftrugen. Zugleich stellten sie das Gold der Familie zur Schau, das in runden, schweren Scheiben am Ohr und um den Hals hing, ergänzt durch goldene Brustplatten und einen feinen Nasenring. Obwohl die Missionare darauf bestanden, dass die Kuna-Frauen sich bedeckten, sind sie ihrem traditionellen Stil treu geblieben. Als begabte Malerinnen übertrugen sie nun die Formen der Körpermalerei auf Baumwollblusen, und noch später begannen sie, ihre Kunst als Stickerei auszuüben. Diese Stickereien sind noch immer so formenreich und phantasievoll, dass die Blusen, »Molas« genannt, ihre gesamte mythische Kosmologie abbilden, einschließlich moderner Eindrücke wie amerikanische Werbespots im Fernsehen. Die Molas waren daher zuerst bei Ethnologen und sind heute bei Touristen begehrte Sammelobjekte, und die Kuna-Frauen verkaufen sie als Teil ihrer selbständigen Ökonomie gegen gute Dollars.11 Auch ihren Goldschmuck behielten sie größtenteils, denn er repräsentiert den Reichtum und damit die Ehre der Sippe (Abb. 6). Silbermünzenschmuck ergänzt ihn heute, und an Armen und Beinen ist der Goldschmuck durch Glasperlenschnüre ersetzt worden. Mädchen werden schon von Geburt an geschmückt: Sie sind erwünschter als männliche Kinder und werden bereits beim ersten Bad mit einem Goldschmuck der Sippe geehrt.12 In ihrer traditionellen Tracht mit Hüftrock, Kopftuch, Mola und schön gearbeitetem Goldschmuck ist jede Kuna-Frau noch heute ein bemerkenswerter Anblick.
Die Ökonomie der Kuna-Frauen beschränkt sich nicht auf den Verkauf von Molas. Den Frauen gehört auch das Sippenhaus, dessen Rahmen aus kräftigem Holz vom Festland gebaut ist, das Werk der Männer, während die Wände aus Bambus-Matten und das Dach aus geflochtenen Palmblättern bestehen, das Werk der Frauen. Innen befinden sich Hängematten, hölzerne Sitzschemel und früher die waagerechten Webstühle vom Arawak-Typus.13 Ebenso gehört den Frauen das unverkäufliche Land mit allem, was darauf wächst, vor allem die Kokospalmen. Die Männer ernten die Kokosnüsse und händigen sie den Frauen aus, die sie an Handelsboote der Weißen verkaufen; fast der ganze Reichtum der Sippe stammt von den Kokospalmen. Fischfang ergänzt wesentlich den geringen tropischen Ackerbau, den die Männer auf den Feldern ausüben; mit Mais, Maniok, Yams, Zuckerrohr, Tabak, Pfeffer, Kakao, Kaffee und Bananen dient er lediglich der Selbstversorgung. Zusätzlich sammeln die Männer, die in den Festlanddörfern wohnen, eine Vielzahl an Früchten, die der Regenwald zu bieten hat, und gehen gelegentlich auf die Jagd. So sind es die Männer, welche die rohe Nahrung besorgen, doch sie überreichen sie den Frauen, geben alles in die Hände der Clanmutter, der Matriarchin. Diese gibt die Lebensmittel an die Frauen weiter, die dann die Mahlzeiten zubereiten und verteilen; daher gelten die Frauen als die Ernährerinnen. Die Clanmutter überblickt, was benötigt wird, und weist die Männer für die Feldarbeit an, ebenfalls teilt sie den Frauen die anfallenden Pflichten in der Hauswirtschaft zu (Abb. 7).14 Zusätzlich arbeiten die Männer als Tagelöhner in der Kanalzone, und das Geld, das sie dort verdienen, wird in Goldschmuck angelegt, den die Frauen zu ihrer Ehre und zur Ehre der Sippe an Festtagen noch immer öffentlich vorführen.
Abb. 6: Junge Kuna-Frau mit Goldschmuck und bestickter Bluse (aus: Parker/Neal: Molas. Folk Art of the Kuna Indians, New York 1977, Barre Publications, Umschlag-Rückseite)
In einem Sippenhaus der Kuna wohnen alle in weiblicher Linie blutsverwandten Frauen zusammen: die Matriarchin, ihre Schwestern und Töchter und die Kinder der Töchter. Obwohl dicht gedrängt leben sie in Harmonie miteinander, und eine Frau hat immer Schutz im Haus der Mutter. Die Verwandtschaft ist also matrilinear, und die Frauen bleiben matrilokal im Mutterhaus wohnen, während ihre Brüder und Söhne ins Haus der Schwiegermütter ziehen. Daher sind der Gatte der Matriarchin und ihre Schwiegersöhne auch ein Teil der Wohngemeinschaft. Das Wort für »Gatte« ist »Sui«, das einen Mann als »Sammler der Nahrung« bezeichnet, denn das ist die Aufgabe eines Mannes, wenn er heiratet. Wenn ein »Sammler der Nahrung« nicht in Übereinstimmung mit den Wünschen seiner Gattin handelt, wird er ins Haus seiner Mutter zurückgeschickt.15
Durch den Einfluss der christlichen Missionare ist die Paar-Ehe und die bilaterale Verwandtschaft (Verwandtschaft nach beiden Linien) eingeführt worden. So kennen die Kinder heute auch ihren biologischen Vater, aber die männliche Linie ist unbedeutend. Eine Paar-Ehe kann jederzeit ohne Probleme von beiden Seiten aufgelöst und eine andere eingegangen werden. Nur beim Schwiegervater, dem Gatten der Matriarchin, gilt Dauerhaftigkeit in der Ehe und strenge Befolgung der Regeln, denn er arbeitet direkt mit den Schwiegersöhnen zusammen. Tyrannische Tendenzen können bei ihm aber kaum aufkommen, denn er wird von den Vätern der jungen Männer scharf beobachtet und notfalls öffentlich kritisiert, denn diese leben im selben Dorf. Es wird stets im selben Dorf geheiratet, denn die Kuna folgen dem üblichen Muster der Clan-Exogamie, verbunden mit Dorf-Endogamie, das heißt, Heirat außerhalb des Clans, aber innerhalb des Dorfes. Dies ist ein Hinweis, dass es einmal Sippen-Wechselheirat zwischen je zwei bestimmten Clans im Dorf gegeben haben mag. Der Gatte der Matriarchin hat nach außen eine Vermittlerrolle inne als Delegierter der Sippe im Dorfrat und gegenüber der Außenwelt – weshalb etliche Ethnologen ihn für den »Haushaltsvorstand« hielten. Tatsächlich liegt alle ökonomische und soziale Macht bei der Matriarchin, die sie als Verantwortung für das Wohl des ganzen Clans versteht und gebraucht.16
Die Männer besprechen im Versammlungshaus des Dorfes die Angelegenheiten der Gemeinschaft, da sie für die Politik verantwortlich sind. Die Themen ihrer Debatten sind das Schicksal ihrer Inseln, die Verbesserung der Infrastruktur, Konfliktlösungen und die Organisation von Festen. Diese Versammlungen werden von den »Saila«, den Häuptlingen, geleitet, die gewählt und leicht absetzbar sind. Die meisten Häuptlinge sind die Delegierten ihrer Clans und vertreten in der Versammlung die Position ihrer Sippenmitglieder, insbesondere der Frauen, während andere nur zeitweise Häuptlinge sind und als Moderatoren oder Interpreten agieren. Das Verhalten der Häuptlinge wird genauestens beobachtet, und sie müssen über alle ihre Handlungen Rechenschaft ablegen. In den Versammlungen entscheiden sie niemals etwas allein, sondern sie leiten lediglich den Vorgang der kollektiven Entscheidungsfindung. Immer müssen sie ein viel besseres Betragen zeigen als gewöhnliche Leute, zugleich wird von ihnen im Voraus stets das Schlimmste vermutet. Die Kuna verwenden viel Energie darauf, ihre Häuptlinge zu überwachen, und diese Wachsamkeit hat sie davor geschützt, dass jene mit den Kolonialmächten, die ihr Land umgeben, kollaborieren konnten.17
Abb. 7: Porträt einer Kuna-Matriarchin (aus Parker/Neal: Molas. Folk Art of the Kuna Indians, New York 1977, Barre Publications, S. 181)