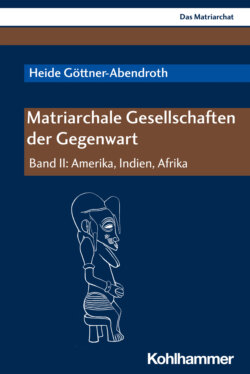Читать книгу Matriarchale Gesellschaften der Gegenwart - Heide Göttner-Abendroth - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Die »starken und schönen« Frauen von Juchitán
ОглавлениеAuch in Mexiko, das sich wiederum nördlich anschließt, sind noch Enklaven der älteren matriarchalen Sozialordnung zu finden. Nicht zufällig haben sie sich an der Westküste, am Pazifik, bis heute erhalten. Dort liegt der Golf von Tehuantepec und die ganze Gegend wird der »Isthmus von Tehuantepec« genannt. Hier verengt sich die mittelamerikanische Landbrücke derart, dass man zuerst plante, den Kanal zwischen Atlantik und Pazifik hier anzulegen, bevor man sich für Panama entschied. Im Gegensatz zum unwegsamen Isthmus von Darien, wo die Kuna wohnen, ist der Isthmus von Tehuantepec schon immer ein stark bereistes Durchgangsgebiet für Völker und Händler aller Art gewesen und heute führt der »Panamerican Highway« hindurch. Entlang der Küste liegen mehrere, indianisch geprägte Städte, unter diesen Juchitán mit etwa 100.000 Einwohnern, und es ist erstaunlich, dass die Juchiteken ihre alten Sozialmuster weitgehend bewahren konnten. So stoßen wir mitten in der modernen Gesellschaft Mexikos diesmal auf ein städtisches Matriarchat (siehe Karte 3).
Die Leute von Juchitán bezeichnen sich heute als »Zapoteken«. Die Zapoteken gehören zu den ältesten Einwohnern Mexikos und besaßen einst ein Reich, welches das ganze Hochtal von Oaxaca umfasste. Ihr religiöses Zentrum war Monte Alban, ein Hochplateau oberhalb von Oaxaca, wo heute noch die Reste von Stufenpyramiden und Palästen zu sehen sind. Hier trotzten sie den patriarchalen Eroberern aus Tenochtitlan, den Azteken-Kaisern, denen es nicht gelang, die Zapoteken zu unterwerfen.37
Die Kultur der Zapoteken ist viel älter als die der Azteken, dennoch hatte sie auch damals schon patriarchale Strukturen entwickelt. So ist der Unterschied zwischen den heutigen Hochland-Zapoteken mit ihren patriarchalen Mustern und den Isthmus-Zapoteken an der Pazifikküste mit ihrer matriarchalen Sozialform, besonders in Juchitán, sehr auffallend. Das weist auf einschneidende historische Unterschiede zwischen beiden Völkern hin und es wirft die Frage auf, ob es sich bei der Bevölkerung des Hochlands und der des Isthmus tatsächlich beide Male um »Zapoteken« handelt. Historische Tatsachen sprechen gegen die Annahme der ethnischen Einheitlichkeit. Denn erst Mitte des 14. Jhs. eroberte ein Zapoteken-Herrscher, vom Hochland herkommend, das Tiefland und machte die Leute tributpflichtig. Ende des 15. Jhs. zog sich das zapotekische Herrscherhaus, gezwungen durch die Eroberungszüge der Azteken aus dem Norden, selbst auf den Isthmus von Tehuantepec zurück und hat seit dieser Zeit die Bevölkerung des Tieflandes »zapotekisiert«. Diese musste nun die zapotekische Sprache und Teile der Herrscherkultur annehmen. Im 16. Jh. überlagerte die spanische Eroberung nochmals dieses kulturelle Gemisch, und ihre christliche Mission, die sie jedem Volk, das sie antrafen, angedeihen ließen, verschlimmerte die Situation.
Die archäologische Forschung in Mexiko zeigt, dass es vor dem 14. Jh. keine kulturellen Beziehungen zwischen den Zapoteken des Hochlandes und den Juchiteken des Tieflandes gegeben hat. Diese Küstenebene am Pazifischen Ozean, an vielen Stellen nur schmal, ist etwas Besonderes: Sie ist eins der reichsten archäologischen Gebiete der Welt. Ihr Klima ist sehr heiß und feucht, aber das Land außerordentlich fruchtbar. Wegen der extremen klimatischen Verhältnisse wurde sie erst spät von den ausländischen Archäologen erforscht; dabei stellte sich, trotz der Verrottung vergänglichen Materials in dem schwülen Klima, eine große Fülle von frühen Kulturen heraus. Dies gilt besonders für die Epoche der Jungsteinzeit (ab 2000 v.u.Z.). Ihre Kulturen sind so reich am Isthmus belegt, dass vielfach angenommen wird, dass die Jungsteinzeit für Mexiko hier begann und in späteren Jahrtausenden allmählich aufs Hochland hinaufstieg. Man nennt in Amerika die Jungsteinzeit »Formative Periode«, sie zeigt dieselben kulturellen Eigenschaften: erster Ackerbau mit Pflanzenzucht, erste Domestikation von Tieren, hervorragende Keramik, eine Fülle einfacher und komplexer Göttinnen-Figurinen. In dieser Küstenebene kommen noch zahllose Erdhügel und Erdplattformen dicht aneinander hinzu, sie waren die Fundamente von großen Langhäusern und Tempeln aus Holz.38 Diese Epoche war außerordentlich innovativ und ihre Gesellschaftsordnung – wie in den anderen Kontinenten – war matriarchal. Hier kam es nicht zur Entwicklung einer hierarchischen Gesellschaft mit steinernen Monumentalbauten wie auf dem Hochland, wo Patriarchalisierung und Reichsbildung zu Beginn der Klassischen Epoche (300 n.u.Z.) einsetzten. Die Gesellschaft am Isthmus blieb bäuerlich und egalitär und folgte damit der alten Tradition der Jungsteinzeit an der Pazifikküste.39 Erst die zapotekische und dann die spanische Eroberung brachten Überlagerungen, dennoch gelang es den Menschen im Tiefland, insbesondere den Frauen von Juchitán, große Teile ihrer traditionellen Kultur zu behalten.
Das Leben der Frauen von Juchitán und der gesellschaftliche Zusammenhang wurden in jüngster Zeit von engagierten Ethnologinnen erneut erforscht. So brachten Veronika Bennholdt-Thomsen und ihr Team einen feministisch-politischen Blick mit, der die eigentümlichen Muster dieser Gesellschaft entdecken konnte, die vorher im Verborgenen blieben.40 Nach ihren Studien fallen, wenn man diese Stadt besucht, zuerst die Frauen auf, nicht nur wegen ihrer betonten Leibesfülle und farbenfrohen Kleidung, die aus bunt gemusterten Röcken und den prächtig mit großen Blumen bestickten Blusen besteht (Abb. 8). Sie sind genauso bemerkenswert wegen ihrer Dominanz im Straßenbild, sei es bei den Geschäften auf dem Markt, sei es bei den Festen auf den Straßen. Denn sie sind die Besitzerinnen des Marktes und die Hauptpersonen der Feste. Nun würde das allein kein Matriarchat ausmachen, wenn nicht andere wesentliche Merkmale dazukämen. So gehört das Haus allein der Frau, sie sorgt durch ihre Händlerinnentätigkeit finanziell und organisatorisch für das ganze Hauswesen: den Hausbau, den Haushalt, die Erziehung der Kinder. Später vererbt sie das Haus an eine Tochter, meist an die jüngste Tochter, die bei der Mutter bleibt und sich im Alter um sie kümmert.
Abb. 8: Frau aus Juchitán auf dem Gang zu einem Fest (aus: Beverly L. Chiñas: The Isthmus Zapotecs: A Matrifocal Culture of Mexico, New York 1992 (2), Verlag Holt, Rinehart and Winston)
Es überrascht daher nicht, dass es in dieser Stadt den modernen, westlichen Typ der »Hausfrau«, die besitzlos und abhängig von ihrem Ehemann ist, nicht gibt. Hier ist jede Frau als Handwerkerin und Händlerin ihre eigene Unternehmerin und völlig unabhängig vom Ehemann. Ebenso ist die Isolation der Hausfrau im Einfamilienheim unbekannt. Schon das offene Haus mit Veranda, die auf die Straße wie auf einen öffentlichen Hof geht, lässt die Illusion von Privatheit nicht zu. Außerdem ist auch die Lebensweise der Frauen öffentlich, denn sie verkaufen ihre häuslichen Produkte vor ihren Häusern oder in den Gassen und Straßen oder auf dem nur von Frauen bevölkerten Markt (Abb. 9). Dabei sind sie in ständiger Kommunikation mit den Nachbarinnen und den Vorüberkommenden. Ihre Haustiere leben ebenfalls zwischen den offenen Häusern auf den Straßen. Besonders wichtig sind die Schweine, die alle Haushaltsabfälle fressen und dann, fett gemästet, auf dem Markt verkauft werden. Der Erlös wird in Goldmünzen angelegt, und diese sind das Guthaben der Frauen aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, das sie bei den Festen um den Hals gehängt zur Schau tragen. Größere Ausgaben wie der Hausbau oder die Ausbildung der Kinder werden mit diesen Goldmünzen bezahlt.
Abb. 9: Frauen auf dem Markt von Juchitán (aus: »Basler Magazin«, Nr. 14, 1992, S. 3, Foto: Cornelia Suhan)
Juchitán ist eine Ackerbaustadt, das heißt: das Land, das sie umgibt, sind die Felder der Stadt. Jeden Morgen ziehen die männlichen Bewohner der Stadt mit ihren Ochsenkarren – die moderneren von ihnen mit Lastwagen oder Bus – zur Feldarbeit aus der Stadt hinaus. Sie arbeiten tagsüber als Bauern in der Landwirtschaft, die mit künstlicher Bewässerung betrieben wird, oder als Fischer an den Lagunen oder der Meeresküste. Der Handel ist Frauensache, Landarbeit dagegen Männersache. Den Männern gehören die Felder, und sie vererben sie vom Vater auf den Sohn. Doch sie können daraus keinen persönlichen Gewinn ziehen, denn die Ernte aus ihrer Feldarbeit, eben alles, was auf dem Land wächst, kommt in die Hände und den Haushalt der Frauen. Die Frauen verarbeiten die rohen Feldfrüchte zu Speisen, wie geröstete Maisfladen und süße Getränke und andere köstliche Gerichte, die sie in den Straßen und auf dem Markt der Stadt verkaufen. Der Erlös verbleibt vollständig bei ihnen. In der Jahreszeit, in der es wenig Feldarbeit gibt, helfen die Männer handwerklich den Frauen, oder sie verdienen auswärts Geld als Lohnarbeiter. Auch dieser Lohn wird insgesamt den Frauen ausgehändigt. Die Frauen versorgen dafür die Männer mit der täglichen Nahrung und geben ihnen Geld für ihre persönlichen Angelegenheiten, sei es im Verhältnis von Gattin zum Gatten, von Schwester zum Bruder oder von Tochter zum Vater. Die gesamte Ökonomie von Juchitán liegt in den Händen der Frauen, die als die Ernährerinnen gesehen werden – eine Situation, die grundsätzlich auch für andere matriarchale Gesellschaften gilt. Doch es gibt keinen Streit zwischen den Geschlechtern wegen dieser ökonomischen Regelung, alle finden diese Arbeitsteilung in Ordnung. So gelten die Männer bei ihren Frauen als »sehr hilfsbereit«, und die Männer von Juchitán sind stolz auf ihre »starken und schönen Frauen«.41
Unterentwicklung und Armut, sonst allgemein in Mexiko, sind in Juchitán unbekannt, denn die Frauen halten eine traditionelle, regionale Ökonomie aufrecht, die weitgehend autark ist. Die Ressourcen der Gegend fließen nicht in einen ausbeuterischen, nationalen oder internationalen Markt ab, über den im ungerechten Handel billige Rohstoffe gegen teure Fertigprodukte getauscht werden. Stattdessen wird alles lokal produziert, verarbeitet, verkauft und konsumiert. Einheimische Produkte werden höher geschätzt als importierte, man ist stolz auf das Eigene: auf juchitekisches Essen, Kleidung und Musik. Es ist eine echte, selbständige Subsistenzökonomie.42 Daher konnten von außen gelenkte Firmen mit ihren Fabriken und Supermärkten in Juchitán nicht Fuß fassen. Gleichzeitig sind die Tätigkeiten der Frauen, die eben auf gutes Essen, schöne Kleidung und angenehmes Wohnen gerichtet sind, hoch geachtet, denn sie betreffen alle wichtigen Lebensvorgänge. So können die Frauen die lokale Marktwirtschaft von Juchitán, die sie wie einen großen Haushalt führen, unter Ausschluss fremder Güter steuern, denn sie haben ihre »ethnische Identität«, ihre Selbstachtung und Würde, nicht verloren.43
Die Frauen gelten nicht als »niedere Klasse«, wie fälschlich behauptet wird, denn Klassendenken kennen diese Menschen nicht.44 Nur in anderen Teilen der Welt, wo diese Art der Subsistenzproduktion nicht mehr unabhängig ist, sondern durch kapitalistische Märkte ausgebeutet und zugleich verachtet wird, entstehen die Phänomene der sogenannten »Dritten Welt«, die in Verelendung und Hunger gipfeln. Sie sind bedingt durch die strukturell verankerte Verletzung der Würde der Frauen und der Bauern.45 In Juchitán blieb dagegen durch die lokale Ökonomie der Frauen der Wohlstand erhalten, er ist sichtbar und allgemein. Er zeigt sich deutlich in der Wohlbeleibtheit der Frauen, denn rundlich zu sein beweist reichliches und gutes Essen und ist das weibliche Schönheitsideal in dieser Stadt.46
Eine weitere Eigenschaft der matriarchalen Ökonomie ist, dass nicht diejenige Person Ansehen gewinnt, die viel Geld besitzt, sondern diejenige, die viel für andere ausgibt. In Juchitán geschieht das reichlich bei den großen Festen, von denen es allein in dieser Stadt 35 in jedem Jahr gibt. Ihre Wurzel sind alte, agrarische Jahreszeitenfeste, überlagert von christlichen Festen im Kirchenjahr. Außerdem werden persönliche Lebensstadienfeste gefeiert, wie der fünfzehnte Geburtstag als Initiationsfest der Mädchen, Hochzeitszeremonien und Altersjubiläen.
Diese Feste oder »Velas« dauern zwei bis vier Tage und es kommen sehr viele Gäste, deren Zahl 2000 bis 3000 betragen kann. Sie alle sind von der Schirmherrin des Festes, der »Mayordoma«, eingeladen und werden von ihr verköstigt und beschenkt. Die Feste sind in erster Linie eine Angelegenheit der Frauen, die im Zentrum der Ökonomie stehen. Sie planen, organisieren und leiten das Fest, denn sie sind die Handlungsträgerinnen, während die Männer als Musikanten aufspielen und sich sonst im Hintergrund halten. Insbesondere ist der 50. oder 60. Geburtstag einer Frau ein solcher Anlass; diese Jubiläen sind Gelegenheiten für ein »Verdienstfest«, das vom ganzen Stadtviertel gefeiert wird, um die ältere Frau in ihrer Rolle als Mayordoma zu ehren. Sie ist der Mittelpunkt des Festes, und obwohl sie als Mayordoma hohe Ausgaben hat, gewinnt sie gleichzeitig großes Prestige. Darauf kommt es an: Die matriarchale Ökonomie der Leute von Juchitán ist nicht auf persönliche Bereicherung ausgerichtet, sondern auf Verteilung der Güter gemäß dem Wert der Gegenseitigkeit. In einer solchen »Prestige-Ökonomie« geht es um Festigung der sozialen Bindungen durch gemeinsames, fröhliches Konsumieren der Güter. Diese zirkulieren dabei als Geschenke und werden nicht bei einsamen Individuen, den »Reichen«, angehäuft. Eine Mayordoma ist wohlhabend und zugleich großzügig, und soziales Ansehen ist der Gegenwert, den sie mit dem lange ersparten und heiß ersehnten Verdienstfest gewinnt. Gemäß den Werten der Gegenseitigkeit und Balance wird sie zu anderen Festen eingeladen und wird dort so beschenkt, wie sie geschenkt hat. Auf diese Weise geht es weiter durchs ganze Jahr. Das Prinzip der Gegenseitigkeit ist dabei unumstößlich und wer sich nicht daran hält, hat sich aus der Gemeinschaft heraus gestohlen und sich selbst ausgeschlossen. Isolierung, Vereinsamung und Lebensunsicherheit wären die Folgen.
Verdienstfeste von Frauen sind außergewöhnlich. In vielen Teilen der Welt sind Verdienstfeste Männersache, sie gewinnen dadurch Prestige, und Frauen sind die passiven Zuschauerinnen der männlichen Ehre. Nicht so in Juchitán, wo die Frauen die Subjekte und Handelnden der Feste sind und sie öffentlich auf den Straßen feiern. Dafür wird ein Straßenstück tagelang abgesperrt, so dass der Verkehr umgeleitet werden muss, ein Dach aus Palmblättern oder Stoff wird errichtet, Klappstühle werden in Reihen aufgestellt und ein Tanzplatz freigelassen, der mit Blumen und Girlanden geschmückt ist. Riesige Mengen an Essen und Trinken stehen bereit und mindestens zwei Musikkapellen treten an. Die Gäste strömen herbei, zuerst die Frauen hoch erhobenen Hauptes und in prächtig bestickten Samtblusen und Samtröcken, unter denen sich weiße Spitzenröcke bodenlang ergießen, große Blüten im Haar und eine Galerie Goldmünzen um den Hals. Sie tanzen auch zuerst, meist je zwei zusammen, sie sitzen in den vordersten Reihen, lachen laut, reißen Witze, essen viel und trinken gewaltige Mengen Bier. Die Mayordoma steht im Mittelpunkt des Festes, doch an ihrer Seite darf eine junge Frau aus ihrer Verwandtschaft, schön geschmückt, die »Festkönigin« sein. Verwandte und Nachbarinnen übernehmen als »Madrinas«, als Partnerinnen, einen Teil der Kosten und der Organisation des Festes. Tagelang tanzen die Frauen miteinander und als Höhepunkt der Feierlichkeiten findet ein Umzug auf geschmückten Wagen statt, von denen herab Früchte von schönen, jungen Frauen an die Menge verschenkt werden – ähnlich wie bei uns im Karneval.
Wirtschaftlich gesehen haben diese Feste einen nivellierenden Effekt, und das ist die Absicht bei einer Ökonomie der Gegenseitigkeit und des Ausgleichs. Die Unterschiede zwischen reicheren und ärmeren Frauen werden damit verringert, denn von einer wohlhabenden Frau wird erwartet, dass sie mehr gibt, sowohl als Schirmherrin wie als Gast. Nach den Spielregeln kommt ein Teil der Festkosten gleich zu Beginn zurück, denn alle Gäste bringen der Mayordoma Geschenke in Naturalien oder Geld mit, auch hier geordnet nach dem jeweiligen Vermögen. Es gibt für die Gegenseitigkeit kein vorgeschriebenes, abstraktes Maß – wie Geld und Preise es sind –, denn dies wäre nur äußerlich und deshalb nicht gerecht. Es geht viel eher um Ausgleich und Balance, und darauf wird genau geachtet. So ist die ganze Stadt stets mit der konkreten Anwendung der Normen dieser Gegenseitigkeit beschäftigt und das geschieht durch den Klatsch. In der Klatschrunde reden die Frauen permanent übereinander, aber auch miteinander. Wenn über eine Frau in ihrer Abwesenheit geredet wird, übernimmt eine andere jeweils ausdrücklich die Verteidigung als Fürsprecherin. Auf diese Weise werden die Normen stets verhandelt und an die Situation angepasst. Ziemlich alles wird früher oder später wieder ins Lot gebracht und dazu brauchen sie keine starren Gesetze, keine Richter und in Stein gemeißelte Strafen.47
In diesem Sinne sind die Feste in Juchitán der Motor der Ökonomie, und sie sind ein weiteres, schönes Beispiel für eine Schenke-Ökonomie48. Nicht der Markt ist der Gradmesser der Ökonomie – wie es bei kapitalistischen Märkten der Fall ist – sondern der lokale Markt ist eingebettet in die umfangreiche Schenke-Ökonomie. Lokale, bäuerliche Märkte, umgeben von einer Schenke-Ökonomie, sind auch für andere matriarchale Gesellschaften typisch und sie funktionieren ganz anders als kapitalistische Märkte, bei denen es um die Maximierung von Profit durch einen ungerechten Tausch geht. Wie in Juchitán spielt bei diesen lokalen Märkten nicht der Preis beim Verkaufen und Kaufen die wichtigste Rolle, sondern das stetige Erneuern guter, nachbarschaftlicher Beziehungen durch die Gespräche zwischen den Frauen auf dem Markt. So kann ein Produkt durchaus teurer eingekauft werden, aber es wurde bei einer Freundin gekauft und der Kauf hat die Freundschaft vertieft. Das ist auch ein Grund, warum fremde Supermärkte in Juchitán bisher nicht Boden gewinnen konnten, wie zum Beispiel WalMart (2005). Die Frauen von Juchitán sagten: »Man kann dort nicht sprechen, nicht miteinander reden, man kann dort nichts anderes tun als kaufen und bezahlen!« Und sie gingen nicht mehr hin.49