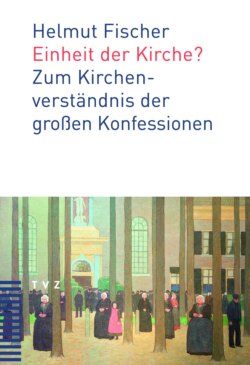Читать книгу Einheit der Kirche? - Helmut Fischer - Страница 6
Оглавление|10| 1 Was uns die Namen der Kirchen sagen
1.1 Was bedeutet »katholisch«?
Seit dem 4. Jahrhundert bekennen alle Christen die »eine heilige katholische und apostolische Kirche«. In diesem Bekenntnis definiert sich die Glaubensgemeinschaft der Christen. Die genannten vier Charakteristika (eine; heilige; katholische; apostolische) sind allesamt erklärungsbedürftig. Sie werden in unterschiedlichen Zusammenhängen zur Sprache kommen. Hier soll zunächst nur auf die mehrdeutige Bezeichnung »katholisch« eingegangen werden.
Unser deutsches Wort »katholisch« ist von gr. katholikós abgeleitet und bedeutet »allgemein«. Seit etwa 100 wurde »katholisch« im Sinn von »allgemein« auf die christliche Kirche bezogen. Während der Auseinandersetzungen mit häretischen Strömungen im 3. Jahrhundert nahm »katholisch« die Bedeutung von »rechtgläubig« an. Das Religionsedikt von 380 (Theodosius I.) erhob das Christentum unter der Bezeichnung ecclésia catholika zur alleinberechtigten Reichsreligion. Der Kirchenvater Augustinus († 430) verstand »katholisch« als »umfassend«, »rechtgläubig«, »über die ganze Erde verbreitet« und »immer, überall und von allen geglaubt«. Diese ungeteilt umfassende Kirche zerbrach freilich. Papst Nikolaus I. von Rom (863) und Photius, der Patriarch von Konstantinopel (867) belegten einander mit Bannflüchen und exkommunizierten die Gegenseite. 1054 trennten sich Ost- und Westkirche definitiv voneinander. Beide Kirchen reklamierten fortan für sich, den einen allumfassenden und rechten apostolischen Glauben zu besitzen und zu bewahren und allein im ursprünglichen Sinn »katholisch« zu sein.
Seit dem 12. Jahrhundert wurde in Rom »katholisch« immer eindeutiger mit »römisch« gleichgesetzt. Im gegenreformatorischen |11| Konzil von Trient von 1545–1563 hat sich die inzwischen rom- und papstzentrierte Kirche des Westens als die »heilige katholische apostolische und römische Kirche« definiert. Im Widerspruch zu ihrem Selbstverständnis, die eine wahre Kirche zu sein, nahm sie aber mit der zusätzlichen Bezeichnung »römisch« den Charakter einer von nun zwei christlichen Konfessionen an, ohne freilich ihren Absolutheitsanspruch aufzugeben. Im Lehrbekenntnis von Trient wurden alle Amtsträger auf die »Heilige Römische Kirche« verpflichtet. Der vom Trienter Konzil angeregte Katechismus wurde mit Bedacht »Römischer Katechismus« genannt. 1568 wurde das »Römische Brevier« und 1570 das »Römische Messbuch« veröffentlicht. Der Begriff »katholisch« wurde damit auf den Traditionsstrang Roms verengt, aber zugleich mit der Fülle und Ganzheit der christlichen Tradition gleichgesetzt.
1.2 Was bedeutet »orthodox«?
In unserer Alltagssprache gilt als »orthodox« derjenige, der an alten Lehrmeinungen starr festhält. In diesem Sinne kann auch zum Beispiel von einem orthodoxen Marxisten gesprochen werden. Die orthodoxe Kirche sieht sich mit diesem Wortverständnis nicht zutreffend charakterisiert.
Das griechische Wort orthodox ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Das erste Wortelement, orthós, bedeutet »recht/ richtig«. Wir kennen diese Bedeutung z. B. aus dem Begriff »Orthographie/Rechtschreibung«. Das zweite Wortelement, dox, hat zwei unterschiedliche Wurzeln. Es findet sich zum einen in dem griechischen Wort dokein mit der Bedeutung von »meinen/glauben«. Die andere Wurzel liegt in dem griechischen Wort doxázein, »lobpreisen«.
Die orthodoxen Kirchen sehen sich als in allen genannten Wortdeutungen beschrieben. Mit »orthodox« als Selbstdefinition bringen sie zum Ausdruck, dass sie sich als die Kirchen |12| verstehen, die das urchristliche, apostolische und frühchristliche Erbe der Kirchenväter samt den sieben ökumenischen Konzilien unverfälscht bewahrt haben, und zwar im Unterschied zur Kirche des Westens, die aus ihrer Sicht davon abgewichen ist. So ist mit »Orthodoxie« die Kirche der rechten Glaubenslehre gemeint. Aber nach orthodoxem Selbstverständnis ist die Kirche nicht auf rechten Lehren und zeitlosen Dogmen gegründet. Der orthodoxe Theologe N. Thon formuliert zugespitzt: »Die orthodoxe Theologie hat … keine Tradition (im Sinne von Glaubenslehren), sie lebt die Tradition« (Thon, 921) Der orthodoxe Theologe G. Larentzakis verdeutlicht, dass sich seine Kirche »zunächst als Kirche der rechten Lobpreisung des dreieinigen Gottes« (Larentzakis, 15) versteht. Die rechte Lehre erwächst aus der rechten Lobpreisung. Orthodoxe Kirche ist nicht primär lehrende und belehrende Institution, sondern eine Gott preisende und betende Gemeinschaft. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich als »katholisch« im ursprünglichen Sinn versteht. In der heutigen Umgangssprache wird »orthodox« aber selbst von orthodoxen Christen nur selten in diesem inhaltlichen Sinn, sondern durchweg als Konfessionsbezeichnung verstanden.
1.3 Was bedeutet »protestantisch«?
Die Reformatoren wollten nicht eine neue Kirche, sondern Reformen in ihrer katholischen Kirche. Insofern stand eine Selbstbezeichnung für sie zunächst gar nicht an. Die Bezeichnung »Protestanten« kam von den Gegnern der reformatorischen Bewegung, die damit auf die »Protestation« der evangelischen Reichsstände beim 2. Reichstag von Speyer 1529 anspielten. Die reformatorische Bewegung charakterisierte sich selbst als »evangelisch« und meinte damit »dem Evangelium gemäß«. In der Umgangssprache gilt »evangelisch« heute |13| als Sammelbegriff für die lutherischen, reformierten und unierten Kirchen.
Mit dem Wort »protestantisch« verbindet man heute oft die Vorstellung von Protest und Widerspruch. Die reformatorische Bewegung bezog ihre Schubkraft aber nicht aus dem Widerspruch. Darauf weist der Wortsinn sehr deutlich hin. Das Wort »Protestant« ist aus den lateinischen Worten pro und testari entwickelt worden. Das Verb testari bedeutet »bezeugen/Zeuge sein«. Und pro bedeutet »für«. Ein christlicher protestans (Protestierender) ist demnach einer, der sein Zeugnis für Christus auch öffentlich zum Ausdruck bringt und der dort seinen Einspruch und Widerspruch äußert, wo nach seinem Verständnis das Christuszeugnis, wie es uns in den neutestamentlichen Schriften vorliegt, verdunkelt, verfremdet oder durch fremde Elemente ersetzt wird. Der Impuls des Protestantischen kommt bis heute also nicht aus dem Protest gegen etwas oder gegen jemanden, sondern aus der Verpflichtung, in Glaubensfragen dem Zeugnis der Schrift Vorrang zu geben. Das kommt in der missverstehbaren Kurzformel sola scriptura (allein die Schrift) zum Ausdruck, worauf noch näher einzugehen sein wird.
Luther, Calvin und die anderen Reformatoren haben ihren Glauben selbstverständlich als fides catholica, als katholischen Glauben im frühchristlichen Wortsinn verstanden und die heutigen Protestanten tun das auch. Die Bekenntnisschriften der lutherischen und reformierten Kirchen definieren sich bewusst als »katholische Bekenntnisse«, als Bekenntnisse zu der einen allgemeinen christlichen Kirche, in die die Christusgläubigen jenseits aller Konfessionsgrenzen als Gemeinschaft eingebunden sind. Es sei freilich auch gesagt, dass römische Katholiken ihren Glauben ebenfalls in der biblischen Botschaft begründet sehen und sich insofern als »evangelisch« verstehen.
|14| 1.4 Der Bedeutungswandel von »katholisch«
Das Wort »katholisch« ist im theologischen Selbstverständnis aller christlichen Konfessionen in seinem ursprünglichen Sinn fest verankert. In der Umgangssprache hat es diesen ursprünglichen Sinn weitgehend verloren und ist zur gängigen Konfessionsbezeichnung der römisch-katholischen Kirche geworden. Diese Reduktion wird von der römisch-katholischen Obrigkeit gefördert. Selbst in offiziellen Verlautbarungen der römisch-katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum fällt das »römisch« oft weg und wird nur von der »katholischen Kirche«, vom »katholischen Katechismus«, von der »katholischen Erwachsenenbildung gesprochen«. Oft wird sogar auch die Bezeichnung »katholisch« weggelassen und nur von »der Kirche« oder von der »Deutschen Bischofskonferenz« gesprochen und geschrieben, so, als gäbe es nur die eine Kirche und nur römisch-katholische Bischöfe. Die romfreundliche Presse bezeichnet den römischen Papst als »das Oberhaupt der Christen« Diese Verkürzungen bringen das Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche allerdings sehr wirkungsvoll zum Ausdruck, die sich ja tatsächlich als die christliche Konfession versteht, in der allein die Fülle der christlichen Wahrheit verwirklicht ist.
Die Tendenz, das Wort »katholisch« exklusiv für die römisch-katholische Kirche zu reklamieren, kommt auch in der deutschsprachigen Fassung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zum Ausdruck. Einer Kommission von Vertretern der römisch-katholischen, der protestantischen und der altkatholischen Kirchen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz war es 1970 gelungen, eine gemeinsame deutschsprachige Fassung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses zu erstellen. Lediglich bei dem Wort catholica war eine Einigung nicht möglich. Die protestantischen Kirchen hielten es für nötig, das Wort »katholisch« wegen seiner konfessionellen Engführung |15| im gegenwärtigen Sprachbewusstsein mit »christlich« zu übersetzen, um so die allen Konfessionen übergeordnete christliche Glaubensgemeinschaft im Blick und im Bewusstsein zu halten, die alle altchristlichen Bekenntnisse meinen.
Die römisch-katholischen Vertreter bestanden darauf, das Wort »catholica« unübersetzt beizubehalten. So bekennen römisch-katholische Christen ihren Glauben mit den Worten: »Ich glaube die heilige katholische Kirche«. Sie meinen in ihrer Mehrzahl ganz unbefangen mit »katholisch« die römisch-katholische Kirche, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie sich damit aus der alle Christen umfassenden Glaubensgemeinschaft ausgliedern. Diese volkstümliche Gleichsetzung von »katholisch« mit »römisch-katholisch« ist von römischer Seite deshalb gern gesehen, weil sie dem theologischen Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche entspricht, die einzige Kirche zu sein, in der die allumfassende Einheit der Glaubenden bereits voll verwirklicht ist. Das ökumenische Bekenntnis ist dabei zwar sprachlich gewahrt, aber inhaltlich in exklusiv römischer Weise neu definiert.