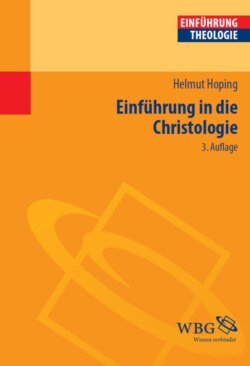Читать книгу Einführung in die Christologie - Helmut Hoping - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Christologie im Horizont der Eschatologie
Оглавлениеdie Auferweckung Jesu und das Ende der Geschichte
Für den von Wolfhart Pannenberg entwickelten universalgeschichtlichen Ansatz in der Theologie – vorgelegt in dem Band „Offenbarung als Geschichte“ (Pannenberg/247) – ist der Gedanke zentral, dass über den Sinn der Geschichte erst von ihrem Ende her eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann. Erst vom Ende her, wenn Gott als Herr allen Geschehens erscheint, lässt sich von einer universalen Offenbarung Gottes sprechen. Pannenbergs Theologie der Universalgeschichte gründet in einer Christologie der Auferweckung. In der Auferweckung Jesu offenbart sich der Sinn der gesamten Geschichte, insofern sich darin das Ende der Geschichte vorweg ereignet (Prolepse). Die Apokalyptik des Frühjudentums erwartete den endzeitlichen Selbsterweis Gottes mit der leiblichen Auferstehung der Toten. In der Auferweckung Jesu sieht Pannenberg deshalb die Hoffnung auf ein endzeitliches Geschichtshandeln Gottes erfüllt.
die Auferweckung Jesu als historisches Ereignis
Die Christologie muss ihren Ausgangspunkt bei Jesus und seiner Geschichte nehmen. Für die Begründung der Einheit Jesu mit Gott, die nur in seiner Selbstunterscheidung vom Vater gegeben ist, kommt allerdings der Auferweckung Jesu die entscheidende Bedeutung zu. Ohne die apokalyptische Erwartung zur Zeit Jesu zum dogmatisch alles entscheidenden Horizont der Interpretation von Person und Geschichte Jesu machen zu wollen, zählt Pannenberg das Geschehen der Auferweckung Jesu von den Toten und den damit verbundenen Anbruch des Endes aller Dinge zum Kern des christlichen Glaubens. Entschieden wendet er sich an dieser Stelle gegen das Entmythologisierungsprogramm Rudolf Bultmanns (Pannenberg/31: 15–31.47–112). Die Auferweckung Jesu ist nicht nur ein Symbol der menschlichen Hoffnung über den Tod hinaus, sondern ein „historisches Ereignis“, sofern es sich beim Handeln Gottes am Gekreuzigten und Begrabenen um etwas handelt, was in menschlicher Zeit und Geschichte geschehen ist. Das leere Grab rechnet Pannenberg dabei als göttliches Zeichen zur Wirklichkeit der leiblichen Auferweckung Jesu.
die Einheit Jesu mit Gott und seine Unterschiedenheit vom Vater
Die Auferweckung Jesu ist der Ort der eschatologischen Selbstoffenbarung Gottes und der Erkenntnisgrund für die Einheit Jesu mit Gott. Auf der Linie des christologischen Dogmas wird von Pannenberg die Einheit Jesu mit Gott, seinem Vater, ausgehend vom Gedanken der Selbstoffenbarung Gottes als Offenbarungs- und Wesenseinheit konzipiert (Pannenberg/31: 291–361). Im Lichte der Auferweckung erscheint die Hingabe Jesu an Gott, seinen Vater, als Vollzug der von Gott empfangenen Sohnschaft. Die Einheit Jesu mit Gott ist keine direkte Identität des Menschen Jesus mit dem Sohn Gottes, sondern vollzieht sich in seiner Unterschiedenheit vom Vater, die mit zum Wesen Gottes gehören muss, wenn Jesus Gottes eschatologische Selbstoffenbarung ist.
Dies führt zum Gedanken einer ewigen Selbstunterscheidung in Gott, der Unterscheidung zwischen der göttlichen Person des Sohnes und dem göttlichen Vater (31: 158–189). Eine Inkarnationschristologie ist deshalb für Pannenberg nicht nur ein „sachgemäßer, sondern unerlässlicher Ausdruck“ (346) der Einheit Jesu mit Gott. Die Christologie Pannenbergs ist aber vor allem eine „Christologie der Auferweckung Jesu“ (Schilson-Kasper/34: 90). Doch Gottes eschatologische Offenbarung ereignet sich nicht erst in der Auferweckung Jesu, sondern schon in seinem Leiden und Sterben. Zwar wird die Kreuzigung Jesu im neutestamentlichen Kerygma im Lichte seiner Auferweckung gesehen. Doch kann man fragen, ob der Gekreuzigte und seine Solidarität mit den Leidenden und Sterbenden in Pannenbergs universalgeschichtlichem Ansatz ausreichend zur Sprache kommen.
Kreuzestheologie
Dass die Eschatologie nicht eine überholbare, mythologische Gestalt des Evangeliums ist, sondern zur Substanz des christlichen Glaubens gehört, ist vor allem von Jürgen Moltmann in seiner „eschatologischen Theologie“ (Moltmann/425) herausgestellt worden. Ihre Grundlage hat Moltmann mit der Programmschrift „Theologie der Hoffnung“ (Moltmann/423) gelegt und bald darauf in zwei weiteren Programmschriften kreuzestheologisch und ekklesiologisch entfaltet (Moltmann/65/424). Moltmanns Theologie hat ihr Zentrum in der Kreuzestheologie. Weil sich die Christologie an der harten Realität des Kreuzes zu bewähren hat, gehört zu einer Christologie der Auferweckung untrennbar eine Christologie des Kreuzes.
In seiner „Christologie in messianischen Dimensionen“ wendet sich Moltmann gegen „die von der Eschatologie abgespaltene Christologie“ (Moltmann/29: 20), die im Gefolge der altkirchlichen Inkarnationschristologie die Gottessohnschaft Christi ins Zentrum rückte. Die Christologie ist „eine bestimmte Gestalt der israelitisch-jüdischen Messiashoffnung“ (29: 18). Da der gekommene Messias zugleich derjenige ist, dessen Wiederkunft von Christen erwartet wird, ist „das christliche Ja zu Jesus dem Christus … nicht in sich selbst abgeschlossen und fertig, sondern in sich geöffnet für die messianische Zukunft Jesu“ (50). Gott offenbart sich im Modus der Verheißung, der ankommenden Zukunft und eröffnet dadurch in der Geschichte den Raum eschatologischer Hoffnung. Diese ist auf die Vollendung von Gottes endgültiger Offenbarung in Jesus Christus, wenn alle Verheißungen erfüllt sind, ausgerichtet. Gott kommt und ist als der Kommende gegenwärtig (Moltmann/424: 149). Auch die Verkündigung Jesu ist eschatologisch bestimmt. Jesu Auferweckung ist Gottes Offenbarung im Modus der Verheißung (424: 172). Nach Moltmann ist mit Blick auf den auferweckten Gekreuzigten von der eschatologischen Bekräftigung der Verheißungen Gottes, vom „‚Ende der Geschichte‘ mitten in den Verhältnissen der Geschichte“ (65: 173), zu sprechen. So ist die „Offenbarung des Auferstandenen auf seine eigene Zukunft und Verheißung hin offen“ (424: 78). Die Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes wird damit zur Grundgestalt christlicher Existenz.
messianische Christologie
Stärker als Pannenberg betont Moltmann den Charakter des Kreuzes Christi als Offenbarung Gottes. Im Lichte der Auferweckung erschließt der Verlassenheitsschrei Jesu am Kreuz die Besonderheit seines Sterbens. Er offenbart Gottes Einsatz für das Heil der Menschen bis hinein in das Sterben seines Sohnes, durch das Gott selbst den Tod erleidet. Moltmanns Kreuzestheologie versteht aber das Kreuz Christi so sehr als ein Geschehen zwischen Gott und Gott, dass dabei die Menschheit Christi nicht mehr in vollem Umfang zur Sprache gebracht wird. In seiner messianischen Christologie behandelt Moltmann dagegen ausführlich die „menschlichen Leiden Christi“ sowie seine Solidarität mit allen Leidenden und Sterbenden, die es auch möglich macht, von einem inneren Zusammenhang der Leiden des Juden Jesus und der geschichtlichen „Leiden Israels“ zu sprechen (29: 181– 191).
In den menschlichen Leiden des Messias Jesus erkennt die christliche Theologie des auferweckten Gekreuzigten das göttliche Leiden für unser Heil. Das eschatologische Ereignis der Auferweckung Jesu von den Toten stellt ein neues schöpferisches Handeln Gottes dar. Doch das Kerygma von der Auferweckung Jesu spricht „die Sprache der Verheißung und der begründeten Hoffnung“, nicht aber „die Sprache der vollendeten Tatsachen“, weil ihre göttliche Wahrheit auf die eschatologische Auferweckung aller Toten angewiesen bleibt (29: 245). Nach Moltmann ist die Geschichte in der Perspektive der Auferweckung Jesu zu betrachten. Denn die Auferweckung Jesu ist mehr als ein historisches Ereignis, ein Ereignis der Vergangenheit; sie ist ein zukunfterschließendes und geschichtseröffnendens Ereignis, von ihr kann sinnvoll nur im Rahmen der durch Gottes Heilshandeln eröffneten Geschichte gesprochen werden (235–238).
kosmische Christologie
Aber nicht nur die Geschichte, auch die Natur sieht Moltmann in der Perspektive der Auferweckung Jesu. Denn mit ihr wird die sterbliche Leiblichkeit in die verklärte Leiblichkeit verwandelt. Sie ist der von Gott gewirkte eschatologische Anfang einer Verwandlung des ganzen sterblichen Lebens (29: 268–296). „Auferweckung ist leibliche Auferweckung oder sie ist keine Auferweckung“ (279). In seiner Christologie betont Moltmann besonders den kosmischen Zusammenhang der Christologie und der neuen Schöpfung. Die messianische Christologie ist zugleich kosmische Christologie. In ihrem Zentrum steht Christus, der „Erstgeborene vor aller Kreatur“ (Kol 1,15.18), der nicht nur stellvertretend den Tod der leidenden Menschen, sondern den „Tod alles Lebendigen“ gestorben ist, um alles im Himmel und auf Erden zu verwandeln und Frieden zu bringen. „Der leiblich auferstandene Christus ist der Anfang der Neuschöpfung des sterblichen Lebens in dieser Welt“ (29: 280).
Moltmann fordert deshalb, über die Grenzen der „geschichtlichen Christologie“ der Neuzeit hinauszugehen zu einer „Christologie der Natur“, die gegen den teleologischen Optimismus der kosmischen Christologie Teilhard de Chardins auch das Negative, das Böse und die Brüche in der Entwicklung der Natur, das heißt ihre Erlösungsbedürftigkeit, herausstellt (29: 297–336). Denn ohne „Heilung der Natur“ gibt es kein „Heil für Menschen“ (297). Die kosmische Christologie Moltmanns ist zugleich „Apologie der Parusieerwartung“, der befreienden Kraft der Erwartung des „kommenden Christus“, die zur Entwicklung des Wegs Jesu gehört (337–366).