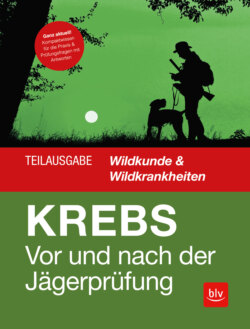Читать книгу Vor und nach der Jägerprüfung - Teilausgabe Wildkunde & Wildkrankheiten - Herbert Krebs - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verdauungssystem
ОглавлениеDas Verdauungssystem der Säugetiere beginnt mit dem Kopfdarm, der durch Lippen, Mundhöhle, Zähne und Zunge vertreten ist. Assoziierte Organe des Kopfdarmes sind die verschiedenen Speicheldrüsen, deren Sekret neben mechanischen auch wesentliche biochemische Aufgaben (Pufferung der Salzsäure im Magen etc.) zukommt. Der nachfolgende Schlund dient als Transportorgan, das die aufgenommene, mehr oder weniger grob zerkleinerte Nahrung in den Magen leitet. Der linksseitig die Luftröhre (Drossel) begleitende Schlund durchläuft die Brusthöhle, quert in einer Muskelspalte eingebettet das Zwerchfell und öffnet sich hinter dem Zwerchfell, also in der Bauchhöhle, in den Magen. Handelt es sich um einen Wiederkäuer, mündet der Schlund von oben in den Pansen, dem größten der 3 Vormägen der Wiederkäuer. Mit Ausnahme des Schwarzwildes gehören alle heimischen Schalenwildarten zu den Wiederkäuern. Die verbleibenden Haarwildarten besitzen wie die Sauen einen einhöhligen Magen (Monogastrier).
Der mehrhöhlige Magen der Wiederkäuer, deren Verdauungssystem unter den Pflanzenfressern als am höchsten entwickelt zu werten ist, besteht aus 3 Vormägen – Pansen, Netzmagen oder Haube und Blättermagen – sowie dem nachgeschalteten eigentlichen Magen, dem Labmagen.
Der voluminöse Pansendient als Speicherorgan. Über seine mit einer Vielzahl unterschiedlich geformter Zotten besetzte Schleimhautinnenauskleidung werden hochkalorige Fettsäuren resorbiert. Die in Klimazonen mit wechselnden Jahreszeiten lebenden Wildwiederkäuer reduzieren mit Beginn der vegetationsarmen Zeit die resorbierende Oberfläche im Pansen durch eine deutliche Verkleinerung der Zotten. Die Reduktion der Oberfläche ist als sinnvolle Anpassung an das verringerte Futterangebot des Winters zu erklären, dessen Energiegehalt nur für die Aufrechterhaltung eines stark gedrosselten Stoffwechsels ausreicht. Energie, die darüber hinaus gebraucht wird, wird aus den im Sommer angelegten Fettdepots (Feistzeit) aktiviert.
Der Netzmagen, dessen Schleimhautinnenauskleidung in der Aufsicht ein netzartiges Aussehen hat, dient der Größenselektion der Futterpartikel. Sind die Futterpartikel zu groß, werden sie zurück in den Pansen und von hier aus durch den Schlund zurück in die Maulhöhle, zum sogenannten Wiederkauen, befördert.
Futterpartikel, die vom Netzmagen in der Größe akzeptiert werden, gelangen in den Blättermagen,dessen Lumen durch eine Vielzahl unterschiedlich großer Schleimhautblätter ausgefüllt ist. Zwischen diesen Blättern wird das Futter weiter zerkleinert. Bei diesem Zerreibevorgang wird dem Futter ein Großteil der beinhalteten Flüssigkeiten ausgepresst. Der leicht breiige Futtersaft gelangt aus dem Blättermagen in den Labmagen, in dem die chemische Verdauung vornehmlich durch Salzsäure und Pepsin beginnt. In seiner Aufgabe, der enzymatischen Verdauung, entspricht der Labmagen dem Magen der Nichtwiederkäuer.
Wiederkäuermagen
Die dem Magensystem der Wiederkäuer bzw. dem Magen der Monogastrier (Lebewesen, die nur einen Magen besitzen) folgenden Darmabschnitte sind regelmäßig in Dünndarm und Dickdarm gegliedert. Der Dünndarm beginnt mit dem Zwölffingerdarm, setzt sich fort in den Leer- oder Kranzdarm und endet mit dem kurzen Hüftdarm. Im Dünndarm wird die Aufschließung des Nahrungsbreis fortgesetzt und seine Resorption über die Darmschleimhaut mit dem Transfer in das venöse Blutsystem des Darms intensiviert.
Wie der Dünndarm ist auch der Dickdarm dreigeteilt. Er beginnt mit dem Blinddarm, einer bei Pflanzenfressern voluminösen Gärkammer, bei Fleischfressern dagegen in Länge und Volumen stark reduziert, dem sich der Grimmdarm als längster Dickdarmabschnitt anschließt. Diesem tierartspezifisch konfigurierten Darm schließt sich der gerade nach hinten verlaufende End- oder Mastdarm an, der als Weiddarm bezeichnet wird. Sein Endstück ist als Anus (Weidloch) zirkulär fixiert. Zwei hier eingebaute Schließmuskeln regeln als Endabschnitte des Verdauungssystems den Kotabsatz. Dem Dickdarm kommt vornehmlich in seinen hinteren Abschnitten die wichtige Aufgabe der Wasserrückresorption zu. Je mehr Wasser dem Darminhalt entzogen wird, umso formbarer wird er. Ein spezifisches Schleimhautrelief im Enddarmbereich sowie der Grad des Wasserentzugs führen zu der speziestypischen Ausformung und Konsistenz der Losung.
Für die Aufschließung ihrer Nahrung benötigen Pflanzenfresser entsprechende Darmlängen. So beträgt z. B. bei einem adulten Damhirsch die Gesamtlänge des Darms im Mittel 35 m, von denen der für die eigentliche Nahrungsaufnahme sehr wichtige Dünndarm etwa 26 m für sich beansprucht.
Dem Darmsystem angefügt sind 2 Darmanhangsdrüsen:
• die Leber
• die Bauchspeicheldrüse.
Rothirschlosung, Kotbeeren zusammengepresst (Frühjahr)
Rehwildlosung, einzelne Kotbeeren, kommt aber auch gepresst vor.
Fuchslosung, meist mit Mäusehaaren durchsetzt, im Sommer auch Obstkerne
Marderlosung, je nach Nahrung oft schwarzblau und mit Obstkernen
Kaninchenlosung, kleiner als Hasenlosung, mehr kugelförmig und zahlreich
Rotwildlosung mit Zäpfchen und Näpfchen (diese Ausformungen sind geschlechtsunspezifisch)
Schwarzwildlosung
Dachslosung (Frühjahr)
Hasenlosung, hellbraun, rund, flach gedrückt, Struktur erkennbar
Auerwildlosung, enthält Fichtennadeln
Mäusebussard
Turmfalke
Uhu (unten mittig skelettierter Rattenschädel)
Habicht (hier mit einem Geflügelfußring)
Baumfalke
Waldkauz
Die unterschiedlich gestaltete, braunrote Leber liegt rechts vorne in der Bauchhöhle dem Zwerchfell unmittelbar auf. Ihre wesentliche Aufgabe besteht in der Speicherung der aus der Nahrung über den Darm aufgenommenen Energieträger und deren Abgabe an den Körper zur Aufrechterhaltung des Stoffwechsels. Daneben bildet die Leber kontinuierlich die Gallenflüssigkeit, die – falls vorhanden – in einer Gallenblase bevorratet oder direkt in den Zwölffingerdarm abgegeben wird. Die Gallenflüssigkeit emulgiert die Fette im Darm, die so besser verdaut werden können. Die in der Gallenflüssigkeit enthaltenen Farbpigmente sind Ursache für die grünbraune Losungsfarbe.
Der Bauchspeicheldrüse sind zwei Funktionskreise zuzuordnen. Zum einen produziert sie erhebliche Mengen von »Bauchspeichel«, eine wässrige Flüssigkeit, die vornehmlich Amylasen und Lipasen, also Enzyme zur Stärke- und Fettverdauung, enthält. Dieses Sekret wird ebenfalls in den Zwölffingerdarm abgegeben. Zum anderen bildet die Bauchspeicheldrüse das für die Regulierung des Blutzuckers unabdingbare Insulin, das direkt in die Blutbahn gelangt.
Schema des Blutkreislaufs:
① linke Herzkammer ② rechte Herzkammer ③ Lungenarterie, kleiner Kreislauf ④ Kapillargebiet der rechten und linken Lungenflügel ⑤ Lungenvenen ⑥ Brustaorta ⑦ Bauchaorta ⑧ Kapillargebiet Magen-Darm ⑨ Kapillargebiet Leber ⑩ Arterie/Vene Hals- und Kopfbereich ⑪ Kapillargebiet Becken + Hintergliedmaße ⑫ hintere Hohlvene ⑬ Pfortader
Blau = venöses, rot = arterielles Blut; ⎯→ = Fließrichtung