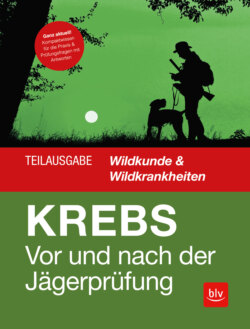Читать книгу Vor und nach der Jägerprüfung - Teilausgabe Wildkunde & Wildkrankheiten - Herbert Krebs - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rotwild (Cervus elaphus)
ОглавлениеLebensraum und Lebensweise: Rotwild, unsere größte heimische frei lebende Wildart, war ursprünglich in offenen oder licht bewaldeten Landschaften und Auen beheimatet. Landeskultur und Besiedlung haben es in geschlossene Waldgebiete zurückgedrängt. Es kommt heute bei uns nur noch in mehr oder weniger großen, voneinander isolierten Rückzugsgebieten vor. Wo es ungestört ist, bevorzugt es offene, übersichtliche Flächen und ist tagaktiv. Menschliche Aktivitäten haben es heute vornehmlich zum Nachtwild gemacht.
Sozialverhalten: Rotwild lebt in Rudeln. Erwachsene Hirsche bilden Hirschrudel, ältere Hirsche sind gelegentlich Einzelgänger. Die Kahlwildrudel setzen sich aus mehreren weiblichen Stücken mit ihrem Nachwuchs zusammen. Diesen aus Mutterfamilien zusammengesetzten Rudeln schließen sich gelegentlich jüngere Hirsche lose an. Hirsche vom 1. und 2. Kopf stehen in der Regel noch beim weiblichen Wild. Die Kahlwildrudel werden von einem Leittier geführt. Dieses führt stets ein Kalb. Verliert es dieses, verliert es meist auch seinen Rang. Vor dem Setzen verlassen die hoch beschlagenen Tiere das Rudel und führen nach einigen Wochen das neue Kalb in die Rudelgemeinschaft ein. Zu Beginn der Brunft ziehen die Kahlwildrudel zu den gewohnten Brunftplätzen, auf denen sich nach und nach auch die Hirsche einfinden. Ein Platzhirsch beherrscht das Rudel, während die Beihirsche am Rande der Rudel mit mehr oder weniger Erfolg versuchen, zum Beschlag zu kommen.
Natürliche Feinde des Rotwildes sind bei uns der regional wieder vorkommende Luchs und der Wolf. Während der Wolf Tiere aller Altersstufen erbeutet, beschränkt sich der schwächere Luchs in der Regel auf das Reißen von Kälbern.
Jahreszyklus
Steckbrief Rotwild
Körperbau: Paarhufer; Läufertyp; Gewicht bis 160 kg, ♀ bis 90 kg (aufgebrochen).
Sinne: Rotwild hört sehr gut (bewegliche Lauscher). Gesichtssinn gut, erkennt aber unbewegliche Objekte relativ schlecht. Geruchssinn sehr gut.
Lautäußerungen: Schrecken als Warnlaut, Mahnen als Kontaktlaut, Röhren (nur Hirsche) in der Brunft als Kontaktlaut und Drohgebärde, Klagelaut, hauptsächlich bei Kälbern.
Lebensweise: Hierarchische Rudelbildung; ganzjährig Kahlwildrudel aus Tieren, Kälbern, Jährlingen und gelegentlich auch 2-jährigen Hirschen; Hirsche bilden eigene Rudel, die sich vor der Brunft auflösen und später wieder finden. Teilweise saisonale Wanderungen, nicht territorial.
Ursprünglich und wo heute noch möglich weitgehend tagaktiv, in den meisten Rotwildgebieten jedoch vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Stellt sich im Sommer habitatabhängig auch im Feld (Raps, Getreide) ein.
Fortpflanzung: Geschlechtsreife mit 16−18 Monaten; Brunft Mitte September bis Mitte Oktober, Dauer etwa 3 bis 4 Wochen; Tragzeit 34 Wochen, 1 Kalb, sehr selten 2; Setzzeit mehrheitlich im Juni; Säugedauer rund 6 Monate.
Nahrung: Intermediärtyp – Gräser und Kräuter, Triebe, Knospen, Blätter, Nadeln, Rinde, Hackfrüchte, reifendes Getreide, Raps, Erbsen; Nahrungsaufnahme wenig selektiv.
Geweihzyklus: Geweihabwurf Ende Februar/März, Hirsche vom 1. Kopf April/Mai. Geweihaufbau etwa 140−170 Tage.
Zahnformel:
Verbreitungsgebiet
Äsung: Ursprünglich bewohnte unser Rotwild Baumsavannen. Beim Äsen nutzt es daher als Intermediärtyp den Gras- und Kräuteraufwuchs offener Flächen. Im Wald besteht seine Äsung daneben auch aus Trieben von Laub- und Nadelhölzern, Pilzen und Waldfrüchten aller Art, wie Eicheln, Bucheckern, Wildobst oder Vogelbeeren. Im Felde kann Rotwild an Kartoffeln, Rüben, Mais, Hafer und Erbsen zu Schaden gehen. In Notzeiten verbeißt es vermehrt Laub- und Nadelholzkulturen. Durch Abschälen von Rinde junger Waldbäume (Sommer- und Winterschälung) sind erhebliche und nachhaltige Schäden möglich.
Wie bei allen Wiederkäuern wechseln beim Rotwild Äsungs- und Wiederkäuphasen ab. Daraus ergibt sich ein Äsungsrhythmus, in dem mehrmals täglich Perioden der Äsungssuche mit Ruhezeiten abwechseln. Wo Rotwild durch menschliche Störungen an dieser Periodik gehindert wird, kommt es zu Verhaltensänderungen (Umstellung zum Nachttier), zu gesundheitlichen Schäden im Verdauungstrakt und vermehrten Wildschäden.
Der Rothirsch ist biologisch erst ab dem 12. Kopf jagdbar – und dann im Alter sicher anzusprechen.
Sinne und Lautäußerungen: Rotwild hört (vernimmt) und riecht (windet) sehr gut. Obwohl es auch gut sieht (äugt), werden unbewegte Objekte schlecht erkannt (Bewegungsseher). Beide Geschlechter – führende Alttiere am häufigsten – schrecken mit tiefem, weithin hallendem Warnlaut, wenn sie überraschend gestört werden. Der Kontaktlaut zur gegenseitigen Stimmfühlung im Rudel, besonders zur Verständigung zwischen Muttertier und Kalb sowie als Locklaut zur Brunft ist das Mahnen, ein leiser, nasaler Laut. Während der Brunftzeit schreit, orgelt oder röhrt der meldende Hirsch in unterschiedlicher Intensität und Klangfärbung. Als Platzhirsch fordert er Nebenbuhler mit dem Kampfruf heraus; ebenso herausfordernd meldet der suchende Hirsch. Müde niedergetan brummt, knört oder trenzt der Brunfthirsch. Beim Treiben eines brunftigen Tieres oder beim Verfolgen eines Rivalen ertönt der abgehackte Sprengruf. Rotwild klagt selten (schreiender Schmerz- und Angstlaut, vor allem Jungwild bei Verletzungen).
Haarwechsel: Das Rotwild verfärbt im September/Oktober, die jüngeren Stücke früher als die älteren. Das Winterhaar ist dunkelgraubraun, länger und mit dichter Unterwolle; der Hirsch trägt seine Winterhaar (Brunftmähne) bis zum Haarwechsel im Frühjahr. Im Mai ist der Haarwechsel beendet, das Rotwild trägt dann sein rotbraunes, kurzes Sommerhaar.
Bezeichnungen am Hirschgeweih
Das Geweih: Beim männlichen Kalb (Hirschkalb) entwickeln sich gegen Ende des 1. Lebensjahres die knöchernen Stirnzapfen (Rosenstöcke). Zu Beginn des 2. Lebensjahres (jetzt Schmalspießer) entstehen als Erstlingsgeweih (Geweih vom 1. Kopf) meist einfache Spieße, die im Herbst (September/Oktober) gefegt werden. Nur bei besonders guter Entwicklung können Spießer vom 1. Kopf bereits Augsprossen tragen oder oben in 2 oder 3 Enden geteilt sein (Gabelspießer bzw. Kronenspießer). Immer fehlen dem Erstlingsgeweih die Rosen.
Die Spieße werden im folgenden Frühjahr (April/Mai, Ende des 2. Lebensjahres) abgeworfen. Nach dem Abwurf baut sich auf den Rosenstöcken das neue Geweih (vom 2. Kopf) auf. Bei sehr schlechter Entwicklung können es wieder nur Spieße (jetzt mit Rosen!) oder ein Gabelgeweih (mit Augsprossen) sein; normal ist ein Sechser- oder Achtergeweih. Es wird nun (im 3. Lebensjahr) im August gefegt und danach im März abgeworfen, worauf sich das Geweih vom 3. Kopf bildet und so weiter. Hirsche ab dem 5. oder 6. Kopf sind körperlich ausgereift.
Die älteren Hirsche werfen in ihrer Mehrzahl im März ab (je älter, umso früher, manche schon Ende Februar). Nicht selten fallen beide Stangen zugleich ab, häufiger jedoch in einem Abstand von bis zu 24 Stunden und mehr. Das kolbenartig heranwachsende neue Geweih (Kolbengeweih) ist während des Aufbaues weich und von einer samtweichen, silbrig glänzenden Nährhaut (dem Bast) überzogen, die mit fortschreitender Geweihreife von unten beginnend nachdunkelt, bis sie schließlich am fertigen Geweih eintrocknet und vom Hirsch durch Fegen an Sträuchern oder Stämmchen abgestreift wird. Das jetzt hervortretende, fertig verknöcherte Geweih ist anfangs fast farblos, verfärbt sich aber unter dem Einfluss von Pflanzensäften beim Fegen rasch braun bis dunkelbraun, wobei die Endenspitzen durch weiteres Schlagen hell poliert werden. Der Aufbau eines neuen Geweihs dauert beim erwachsenen Hirsch rund 140 Tage. Gefegt wird das Geweih der älteren Hirsche in der zweiten Julihälfte. Der Geweihzyklus wird, beginnend mit dem Abwurf, von Hormonen gesteuert. Die Hormonausschüttung wird durch das Licht-/Dunkelheits-Verhältnis ausgelöst.
Die Oberfläche der Geweihe ist durch Längsrillen strukturiert, in denen während der Geweihbildung Blutgefäße verlaufen. Körnige Unebenheiten (Perlung) sind luxurierende Merkmale, die bei einzelnen Hirschen unterschiedlich ausgeprägt sein können.
Ein Geweih besteht aus den beiden Stangen, die jeweils mit der Rose, der wulstigen Verdickung rings um das untere Ende der Geweihstange, auf den Rosenstöcken sitzen. An der Stange unterscheiden wir in der Regel 3 Sprossen: von unten nach oben die (meist besonders kräftige) Augsprosse, darüber (in der Regel schwächer, oft nur angedeutet, bei manchen Rothirschen zeitweilig oder stets fehlend) die Eissprosse und etwa in Stangenmitte die Mittelsprosse. Oben läuft die Stange entweder in einer einfachen Spitze aus oder sie endet mit einer Gabel (in 2 Enden geteilt) oder mit einer Krone (3 und mehr Enden). Bezeichnet werden Rothirschgeweihe nach der Zahl der Enden. Die Endenzahl der endenreichsten Stange wird verdoppelt: Ein gerader Zwölfender z. B. hat an jeder Stange 6 Enden; ein ungerader Zwölfer nur an einer Stange 6, an der anderen weniger Enden. Die Endenzahl ist kein Altersmerkmal! Wenn auch junge Hirsche meist endenärmere Geweihe (Spieße, Gabeln, Sechser, Achter) tragen, können grundsätzlich fast alle Endenzahlen in jedem Alter auftreten. Mehr verraten die Stärke (Masse) und Form (Länge, Schwung, Auslage) des Geweihes und seine Proportionen über das Alter. Mit etwa 11−13 Jahren trägt der Hirsch sein stärkstes Geweih. Noch ältere Hirsche setzen zurück, d. h., ihr Geweih verliert an Zahl der Enden, an Masse, Gewicht und Stangenlänge. »Hirschgreise« tragen nicht selten nur noch Geweihstümpfe. Durch Erbdefekt geweihlose Hirsche (selten) heißen Mönch oder Plattkopf. Geweihmissbildungen sind in der Regel auf Verletzungen während der Geweihbildungsphase zurückzuführen.
Die Geweihe dienen den Hirschen als Blickfang zum gegenseitigen Erkennen und Imponieren. Im spielerischen Kräftemessen (Scherzen) wird schon während der Feistzeit die Rangordnung in Hirschrudeln hergestellt. Zu ernsthaften Geweihkämpfen (Forkeln) kommt es in der Brunft zwischen ebenbürtigen Rivalen. Dabei kann es zu Verletzungen kommen, die gelegentlich auch tödlich sind. Todesfälle entstehen auch durch unlösbares gegenseitiges Verklemmen der Geweihe (Verkämpfen) oder durch Verstricken in Draht. Geweihe werden auch als Verteidigungswaffen gegen Angreifer (z. B. Wölfe) eingesetzt.
Mögliche Geweihentwicklung beim Rothirsch (schematisch)
Die abgeworfene Einzelstange nennt man Abwurfstange, beide zusammen den Abwurf (Passstangen). Die Abwurffläche an der Stangenbasis heißt Petschaft. Nach dem Abwerfen bis zum Fegen erheben sich die Hirsche bei Auseinandersetzungen auf die Hinterläufe und schlagen mit den Vorderläufen auf den Gegner ein (Rangordnungskampf). Auch weibliches Wild zeigt dieses Verhalten.
Augsprosse
Kolben mit Augsprossen
Bastgeweih
Frisch gefegtes Geweih
Fortpflanzung: Die Brunftzeit dauert 3−4 Wochen, etwa von Mitte September bis Mitte Oktober. Kalte Nächte steigern den Brunftbetrieb und lassen die Hirsche lebhafter melden. In warmen Nächten dagegen läuft der Brunftbetrieb auffallend still ab. Ein Platzhirsch kann in diesen Wochen 15−20 kg an Gewicht verlieren, da er kaum Äsung aufnimmt und in dieser Zeit größtenteils von den in der Leber gespeicherten Energiereserven und von seinem Speicherfett (Feist) lebt.
In natürlich gegliederten Rotwildbeständen bemühen sich Hirsche ab dem 5./6. Kopf um ein Brunftrudel. Als Platzhirsch (Haremshalter) versucht er das Rudel zusammenzuhalten und ausbrechende Stücke zurückzutreiben. Andererseits muss er Rivalen durch Imponieren und Röhren optisch und akustisch abwehren. Stoßen gleichrangige Hirsche aufeinander, kommt es zum Kampf um das Rudel. Das einzelne Alt- oder Schmaltier ist nur 2−3 Tage brunftig. Nur in dieser Zeit lässt es den Beschlag zu. Äußeres Zeichen der Paarungsbereitschaft bei den weiblichen Tieren ist der angehobene, waagerecht getragene Wedel. Der Platzhirsch kontrolliert die Paarungsbereitschaft seiner Tiere geruchlich. Findet er ein brunftiges Stück, so wird es für kurze Zeit getrieben und dann beschlagen. Die Brunft ist für den Platzhirsch sehr energieaufwendig. Daher stehen häufig zum Ende der Brunft jüngere Hirsche bei den Rudeln, die der erschöpfte Platzhirsch verlassen hat. Es beschlägt also nicht nur der stärkste Hirsch. Mitunter kommt es zu einer Nachbrunft bis in den Dezember, wenn ein Tier ausnahmsweise spätbrunftig wird oder in der Hauptbrunftzeit nicht erfolgreich befruchtet wurde.
Weibliches Rotwild wird im 2. Lebensjahr geschlechtsreif (Schmaltier). Schmaltiere, die in ihrer ersten Brunft noch nicht beschlagen werden, heißen »übergehendes Schmaltier«. Übergehende Schmaltiere finden wir in der Regel nur in klimatisch ungünstigen Regionen mit knappen Futterressourcen.
Die Tragzeit beträgt 34 Wochen (rund 8 1⁄2 Monate). Die Setzzeit fällt im Wesentlichen in den Juni. 1 Kalb ist die Regel, 2 kommen nur ausnahmsweise vor. Das Muttertier legt sein Kalb in den ersten Wochen fast immer außerhalb des eigenen Einstandes ab. Die Kälber sind in den ersten Monaten gelblich gefleckt und verfärben im Spätsommer als Erste in das dunkle Winterhaar. Die Geschlechter der Kälber sind schwer zu unterscheiden. Starke Hirschkälber können im Herbst allerdings bereits einen dickeren Kopf (die Rosenstöcke deuten sich an!) und einen dunkleren, etwas dichter behaarten Hals (Träger) aufweisen.
Kämpfe finden nur zwischen annähernd gleichrangigen Hirschen statt.
Im Rudel bestimmt der Rang der Mutter auch die soziale Stellung des Kalbes. Es wird bis in den Winter gesäugt. Verwaiste Kälber werden aus dem Rudel verstoßen und bleiben in der Entwicklung zurück (kümmern, gehen im Winter ein).
Der Platzhirsch treibt das Rudel zusammen und hält Rivalen auf Distanz.
Das Alttier setzt in der Regel 1 Kalb, sehr selten 2.
Gebiss: Rotwild besitzt das charakteristische Wiederkäuergebiss. Abweichend vom Grundbauplan sind die Eckzähne im Oberkiefer beim Rotwild als sogenannte »Grandeln« vorhanden. Dagegen sind die Eckzähne im Unterkiefer zum Schneidezahnbogen vorgerückt und haben Form und Funktion eines 4. Schneidezahns. Die Reihe der Backenzähne besteht aus je 3 Prämolaren und Molaren in jeder Kieferhälfte.
Die Schneidezähne des Milchgebisses brechen beim Rotwildkalb bald nach dem Setzen durch. In den folgenden 4 Wochen erscheinen die vorderen 3 Prämolaren in jeder Kieferhälfte und 2 Milchhaken (Grandeln) beiderseits im Oberkiefer. Der 3. untere Milchbackenzahn ist dreiteilig. Bis zum 14. Lebensmonat erscheinen der 4. und 5. Backenzahn (= 1. und 2. Molar) im Ober- und Unterkiefer. Molaren haben keine Milchzahnvorläufer. Zwischen dem 17. und 27. Monat werden die Milchschneidezähne durch Dauerzähne ersetzt. Zwischen dem 23. und 27. Lebensmonat wechselt das Rotwild die Prämolaren. Der 3. Backenzahn im Unterkiefer ist im Dauergebiss zweiteilig. Mit dem Erscheinen des hintersten Molars (M3) ist das Dauergebiss bis zum 32. Lebensmonat vollständig. Die Milchhaken werden zwischen dem 16. und 18. Monat gewechselt. Die Molaren sind stets zweiteilige Zähne, M3 trägt darüber hinaus häufig eine einteilige Anhangsäule, wodurch der Zahn dreiteilig erscheint.
Die Zahnformel des Dauergebisses lautet:
Diese Zahnformel gilt (mit Ausnahme der bei anderen Arten fehlenden Grandeln) für alle Wiederkäuer (= 32 Zähne).
Altersbestimmung: Beim lebenden Rotwild liefern das Verhalten, der Körperbau (die Figur) und beim Hirsch zusätzlich das Geweih wesentliche Altershinweise.
Altersmerkmale im Körperbau
Beim weiblichen Rotwild (Kahlwild) wird die Unterscheidung von Kalb, Schmaltier und Alttier durch die Vergleichsmöglichkeit im Rudel erleichtert. Verwechslungen im Frühwinter zwischen einem geringen Schmaltier und einem starken Kalb sind möglich. Führende Alttiere kann man im Sommer (Mai bis Juli) bei Sicht spitz von hinten am prallen Gesäuge sicher erkennen. Hirsche vom 1. und 2. Kopf stehen in der Regel noch beim weiblichen Wild. Hirsche dieser Altersstufe sind sicher nach ihrem Gebäude als Junghirsche anzusprechen. Spätestens vom 3. Kopf an trägt der Hirsch von Anfang September bis zum Haarwechsel im Frühjahr eine Mähne. Vom 4. Kopf an tritt das typische Hirschgebäude deutlich hervor. Das Haupt wird stumpfer und wirkt nicht mehr so jugendlich. Das Schwergewicht des Rumpfes beginnt sich nach vorn zu verlagern. Mit dem 7. Kopf tritt der Widerrist deutlich hervor, das Haupt wird mehr waagerecht getragen, das Gesicht wirkt bullig. Der Bauch (die Bauchlinie) ist nicht mehr zu übersehen, ein Senkrücken deutet sich an.
Am erlegten Wild ist eine Schätzung des Alters nach dem Grad der Abnutzung der Backenzähne möglich. Solange der Zahnwechsel noch nicht abgeschlossen ist (30.−32. Lebensmonat), lässt sich das Alter exakt nach dem Zahnstatus bestimmen. Danach ist der Jäger auf mehr oder weniger genaue Zahnalterschätzungen angewiesen.
Die vom Zahnschmelz überzogene Zahnkrone wird mit zunehmendem Alter mehr und mehr abgeschliffen. Auf der Kaufläche schwindet der Schmelz und das Zahnbein (Dentin) wird sichtbar. Da es sich bei den Backenzähnen um schmelzfaltige Zähne handelt, die im mittleren Bereich der Kaufläche durch taschenförmige, mit Schmelz ausgekleidete Vertiefungen (Kunden) gekennzeichnet sind, entsteht eine strukturierte Zahnoberfläche. Diese ist durch höher stehende, extrem harte Schmelzleisten und durch vertiefte, sich unterschiedlich braun färbende Dentinflächen charakterisiert. Durch den permanent erfolgenden Zahnabrieb wird die Tiefe der Kunden reduziert, ein Vorgang, der bis zum völligen Schwinden dieser taschenförmigen Vertiefungen führt. Je stärker der Abschliff fortgeschritten ist, umso älter ist das betreffende Stück.
Da Zähne genetisch bedingt unterschiedliche Härtegrade aufweisen, kann die Altersbestimmung nach dem Zahnabrieb immer nur eine Schätzung sein. Die Altersschätzung nach dem Zahnabrieb genügt zur Altersfestlegung jung, mittel – oder alt. Mit wissenschaftlichen Methoden lässt sich das Alter auch durch die Untersuchung einzelner Zähne feststellen. Dabei werden, je nach Methode, ein Schneidezahn oder ein Molar aufgesägt, die Fläche glatt geschliffen und unter dem Mikroskop die Ersatz-Dentinschichten oder die Ersatz-Zementzonen als Jahresringe gezählt. In der Regel werden die besten Alterseinschätzungen durch Auszählen der Ersatz-Zementauflagerungen an der Wurzel der Zange (I1) erzielt. Bei diesem Verfahren muss der Zahn entkalkt, histologisch aufgearbeitet und die Wurzel in 50 µm starke Querschnitte aufgeschnitten werden. In den mit Methylenblau gefärbten Schnitten sind die Zementauflagerungen ähnlich den Jahresringen in einer Baumscheibe auszählbar.
Zehe mit Schalen und Geäfter eines Rothirschlaufes
Fährte: Die Fährte besteht aus den Abdrücken (Trittsiegeln) der Schalen während der Fortbewegung. Das Trittsiegel vom Tier ist geringer als das des Hirsches. Die Spitzen sind abgestumpft und heißen »Stümpfe«, die beim Hirsch stärker abgerundet sind als beim weiblichen Wild. Jungwild, Kahlwild und Hirsche haben, je nach Körperstärke, eine unterschiedliche Schrittweite. Der seitliche Abstand der Tritte beider Körperhälften heißt »Schrank« (der Hirsch »schränkt« – am stärksten der beleibte Feisthirsch). Die altüberlieferten »hirschgerechten Fährtenzeichen« ermöglichen das Ansprechen einzelner Hirsche nach Besonderheiten im Fährtenbild: »Übereilen« (wenn der Hinterlauf vor dem Tritt des Vorderlaufs aufgesetzt wird), »Hinterlassen« (wenn der Hinterlauf zurückbleibt), »Beitritt« (Hinterlauf tritt neben dem Vorderlauf auf), »Kreuztritt« (Hinterlauf-Trittsiegel überdeckt den Vordertritt teilweise) und Ähnliches. Im heutigen Jagdbetrieb haben diese Zeichen kaum mehr praktische Bedeutung.
Losung: Sie besteht während der meisten Zeit des Jahres aus Kotbeeren, die bei beiden Geschlechtern durch Näpfchen und Zäpfchen lose miteinander verbunden sind (s. >). Die Losung des weiblichen Wildes ist geringer als die der Hirsche, die des Feisthirsches ist oft fladenförmig. Die Losungsbeeren des Brunfthirsches sind auffallend klein und erscheinen durch extremen Wasserentzug wie »verkümmert«. Ursächlich hierfür ist die äußerst geringe Nahrungsaufnahme des Brunfthirsches.
75 | Bevorzugt Rotwild geschlossene Wälder oder offene Landschaften?
Rotwild bevorzugt offene Lebensräume (ursprünglicher Lebensraum: Baumsavanne). Es wurde erst in den letzten Jahrhunderten in den Wald gedrängt.
76 | Was sind Rotwildgebiete?
Von den Behörden ausgewiesene Gebiete, in denen Rotwild ständig vorkommt.
77 | Was sind Rotwildrandgebiete?
Regionen, in denen Rotwild nur in geringer Zahl oder nur zu bestimmten Jahreszeiten vorkommt.
78 | Wie schwer wird Rotwild (aufgebrochen) bei uns?
• Weibliches erwachsenes Rotwild bis 90 kg
• Männliches erwachsenes Rotwild bis 160 kg
• Schmaltiere bis 60 kg
• Schmalspießer bis 70 kg
• Kälber bis 50 kg
• Rotwild in klimatisch ungünstigen Lebensräumen ist in der Regel schwächer als solches in günstigen Bereichen.
79 | Gehört das Rotwild zu den Schlüpfern oder zu den Läufern?
Rotwild gehört zu den Läufern.
80 | Welche Sinne sind besonders gut entwickelt?
Geruchssinn, Gehör, Sehen, d. h., Rotwild windet sehr gut, vernimmt sehr gut, äugt gut (= Bewegungswahrnehmungen).
81 | Welche anatomische Struktur ist für den Gehörsinn von Bedeutung?
Große, bewegliche Lauscher, die als Auffangtrichter wirken.
82 | Welche wichtigen Hautdrüsen hat das Rotwild?
1. Voraugendrüse, 2. Laufbürste (oben außen am Mittelfuß des Hinterlaufs), 3. Wedelorgan, 4. bei männlichen Tieren Vorhautdrüsen.
83 | Wie viele Schneidezähne hat das Rotwild im Oberkiefer?
Grundsätzlich fehlen die Schneidezähne im Oberkiefer.
84 | Wann ist das Gebiss des Rotwildes komplett?
Ab dem 30.−32. Lebensmonat ist das Dauergebiss vollständig.
85 | Welcher Zahn erscheint zuletzt?
Der 3. Molar, M3.
86 | Welche Lautäußerungen kommen beim Rotwild vor?
Mahnen (nasaler Laut), Schrecken (tiefes, rollendes Bellen) sowie die Brunftlaute des Hirsches. Kälber klagen gelegentlich bei Schmerzen.
87 | Welche unterschiedlichen Schreie (Rufe) kennen wir beim Rothirsch?
Laute Rufe: Röhren, Schreien, Orgeln, Sprengruf; leise Rufe: Trenzen, Knören
88 | Wann werfen die Hirsche ab?
In den Monaten Februar bis April.
89 | Wie werden die Hirsche zwischen Geweihabwurf und Fegen genannt?
Kolbenhirsch, Basthirsch.
90 | Wie lange dauert der Aufbau des Hirschgeweihs?
Der Geweihaufbau dauert ca. 5 Monate.
91 | Was ist der Bast?
Silbrig glänzende, mit samtartigen Härchen besetzte und mit vielen Hautdrüsen versehene Ernährungshaut des heranreifenden Geweihs.
92 | Wann schiebt der Hirsch sein erstes Geweih?
Beim Hirschkalb bilden sich am Ende des Geburtsjahres knöcherne Stirnbeinzapfen (Rosenstöcke), auf denen sich zu Beginn des nachfolgenden Jahres (= etwa 8 Monate alt) das Erstlingsgeweih in Form von rosenlosen Spießen entwickelt.
93 | Wie alt ist ein Spießer?
Spießer mit gefegten Spießen sind 15−16 Monate alt (Geweih vom 1. Kopf).
94 | Wann fegen die Schmalspießer?
Ende September bis Oktober des auf die Geburt folgenden Jahres.
Schmalspießer – keine Rosen (Plusvariante)
95 | Wann werfen die Schmalspießer ab?
Sie werfen im April, gelegentlich erst im Mai ab.
96 | Was ist ein Kolbenhirsch?
Ein im Anfangsstadium der Geweihbildung stehender Hirsch.
97 | Was ist ein Kronenhirsch?
Ein Hirsch mit mindestens 3 das Geweih abschließenden Enden oberhalb der Mittelsprosse.
98 | Was ist ein ungerades Geweih?
Ein Geweih mit unterschiedlicher Endenzahl der beiden Stangen.
99 | Was versteht man unter Zurücksetzen?
Altersbedingte Abnahme der Geweihstärke, Reduktion der Enden, Verkürzung der Stangen.
100 | Was sind brandige Enden?
Poröse, stumpfe, leicht aufgetriebene, wie abgebrochen erscheinende Enden der Stangen oder Sprossen eines Geweihs.
101 | Was ist ein Plattkopf?
Ein zeitlebens geweihlos bleibender Hirsch (auch Mönch genannt). Rosenstöcke sind nur rudimentär ausgebildet und heben sich unter der Decke nicht ab. Wahrscheinlich ein genetischer Defekt.
102 | Was sind Passstangen?
Beide von einem Geweih stammende abgeworfene Stangen.
103 | Was versteht man unter Demarkationslinie?
Rillenförmige, zirkuläre Vertiefung am Rosenstock, die die Abwurflinie außen markiert. Entsteht durch knochenauflösende Zellen, die den Rosenstock gegen die Stange abtrennen.
104 | Was ist die Petschaft?
Die Basis der abgeworfenen Stange unterhalb der Rose, entspricht der Trennfläche zwischen Rosenstock und Stange.
Ein wirklich alter Hirsch
105 | Wie wird das Alter eines Hirsches bezeichnet?
Nach der Zahl der von ihm getragenen Geweihe werden Hirsche als solche vom 1., 2., 3. Kopf usw. bezeichnet.
106 | Welche Geweihstufe erreicht der Hirsch vom 1. Kopf in der Regel?
Der Hirsch vom 1. Kopf trägt in der Regel Spieße ohne Rosen. Daher die Bezeichnung als Schmalspießer.
107 | Woran erkennt man einen jungen Hirsch?
Im Wesentlichen am Körperbau, der in seinen Proportionen unfertig wirkt. Langes Haupt, schlanker, aufrecht getragener Träger, Körpermassen in etwa gleichmäßig verteilt.
108 | Kann ein Hirsch vom 3. Kopf schon beidseitig Kronen tragen?
Ja.
109 | Lässt sich aus der Endenzahl auf das Alter schließen?
Nein.
110 | Wie schaut ein wirklich alter Hirsch aus?
Große Körperkontur mit augenfälliger Verlagerung der Körpermasse nach vorne. Bei annähernd waagerechter Trägerhaltung scheinen die Vorderläufe mittig des Tierkörpers zu stehen. Kurzes, bulliges Haupt, stark ausgeformte Wamme, deutlicher Widerrist, Senkrücken, sehr stumpfer Keulenwinkel, häufig starke Stirnlockenbildung, starkstangiges Geweih, dessen Masse unten liegt.
111 | Wie erkennt man bei Kälbern im Herbst das Geschlecht?
Die Unterscheidung ist schwierig, Hirschkälber tragen gelegentlich eine angedeutete Mähne, ihr Haupt wirkt durch die Ausbildung der Rosenstöcke vergleichsweise kürzer und runder.
Kleinstrudel: Alttier, Kalb (vorne), Schmaltier (v.r.n.l.)
112 | Wie unterscheiden wir das starke Kalb vom schwachen Schmaltier?
Zur Unterscheidung bietet sich die Kopfform an, die beim Schmaltier länger und flacher erscheint, während das Haupt des Kalbes durch die noch gewölbte Stirn rundlicher erscheint. Die Unterscheidung ist schwierig.
113 | Wie unterscheiden wir das starke Schmaltier vom Alttier?
Das Schmaltier zeigt einen jugendlichen Gesichtsausdruck, ihm fehlt ein sichtbares Gesäuge (Unterscheidungsmerkmal im Sommer), seine Bauchlinie ist gerade. Dadurch wirkt es vergleichsweise hochläufiger. Vorsicht beim Schmaltierabschuss im Mai und Juni!
Der »Schrank« – Abstand der Tritte beider Körperhälften
114 | Was ist der Schrank?
Unter Schrank versteht man den Abstand der Trittsiegel der Läufe der rechten und linken Körperhälfte. Je breiter der Körper des Hirsches ist (je mehr Bauch er hat), umso größer ist der Schrank. Bei jungem Rotwild formt die Reihe der Trittsiegel im Schritt eine annähernd gerade Linie.
115 | Wie wird die Schrittlänge gemessen?
Der Abstand der einzelnen Tritte voneinander wird von Schalenspitze (von den Stümpfen) zu Schalenspitze gemessen.
116 | Welche meldepflichtige Seuche kann beim Rotwild auftreten?
Die Aujeszky’sche Krankheit (Pseudowut) ist eine meldepflichtige Erkrankung des Rotwildes, die durch heftigsten Juckreiz charakterisiert ist und die Tiere zu permanentem Scheuern zwingt (Differenzialdiagnose: Tollwut). Empfänglich ist Rotwild auch für die anzeigepflichtigen Krankheiten Tuberkulose, Maul- und Klauenseuche, Tollwut und Milzbrand.
117 | Welche bewegungsauffällige Krankheit ist typisch für das Rotwild?
Die Kreuzlähme (endemische Parese, spinale Ataxie). Die Ursachen dieser als »Schleuderkrankheit« bezeichneten Erkrankung, die zwischenzeitlich auch bei Dam-, Sika- und Elchwild sowie bei Weißwedelhirschen beobachtet wurde, sind noch nicht geklärt.
118 | Welche Ektoparasiten finden sich auf und in der Decke des Rotwildes?
Hirschläuse, Zecken, Hautdassellarven und Rachendassellarven.
119 | Welche Endoparasiten kommen beim Rotwild hauptsächlich vor?
Magen-Darm-Nematoden, regional Großer Leberegel, Lungenwürmer, Bandwurmlarven (= Finnen)
120 | Kann Rotwild an Tollwut erkranken?
Ja.
121 | Welchem Äsungstyp gehört das Rotwild an?
Rotwild ist ein Mischäser. Es deckt seinen Nahrungsbedarf durch eine Mischung aus Gras, Kräutern, Laub und jungen Strauch- und Baumtrieben.
122 | Wie viele Äsungsintervalle hat das Rotwild?
Innerhalb von 24 Stunden wechseln beim Rotwild mindestens 5 Futteraufnahmen mit 5 Wiederkäuphasen ab.
123 | Wie reagiert das Rotwild, wenn es an regelmäßiger Aufnahme artgerechter Nahrung gehindert wird?
Durch Schälen junger Bäume in den Einständen. Pansenerkrankungen sind bei anhaltenden Äsungsstörungen möglich.
124 | Wie unterscheidet sich der Verbiss des Rotwildes an der Waldverjüngung von dem der Rehe?
Rehe verbeißen nur den Spitzenbereich von Zweigen und Trieben und wechseln dabei häufig den Standort. Rotwild verbeißt Pflanzen zum Teil vollständig.
125 | Wie reduziert das Rotwild seinen Nahrungsbedarf im Winter?
Durch Reduktion der resorbierenden Pansenoberfläche und durch Herabsetzen der Aktivitäten (großes Ruhebedürfnis im Winter). Hierdurch erhebliche Drosselung des Gesamtstoffwechsels.
126 | Welche Hegemaßnahmen kommen dem Äsungsbedürfnis des Rotwildes entgegen?
Ruhezonen und störungsfreie Äsungsflächen.
127 | Ist Rotwild tag- oder nachtaktiv?
Rotwild war tagaktiv, ist durch menschliche Aktivitäten einschließlich der Jagd zum dämmerungs- und nachtaktiven Tier geworden.
128 | Was versteht man unter Äsungsintervall?
Die Zeit zwischen Äsungsaufnahme und Wiederkäuruhephase.
129 | Wie lebt das Rotwild?
Kahlwild in Rudeln, die aus Familienverbänden als kleinste soziale Einheit gebildet werden. Hirsche vom 1. und 2. Kopf sind häufig mit diesen Rudeln vergesellschaftet.
130 | Wer führt ein Kahlwildrudel an?
Das Kahlwildrudel wird immer von einem führenden Alttier als Leittier angeführt.
131 | Was ist ein Gelttier?
Ein in der Regel aus Altersgründen (Senilität) nicht mehr führendes Alttier.
132 | Was ist ein übergehendes Schmaltier?
Ein als Schmaltier nicht beschlagenes, im 3. Lebensjahr stehendes Tier. Kann in klimatisch ungünstigen Rotwildgebieten (Gebirge) oder bei überhöhter Wilddichte vorkommen.
133 | Wie leben Hirsche im Sommer?
Junge und mittelalte Hirsche bilden Hirschrudel, alte Hirsche sind Einzelgänger oder ziehen zusammen mit einem oder zwei jüngeren Hirschen, sogenannten Adjutanten. Ältere Hirsche treten nur in der Brunft zum Rudel.
134 | Welche Körperpflege betreibt Rotwild?
Rotwild suhlt, wobei Suhlen mit höherem Wasserstand reinen Schlammsuhlen vorgezogen werden. Rotwild steht im Sommer gern in bauchhohem Wasser.
135 | Was ist eine Suhle?
Eine Suhle ist eine natürliche oder künstlich erstellte Bodenvertiefung, in der Wasser steht und deren Untergrund schlammig ist.
Rothirsch in der Suhle
136 | Verteidigen Hirsche ein Revier?
Hirsche sind nicht territorial, sie verteidigen kein Revier.
137 | Woran orientiert sich die Rangstellung eines Hirsches?
Die Rangordnung in den Hirschrudeln verändert sich im Jahreslauf. Ausschlaggebend sind dabei Alter, Stärke des Geweihs, Masse und Größe, Aggressivität und Kampferfahrung.
138 | Wann gilt ein Hirsch als wirklich »reif«?
Mit dem 12. Kopf und älter.
139 | Wann findet die Hirschbrunft statt?
September bis Anfang Oktober mit Höhepunkt in der 2. Septemberhälfte. Regionale Zeitverschiebungen, vornehmlich nach hinten, sind möglich.
140 | Was ist ein Platzhirsch?
Der Platzhirsch beherrscht in der Brunft ein Rudel.
141 | Was sind Beihirsche?
Jüngere Hirsche, die sich in der Nähe des Brunftrudels aufhalten.
142 | Wie verhält sich der Platzhirsch in der Brunft?
Er hält das Brunftrudel zusammen, hält Beihirsche auf Distanz (meist genügt Imponieren) und beschlägt die brunftigen Stücke.
143 | Welchen Ruf hören wir, wenn der Platzhirsch sein Kahlwild zurücktreibt oder einen abgeschlagenen Gegner verfolgt?
Den Sprengruf, ein kurzer, abgehackt klingender, einsilbiger Ton.
144 | Was ist ein Brunftplatz?
Ein von Kahlwild etablierter, mehr oder weniger offener Platz, der alljährlich wieder aufgesucht wird. Hier stellen sich Brunftrudel und suchende Hirsche Anfang September ein.
145 | Was ist eine Brunftkuhle?
Eine vom Brunfthirsch mit den Läufen geschlagene Bodenvertiefung, der eine intensive Brunftwitterung anhaftet.
146 | Was ist ein Brunftfleck?
Eine schwarze Verfärbung der Decke vor und seitlich des Pinsels, der durch Erregungsnässen, Ejakulationen und den Sekreten der Vorhautdrüsen (Pinseldrüsen) entsteht und dessen intensive Brunftwitterung von den Geschlechtspheromonen (innerartliche Botenstoffe) herrührt.
147 | Was geht einem Brunftkampf voraus?
Junghirsche werden direkt attackiert und verjagt. Gleichrangige Hirsche röhren sich zunächst gegenseitig an (sogenanntes Ausröhren), danach folgen – gelegentlich bis zu 30 Minuten andauernde – Parallelmärsche, in denen sich die Rivalen fixieren und gegeneinander zu imponieren versuchen. Erst danach folgen direkte Kämpfe, die zwar als Kommentkampf (ritualisierter Kampf) ausgeführt werden, aber durchaus einen gefährlichen Verlauf nehmen können.
148 | Welche Technik liegt dem Brunftkampf zugrunde?
Im Brunftkampf werden die Geweihe gebunden; der Kampf selbst ist ein Schiebekampf.
149 | Was hat die Brunftmähne mit der Brunft zu tun?
Die Brunftmähne (Winterhaar) lässt den Hirsch größer erscheinen. Sie stellt auch einen Schutz gegenüber Forkelverletzungen dar.
150 | Was geschieht mit dem Alttier, das nicht fruchtbar beschlagen wurde?
Ein nicht fruchtbar beschlagenes Alttier geht in einen neuen Geschlechtszyklus, der beim Rotwild in der Zeit von September bis Mitte Dezember alle 18 Tage periodisch wiederkehrt, wenn eine Befruchtung der Eizelle ausbleibt. Das entspricht 6 Geschlechtszyklen im Jahr.
151 | Wie lange beträgt die Tragzeit des Rotwilds?
Rotwild trägt 34 Wochen (8 1/2 Monate).
152 | Wann setzt das Rotwild?
Die meisten Kälber werden Ende Mai bis Mitte Juni geboren.
153 | Wie viele Kälber werden geboren?
In der Regel wird ein Kalb geboren. Zwillingsgeburten sind sehr selten.
154 | Wie lange liegen die Kälber ab?
In den ersten Lebenstagen liegen die Kälber die meiste Zeit ab, folgen aber nach wenigen Tagen schon ihren Müttern und werden dann nur noch zeitweise abgelegt.
155 | Wann steht ein Alttier, das frisch gesetzt hat, wieder beim Rudel?
Das Alttier stellt sich nach ca. 2 – 3 Wochen mit seinem Kalb zum Rudel.
156 | Wie lange werden die Kälber gesäugt?
Kälber können bis zu einem Alter von einem halben Jahr gesäugt werden. Wesentlich ist die Milchernährung bis in den September.
157 | Wie unterscheiden sich die Gechlechter der Kälber?
Starke Hirschkälber können im Herbst einen dickeren Kopf und einen dunkleren Träger haben.
158 | Wie hoch ist der jährliche nutzbare Zuwachs beim Rotwild?
Der nutzbare Zuwachs beträgt 70−75 % bezogen auf den Bestand der weiblichen Tiere.
159 | Wer bestimmt im Kahlwildrudel die Flucht?
Das Leittier.
160 | Welches Stück tritt immer zuerst aus?
Das Leittier, gefolgt vom Kalb. Daher darf nie auf das erste Stück geschossen werden.
161 | Wo befinden sich die Kälber in der Regel?
Hinter ihren Müttern.
162 | Ist die Rangordnung im Rudel dauerhaft fixiert?
Das Leittier verliert seinen Rang, wenn es sein Kalb verliert. Mit steigender Rudelgröße kommt es nicht selten zu Auseinandersetzungen über die Führung des Rudels.
163 | Wie leben die Hirsche zwischen Geweihabwurf und Brunft?
Jüngere und mittelalte Hirsche in Hirschrudeln, ältere einzeln oder in Kleinrudeln.
164 | Wie tragen Kolbenhirsche Rangordnungskämpfe aus?
Durch Schlagen mit den Vorderläufen.
165 | Was ist ein Basthirsch?
Hirsche mit annähernd fertig geschobenem, aber noch nicht gefegtem Geweih.
166 | Wer lebt im Feisthirschrudel?
In Feisthirschrudeln stehen jüngere und mittelalte Hirsche zusammen.
167 | Was sind Rotwildrichtlinien?
Vorgaben der zuständigen Behörden zur Bewirtschaftung des Rotwildvorkommens.
168 | In welche Altersklassen werden Rothirsche eingeteilt?
Die Einteilung erfolgt in 1. Jugendklasse (männlich: Hirschkälber bis zum 3-jährigen Hirsch; weiblich: Kälber, Schmaltiere), 2. mittlere Altersklasse (4- bis 10-jährige Hirsche, Alttiere), 3. obere Altersklasse (männlich: ab 11 Jahren, Alttiere)
169 | Wann setzt ein Hirsch zurück?
In der Regel mit dem 14. Kopf.
170 | Kann man Hirsch und Tier sicher an der Losung unterscheiden?
Nein, die festen Kotbeeren beider Geschlechter tragen Zäpfchen und Näpfchen.
171 | Was sind Zäpfchen und Näpfchen?
Zäpfchen, konisch spitz vorragende Spitzenabschnitte der Kotbeeren, fügen sich in das Näpfchen der im Weiddarm vorgelagerten Kotperle von hinten ein.
172 | Was sind »hirschgerechte Fährtenzeichen«?
Die Summe der aus Trittsiegel und Fährte ablesbaren Zeichen, die aufgrund ihrer Besonderheiten einem bestimmten Hirsch zuzuordnen sind und an denen er individuell wiederzuerkennen ist, werden als »hirschgerechte Fährtenzeichen« bezeichnet. Sicher interessant, aber heute kaum noch von praktischem Wert.
173 | Wie unterscheiden sich gleich starke Hirsch- und Tierfährte?
Hirschfährte im Spitzenbereich immer abgerundeter, stumpfer als die des Tieres. Auch der Schrank des Hirsches ist weiter als der des Tieres.
174 | Was ist der Unterschied zwischen Trittsiegel und Fährte?
Unter Trittsiegel verstehen wir einen einzelnen Schalenabdruck; die Summe der Trittsiegel ergibt die Fährte.
175 | Wie entsteht ein Schlosstritt?
Das mitten im Rotwildbett zu findende Trittsiegel, das beim ruhigen Erheben des Hirsches aus dem Bett durch weites Unterschieben des Hinterlaufes nach vorne unter den Körper entsteht, ist der Schlosstritt.
176 | Wie schaut ein Beitritt aus?
Die Trittsiegel vom Vorder- und Hinterlauf derselben Körperseite stehen nicht in, sondern nebeneinander. Typisches Fährtenzeichen des starken Feisthirsches.
177 | Was versteht man unter Gewende?
Das Gewende (Wenden) ist ein »Himmelszeichen«, das durch Abknicken kleiner Zweige oder Abstreifen von Blättern durch das Geweih beim Ziehen durch Dickungen u. Ä. entsteht.
178 | Lassen sich Rotwildschäden grundsätzlich vermeiden?
Nein, Rotwild ist ein Pflanzenfresser. Dieser wirtschaftliche Schaden muss aber bei angepassten Populationsgrößen kein ökologischer Schaden sein.
179 | Welche Feldschäden verursacht Rotwild?
Schäden an Hackfrüchten (Zuckerrüben, Kartoffeln), an reifendem Getreide sowie im Raps, an Erbsen, Bohnen, Sonnenblumen u. a.
180 | Welche Waldschäden verursacht Rotwild?
Im Wald Schäden durch Sommer- und Winterschäle sowie durch starken Verbiss an jungen Bäumen. Hirsche verursachen Schäden durch das Schlagen mit dem Geweih (beim Verfegen oder in der Brunft – Erregungsschlagen)
118 | Wie kann man Schälschäden vorbeugen?
Durch zahlenmäßige Anpassung des Bestandes an den Lebensraum, durch Äsungsverbesserungen und – ganz wichtig – Ruhezonen, sodass dem Rotwild die Einhaltung des natürlichen Äsungsrhythmus möglich ist. Auch technische Schälschutzmaßnahmen sind möglich.