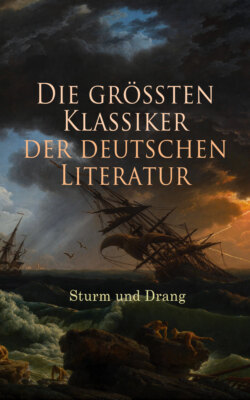Читать книгу Die größten Klassiker der deutschen Literatur: Sturm und Drang - Johann Gottfried Herder, Christian Friedrich Hebbel - Страница 126
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16.
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Jn dem Barbariſchen unſrer Sprache, in den Jnverſionen, in den Sylbenmaaßen haben wir nichts von den Franzoſen zu lernen; wir ſind vor ihnen voraus; worinn denn? in ihrer muntern Proſe, und in ihren kritiſchen Bemerkungen uͤber die Sprache.
Unſere witzige Proſe hat, nach den meiſten Buͤchern zu rechnen, noch den Ton der alten Wochenſchriften, deutlich, und bis zum Gaͤhnen deutlich zu ſeyn. Weil unſer Publikum nicht vor gar zu langer Zeit entweder ſo bloͤdſichtig war, daß es blos einen Flecken ſahe, wo andere ein fein gezeichnetes Gemaͤlde erblickten; ſo bequemten ſich die Schriftſteller nach dem Leſer. Das Buch ward das beſte, was ihnen die angenehme Ruhe ließ, im Leſen wenig zu denken, was ihnen das Vergnuͤgen ſchaffte, hie und da ein Bluͤmchen zu finden, ohne ſich beſtaͤndig buͤcken zu doͤrfen, was ſie in den ſuͤßen Traum einwiegte, das hier zu leſen, was ſie ſelbſt ſchon gedacht zu haben glaubten. Das Buͤcherſchreiben ward von Verlegern ausgepachtet, und man bequemt ſich nach dem Geſchmack ſeines Lehnherrn. Das Publikum beſtand aus einigen Journaliſten, die nicht zu denken, wohl aber zu recenſiren Zeit hatten; von dieſen ward das Publikum angefuͤhrt und gleichſam gebildet. Hier und da fand ſich ein Mecaͤn, der aber blos Arbeiten liebte, und lobte, und lohnte, die ihm nicht viel Kopfbrechens machen — nun denke man ſich dieſe Reihe von Leſern; man wird entweder die Feder aus der Hand werfen, oder man wird ſie eintunken, nicht wie jener Grieche in Verſtand, ſondern in waͤſſerichtes, Phlegmatiſches Gehirn; dies hat wie der Mond eine ſympathetiſche Einwirkung auf leere Koͤpfe. Willſt du ein Kirchenvater bei Toiletten und Ruhebetten ſeyn; entmanne deinen Stil, wie jener Origenes ſich ſelbſt, um des Himmelreichs willen: alsdenn wirſt du allen allerlei, wenn die Andachtsſeufzer ſich bei dem Leſen deiner Schriften mit dem Gaͤhnen ſatter und bequemer Zuhoͤrer vermiſchen koͤnnen. O wenn man die Stoͤße von Deutſchen Monats-und Wochenvon Lehr und Troſt-und Erbauungsund Luſtreichen Schriften ſiehet, die vormals und auch noch jetzt gelobt, geſucht und geſchmiert werden: muß man nicht ausrufen:
O curas hominum, quantum eſt in rebus inane!
Heic aliquis, cui circum humeros hyacinthina laena eſt,
Rancidulum quiddam balba de nare locutus Phyllidas, Hypſipilas, vatum et plorabile ſi quid Eliquat, et tenero ſupplantat verba palato Aſſenſere viri ‒ ‒ ecce inter pocula quaerunt Romulidae ſaturi, quid dia poemata narrent.
Daher traͤgt ein Chriſt am Sonntage, und ſo viel Baͤnde Andachten, und Erholungen und Zerſtreuungen, und Briefe, und — den Preis wegen der Deutlichkeit davon: ſie ſchreiben fuͤr die lange Weile des Publikum: ihre Buͤcher ſind alſo des Cedernoͤls und Marmorbandes werth, und auf ihrem Grabe werden, nach dem Spott des Perſius, Roſen und Violen wachſen. Jch fuͤhre keine namentlich an; ich muͤßte Aerzte, und Aufſeher und Greiſe ꝛc. auch nennen, und fuͤr dieſen Staͤnden habe ich alle gehoͤrige und moͤgliche Ehrfurcht.
Koͤnnte unſer Publikum in ſolchen Schriften denn nicht wenigſtens Franzoͤſiſch ausgebildet werden? Uns fehlen freilich witzige Aebte, Damen, die den Ton angeben, Modeſchoͤnheiten, denen man zu Gefallen, wie Carteſius ſeine Wirbel, Einfaͤlle erfinden kann! Aber das alles koͤnnte man entbehren, oder ſich anſchaffen, wenn man nur wollte; aber —
Wo bliebe alsdenn die Deutſche Gruͤndlichkeit? Ja! das hatte ich vergeſſen! Nun muß man wahrhaftig die Augenbraunen zu einer Wolke zuſammenziehen, um der Pallas nachzuahmen, wenn ſie bei den Griechen, als Erregerin des Volks erſchien
‒ ‒ γλαυκωπις Αϑηνη
Η σειουσα λαον ‒ ‒
Die Schriftſteller des ernſten Helvetiens, Sveviens, und Frankenlandes muͤſſen in dem Toil ihrer Vaterſtadt ſchreiben, und nicht wie die Menſchenkinder in ganz Deutſchland. Jn religioͤſen Geſpraͤchen, vornehmlich wenn ſie im Reiche der Todten ſind, in Spartaniſchen Betrachtungen uͤber die Lykurgiſche Geſezgebung, darf ſich der Verfaſſer freilich nur denen verſtaͤndlich machen, die ihn verſtehen ſollten (nicht wollten; hier liegts nicht an jemandes Wollen oder Laufen, ſondern am Praͤdeſtinirten Sollen). So erſcheint die Pythiße, in einer heiligen Rauchwolke: die Haare ſtraͤuben ſich: der Mund murmelt Worte, nur denen verſtaͤndlich, die ſie verſtehen ſollten:
Obſcurum verborum ambage novorum
Ter nouies carmen magico de murmurat ore.
Jndeſſen, wir arme, ungeweihete Leſer! denken, als λογωδεου μενοι uͤber dieſe Dunkelheit folgendes:
Entweder es iſt ein eigenſinniger Zwang, gruͤndlich zu ſcheinen, wie jenes Pferd die Epilepſie bekam, um ein Elendthier zu werden, und mancher ein Hyp-Hypochondriſt iſt, um ein Philoſoph zu ſeyn. Dieſem Herrn rufen wir doch endlich zu:
Jch wußt es wohl, daß es ein ‒ ‒ ‒ war.
Oder es ſind wirkliche Urſachen der Dunkelheit, die an dem Verfaſſer liegen: und dieſe ſind: die Dunkelheit ſeiner Begriffe ſelbſt: die kann man meiſtens, zehn gegen eins, angeben, wenn auch dem Ganzen des Werks Anlage, und der Beſtimmung der Jdeen Genauigkeit fehlt:
Cui lecta potenter erit res,
Non facundia deſeret hunc, nec lucidus ordo.
Alles dies entſpringt alsdenn aus einer Quelle: man ſieht den Geiſt des Verfaſſers, in dem, wie im Chaos des Ovids noch die Elemente der Jdeen, in einiger harmoniſchen Uneinigkeit ſchlummern, und in einer uneinigen Harmonie ſich zur Bildung draͤngen. Jſt ein ſolcher Schriftſteller noch ein junges Genie, ſo iſt es nicht zu verwundern. Es iſt ein Blinder, der noch Menſchen als Baͤume ſieht: der Kunſtrichter verſuche die geduldige Cur, ſeine Augen zum Licht zu gewoͤhnen. Die Kinder ſollen deſto beſſer reden, die ſpaͤt, und ſchwer lernen, und ſolche Dunkelheit iſt dreimal beſſer, als jenes langweilige Plappern, mit vielen deutlichen Worten nichts zu ſagen. — Einem Alten iſt nun freilich der Staar ſchwerer zu ſtechen.
Noch oͤfter ruͤhrt dieſe Dunkelheit her, von einer Stubengelehrſamkeit, die durch den muͤndlichen Vortrag nicht hat lebendig werden koͤnnen. Durch den muͤndlichen Vortrag wird man deutlich: man lernt den beſten Geſichtspunkt, faßlich zu ſeyn, bemerken: ſo lernte Sokrates von ſeiner Aſpaſie Weisheit und Vortrag: ſo lerne es der Lehrer in dem Kreiſe ſeiner Zuhoͤrer, wenn er ſie nicht als Maſchinen behandeln will: ſo trete der Gelehrte in die große Welt, um ſich ſeiner Cathederſprache zu entwoͤhnen: er erinnere uns nicht ſo oft, daß er vor ſeinem Schreibepult ſizzet; er geſelle die Deutſche Arbeitſamkeit und Genauigkeit zur Franzoͤſiſchen Freiheit; denn wird er mehr ſeyn, als ein Franzoͤſiſcher Abbe, mehr als ein fader Kanzelredner, mehr als ein Zeitungsſchreiber; kurz! mehr als eine waſchhafte Sibylle, die wohlriechende, oder heilige, oder neue und rare Kraͤuter zum Verkauf traͤgt; er wird mehr, aber doch nicht auf Koſten der Deutlichkeit.
Man ſagt auch, daß eine gewiſſe Deutſche Beſcheidenheit, die kurz ſeyn, die nicht beleidigen, die durch Mienen, nicht Worte ſprechen will, Schuld an mancher Dunkelheit ſeyn ſoll; und hier iſts alſo noͤthig, den Schriftſteller aus dieſer Verlegenheit zu ziehen: und unſere Staatsverfaſſung in der Litteratur ſo unabhaͤngig und republikaniſch zu machen, als moͤglich. Bei den Alten war die Wahrheit, nach Cupers 41 Briefen, ohne aͤuſſere Verehrung, aber das Haupt und der Mund der Weiſen war ihr heilig: bei uns hat ſie Tempel und Altaͤre gnug; jeder Kunſtrichter raͤuchert ihr, aber als einer Allegoriſchen Perſon. Gute Goͤttin! die du die Schuzgoͤttin Deutſchlandes ſeyn ſollteſt:
Si qua Dea es, tua me in ſacraria dono!
Wir wollen die Franzoͤſiſche Munterkeit, und Freiheit in unſere Abhandlungen einfuͤhren, und mit dem Deutſchen Nachdruck begleiten. Der Vorredner des Journal étranger ſchrieb unter andern der Franzoͤſiſchen Sprache einen groͤßern Vorrath von Ausdruͤcken fuͤr das Laͤcherliche zu;42 er glaubte, die Deutſche Sprache haͤtte daran Mangel; der Kunſtrichter leugnet es; auch ich, und jenem gebe ich doch den Vorzug der Franzoͤſiſchen Sprache zu, weil ich es ſelbſt erfahren. Jch habe ſeit einiger Zeit meine Nebenſtunden auf eine Unterſuchung des Laͤcherlichen in Sitten, und des Laͤcherlichen in der Vorſtellung und dem Ausdruck, nach ſeinem Hauptbegrif und ſeinen vielerlei Arten, gewandt: und habe im Franzoͤſiſchen wirklich mehr Worte gefunden, weil dieſe Nation, die ohnedas mehr und lieber lacht, als die Deutſchen; mehr Bemerkung aus der Cultur des Umganges zieht, als wir, und ſich uͤberhaupt mehr zu erklaͤren weiß, wie die Seele durch den Koͤrper ſpricht, als unſere Sprache. Man gehe auch nur das Verzeichniß durch, was Girard und Mauvillon von Woͤrtern dieſer Art geſammlet: ſo wird man dem Arnaud recht geben.— Und uͤberhaupt hat unſere Sprache durch Ueberſezzungen von der Franzoͤſiſchen Proſe des Umganges ſeit einigen Jahren ſchon merklich viel gewonnen.