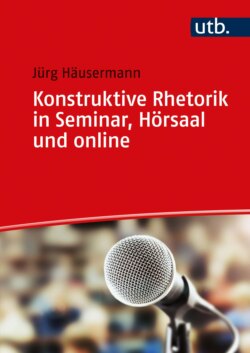Читать книгу Konstruktive Rhetorik in Seminar, Hörsaal und online - Jürg Häusermann - Страница 36
Wie kommt Dialog in den Vortrag?
ОглавлениеAber wie kann jetzt die Rednerin „Dialog“ in ihre Vorträge bringen? – Nicht, indem sie sich sagt: „Alles hängt von mir ab.“ Sondern indem sie Verantwortung abgibt. Weil sie die Hauptperson ist, glaubt sie, für alles zuständig zu sein. Wenn jemand nichts mitbekommt, ist es vermeintlich ihre Schuld. Ihr Idealbild ist der Tausendsassa, der riesige Säle füllt und die Leute bis zum Schluss in Atem hält. Sie scheint vergessen zu haben, dass sie es auch anders kann. Im Gespräch ist ihr ja bewusst, dass sie ein gutes Resultat nur mit dem Gesprächspartner zusammen erreicht. Sie muss ihn zwar ins Boot holen; aber da soll er mitrudern. Er ist mitverantwortlich dafür, dass er von der Begegnung profitiert.
Dies ist auch in der öffentlichen Rede so. Diese Einstellung lässt sich in den Vortrag übernehmen. Keine Redner-Rolle ist so starr vorgegeben, dass sie sich nicht elastisch gestalten ließe, indem das Publikum wahrgenommen und so weit als möglich beteiligt wird.
»Raum: den Raum erlebbar machen: Ein Seminarraum lässt sich zwar nicht beliebig gestalten, besonders wenn man als Gastrednerin zu einer Veranstaltung eingeladen ist und sich ans Rahmenprogramm anpassen muss. Aber einen Versuch ist es immer wert. Toll wäre es, wenn alle Beteiligten einander mühelos sehen könnten. In diesem Fall hat das veranstaltende Unternehmen (spezialisiert auf Seminare und Konferenzen) Tischreihen aufgestellt, weil den BesucherInnen Kaffee und Mineralwasser serviert wird. Die erste Option – die Bestuhlung zu verändern – ist damit hinfällig. Die einzige Möglichkeit ist, die eigene Position als Rednerin zu verbessern. Ihr erster Gedanke: Ich beginne meinen Vortrag nicht auf der Bühne, sondern am Saaleingang. Ich beginne zu reden, und die Teilnehmerinnen – irritiert, weil sie mich nicht sehen – müssen sich alle mir zuwenden. Das kann funktionieren, unter zwei Bedingungen: genügend Zeit einsetzen und sich sprachlich über die Situation verständigen.
»Zeit: Sich und den anderen Zeit lassen. In einer ungewohnten Sitzordnung müssen sich die Teilnehmenden zuerst zurechtfinden. Und hier, wo die Rednerin sie aus einer überraschenden Perspektive anspricht (was eine gute Idee sein kann), bedeutet Timing: Lass den Leuten genügend Zeit, sich umzusehen, dich zu finden und ihre Überraschung zu genießen. Erst dann kannst du zum nächsten Schritt gelangen und dich mit ihnen darüber verständigen, was das Ganze soll. Das geht am leichtesten, indem du kommentierst, was gerade geschieht. Und das tut die Rednerin auch. Sie beginnt mit der Frage: „Ja, wo ist sie denn, die Olivia Grau?“ Und antwortet gleich selbst: „Hier hinten steht sie. Genau!“ Und sie lässt den Leuten Zeit, sich zu ihr umzudrehen. (Allerdings fehlt hier die direkte Ansprache des Publikums mit dem Personalpronomen Sie oder ihr.)
»Zielsetzung: Der Vortrag steht im Tagungsprogramm. Vorher und nachher sind andere Punkte geplant. Da würde eine Diskussion mit den 250 Zuhörenden über Sinn und Zweck des Auftritts merkwürdig wirken. Aber deklarieren lässt sich das Ziel. Und es ist möglich, dabei auf die Reaktionen zu achten. Viele so genannte Keynote- oder Impulsvorträge leiden darunter, dass an den Bedürfnissen des Publikums vorbei gesprochen wird. Man vertraut dem Veranstalter, der einem die Fragen nennt, die die Anwesenden angeblich haben, und kommt mit einer Lösung für Probleme daher, die niemand hat. Die Distanz zwischen Rednerin und Zuhörern wird so nicht aufgehoben. In vielen Fällen gäbe es aber die Gelegenheit, sich vorgängig unter das Publikum zu mischen und Erwartungen aufzuschnappen. Darauf auch nur mit ein paar Worten einzugehen, bringt mehr, als nur den vorbereiteten Text abzuspulen.
»Sprachliche Gestaltung: Verständigung und Feedback. Neben den Hauptaussagen, Argumenten und Beispielen wären Botschaften des Kontakts ebenso wichtig. Einige davon sind bereits genannt worden: Verständigung darüber, was im Publikum vor sich geht (wenn es wie hier eine gewollte Bewegung ist), Feedback zu Äußerungen aus dem Publikum. Hinzu kommen eingeschobene Erklärungen, wenn erkennbar ist, dass nicht alle folgen, aber auch die direkte Ansprache der Anwesenden mit „Sie“ oder „ihr“.
»Sprechweise: Abwechslung durch eine dialogische Haltung. Der einfachste Weg von der Monotonie zu einer lebendigeren Sprechweise führt über das Interesse an den Zuhörenden: Bekommen sie mit, was ich soeben gesagt habe? Beantworten sie die Frage für sich, die ich gerade gestellt habe? Nehmen sie an der Geschichte teil, die ich erzähle? – Hilfreich ist dabei das Bewusstsein für die Gliederung der eigenen Rede in Sprechhandlungen. (Mehr dazu in Kapitel 8.)
»Körpersprache: Eine Handlung aufs Mal. Kontakt mit dem Publikum ist nur möglich, wenn gesprochene Sprache und Körperbewegungen zusammenpassen. Oft geht das ganz natürlich vor sich (z.B. bei Zeigegesten). Oft aber ist man verleitet, zwei Dinge zugleich zu tun. Olivia zum Beispiel geht durch den Raum und stellt dabei bereits eine Aufgabe: „Machen Sie eine Liste: Welches sind die zehn wichtigsten Personen in Ihrem Leben?“ Damit fordert sie alle, die sie mit dem Blick verfolgen, auf, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Und sich selbst erschwert sie die Orientierung beim nicht ganz problemlosen Weg durch die engen Tisch- und Stuhlreihen. Der wichtigste Tipp im nonverbalen Bereich: Eine Sache aufs Mal tun. Das bedeutet zum Beispiel auch, 20 Sekunden lang zu schweigen, bevor man wieder auf der Bühne steht.
»Medieneinsatz: Im Vortrag teilt sich Olivia die Bühne mit dem Bildschirm. Darauf sind zum Teil einfache Bilder zu sehen (ein Flugzeug, wenn vom Fliegen die Rede ist, ein Strand, wenn sie vom Strand erzählt), zum Teil aber auch Grafiken und Texte, die gelesen werden wollen und den Blick von der Rednerin ablenken. Dialog ist aber nur möglich mit Blickkontakt. Das geht nur, wenn der Bildschirm keine Konkurrenz darstellt – am leichtesten, wenn darauf nichts zu sehen ist!
Chancen für Dialog im Präsenz-Vortrag
»Den Raum mit dem Publikum zusammen erleben: Lautstärke anpassen, Blickkontakt ermöglichen, Konkurrenz-Ereignisse (überflüssige visuelle Reize) vermeiden. (Über den konstruktiven Umgang mit Medien im Vortrag siehe Kapitel 16.)
»Sich und dem Publikum Zeit lassen: Fragen und Aufgaben müssen zuerst verstanden und dann umgesetzt werden. Erst danach kann der Vortrag weitergehen. Und er geht weiter, indem die Antworten bzw. Lösungen aus dem Publikum aufgenommen werden (Mehr zum Thema Fragen in Kapitel 14.)
»Überprüfen, was ankommt: Ob man sich versteht, wird nicht nur aus Antworten klar, sondern auch aus Blicken, Kopfnicken, Handzeichen usw.
»Aufgaben ernst meinen: Fragen, Problemstellungen usw. lösen in jedem Fall Reaktionen aus. Diese müssen – auch wenn sie nicht ausgesprochen sind – eingearbeitet werden: durch nonverbale Übereinkunft, Pausen, einzelne Antworten aus dem Publikum, Zitieren fremder Beiträge usw.
»Attraktive Sprechweise ermöglichen: Wer beim Sprechen mitdenkt, führt noch kein Gespräch, sorgt aber für den lebendigen Rhythmus eines Gesprächs und gibt damit dem Publikum die Möglichkeit, mitzudenken und, bei Bedarf, mitzusprechen. Der Anfang besteht in der Aufmerksamkeit für Sprechhandlungen. (Vgl. hierzu Kapitel 8.)
»Auf überflüssige PowerPoint-Folien verzichten: Viele Botschaften wirken überzeugender ohne Visualisierung. Wenn aber Medien eingesetzt werden müssen, dann muss die Rednerin sie gemeinsam mit dem Publikum betrachten (damit sie nicht völlig losgelöst ein Eigenleben führen).