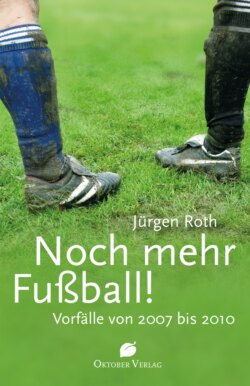Читать книгу Noch mehr Fußball! - Jürgen Roth - Страница 16
Kein Davonkommen mehr
ОглавлениеWie bitte? Eine Akademie für – Fußballkultur?
Eine Bekannte aus Frankreich staunt nicht schlecht, als sie von der Existenz der im Oktober 2004 in Nürnberg gegründeten Deutschen Akademie für Fußball-Kultur hört. Bei ihr zu Hause in Frankreich, sagt sie, unterhalte man Akademien für alles mögliche, was im engeren Sinne mit Kultur in Verbindung zu bringen sei, aber eine Akademie für – Fußballkultur? In Frankreich undenkbar, sagt sie.
In Deutschland indes, und daran ist die WM im vergangenen Jahr nicht schuldlos, besteht offensichtlich ein unvermindert wachsendes Bedürfnis, die Leitsportart Fußball durch allerlei kulturbetriebliche Aktivitäten medial zu veredeln. An die Spitze dieses nicht abreißenden Trends gesetzt hat sich, indem sie ihn zugleich quasi institutionalisiert, die von der Stadt Nürnberg in Kooperation mit dem Hochkulturblatt kicker und einer Bank getragene Akademie. Ihr Ziel ist, wie es heißt, als »neues Kompetenzzentrum« »eine zentrale Anspielstation auf dem Feld der Fußball-Kultur im ganzen Land« zu werden.
Der Begriff der Fußballkultur allerdings dünkt einem zumindest zweifelhaft, zwingt er doch zwei Dinge zusammen, die im landläufigen Verständnis wenig miteinander zu tun haben – Fußball und Kultur. Aber Akademiemitglied Stefan Erhardt, Redakteur des 1995 aus der Taufe gehobenen Fußballmagazins Der tödliche Paß, das in Kürze zum fünfzigsten Mal erscheint und sich seit der ersten Ausgabe kontinuierlich mit kulturellen Konnotationen des Fußballs beschäftigt, entkräftet solche Bedenken:
»Na, ich denke, die Begriffe ›Fußball‹ und ›Kultur‹ können schon zusammenkommen, wenn man das will und wenn man jetzt nicht künstlich versucht, da Beziehungen herzustellen, die per se dem Fußball nicht inhärent sind. Daß Fußball in Kulturen verankert ist, ist ja schon mal entwicklungsgeschichtlich etwas, was die letzten gut zweihundert Jahre auch zurückverfolgt werden kann. Was den Fußball auch mit der Kultur verbindet, jetzt im allgemeinsten Sinne, ist natürlich seine Organisation – Ligabetriebe, Wirtschaftsunternehmen, Spielerverträge, das ist so das, was die wirtschaftskulturelle Seite ausmacht –, und auf der anderen Seite aber ist es ein Bestandteil, ja, ich möcht’ schon fast sagen: der Folklore, jetzt im guten Sinne, also etwas, was das gemeine Volk zwangsläufig immer berührt, weil’s eine Sportart ist, die sich weltweit so verbreitet hat, daß eigentlich niemand mehr, sagen wir mal mit Ausnahme der USA, davonkommen kann.«
Es gibt kein Entrinnen mehr vor dem Fußball, vor dem, wie in der Selbstdarstellung der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur betont wird, »populärsten Kult unserer Zeit«. Dem Kult – einer ritualisierten, blind beglaubigten Handlungsausprägung von Kultur – zu huldigen, ist jedoch keineswegs das Ansinnen der Akademie, in deren Beirat hochwürdige Körperschaften wie das Goethe-Institut, das Adolf-Grimme-Institut und der Bayerische Rundfunk vertreten sind. Man wolle die Manifestationen der Fußballkultur »in ihrer gesellschaftspolitischen Dimension« betrachten, unterstrich Akademie-Projektleiter Günter Joschko kürzlich auf dem Akademietreffen »Perspektiven 2008«, das im Anschluß an die Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises stattfand, und Stefan Erhardt präzisiert, auf welchen Feldern die fußballkulturelle Reflexion unter dem Dach der Akademie vorangetrieben werden könnte:
»Ich glaube, die Akademie sollte sich nicht erschöpfen darin, jedes Jahr Preise zu vergeben und eine, ja, wie auch immer, gute oder schlechte Gala zu organisieren, sondern versuchen, Menschen zu ermöglichen, über Fußball nachzudenken, über Fußball zu forschen meinetwegen auch, oder eine Plattform sein, um über Fußball reden zu können, sich austauschen zu können – jenseits von den Stätten, wo Fußball sowieso schon stattfindet, also eben außerhalb des Stadions, außerhalb der Fußballkneipen. Und da sollte die Akademie auch wesentlich größere Unterstützung bekommen. Es muß jetzt nicht sein, daß man jetzt unbedingt das angestrebte Fußballmuseum hier in Nürnberg verwirklicht, das halte ich gar nicht mal für so wichtig. Museal gibt’s da ohnehin schon zu viele Dinge, die den Fußball einfach nur in eine Tradition stellen wollen. Aber Fußball ist eine sehr lebendige Angelegenheit, die sich auch tagtäglich weiterentwickelt. Und was die Akademie da leisten könnte, wäre eben wirklich, ja, ein Haus zu bieten, wo die unterschiedlichsten Veranstaltungen dann auch stattfinden könnten. Das kann bildende Kunst sein, das können tatsächlich Symposien sein, das kann aber auch ein Zentrum sein, wo man tatsächlich Forschung betreiben kann. Also, ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen – etwas, was es in Deutschland meines Wissens noch nicht gibt –, daß man versucht, ein Archiv aller möglichen und unmöglichen Fußballzeitschriften – Magazine, Zeitungen – mal zusammenzustellen, so vollständig, wie das eben auch möglich sein kann. Oder ein anderer großer Bereich, der auch noch sehr lohnenswert wäre, da etwas hineinzuforschen, wäre Fußball so im Kinder- und Jugendbereich – also ganz konkret auch bei Kinderbüchern, Jugendbüchern, Bilderbüchern über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg.«
Die Akademie hatte vor drei Jahren begonnen, durch Podiumsdiskussionen zwischen Otto Schily und Edmund Stoiber, Paul Breitner und Urban Priol oder Jürgen Klinsmann und Klaus Theweleit öffentliche Aufmerksamkeit zu mobilisieren. Mittlerweile habe sich, führt Günter Joschko aus, neben regelmäßigen Veranstaltungen aller Art die Website www.fussballkultur.org zum »Internetportal zu Fußball und Kultur schlechthin« gemausert, dessen Bedeutung sich etwa an den zahlreichen Linklisten sowie an den »Themen des Monats« ablesen lasse, seien dies Debattenbeiträge über die wuchernde Kommerzialisierung, den Rassismus auf den Rängen, die Entwicklung des Frauenfußballs, die zunehmende Zahl von Stadionverweisen – oder sei es auch mal eine Polemik gegen den FC Bayern.
Zentrales Thema der Akademie aber scheint vorerst die Frage zu sein, wie man mit dem Deutschen Fußball-Kulturpreis weiter verfährt, der dieses Jahr zum zweiten Mal ausgelobt worden war und sich als geeignetes Vehikel zur Generierung von Öffentlichkeit erwiesen hat. Unstrittig unter den zur Zeit dreiundsiebzig Akademiemitgliedern ist lediglich, die mit jeweils 5.000 Euro dotierten Sparten »Fußballbuch des Jahres« und »Lernanstoß – der Fußballbildungspreis des Jahres«, mit dem pädagogische Programme an Schulen und in Vereinen prämiert werden, sowie den doppelt so hoch dotierten »Walther-Bensemann-Sonderpreis« beizubehalten. Doch die Verleihung der letzteren Auszeichnung, die Persönlichkeiten des Fußballs ehren soll, die sich »mit Mut und Pioniergeist für mehr gesellschaftliche Verantwortung, Fair play und interkulturelle Verständigung« engagieren, im vergangenen Jahr an ausgerechnet Franz Beckenbauer und heuer an den millionenschweren Altweltstar Alfredo Di Stéfano rief bei etlichen Akademiemitgliedern im nachhinein regelrecht Empörung hervor. Der Sportwissenschaftler Dieter Jütting hätte post festum wohl am liebsten beide Entscheidungen annulliert, und Volker Goll von der Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der Deutschen Sportjugend bekannte, während der Zeremonie »nah am Zwischenruf« gewesen zu sein.
Was Beckenbauer und Di Stéfano mit der wie auch immer umrissenen Kultur des Fußballs am Hut haben, bleibt ein Rätsel, auch wenn Jochen Hieber von der FAZ dafür plädierte, den »Fußballkulturbegriff« sehr, sehr weit zu fassen und den »Glamour- und Medienfaktor« nicht geringzuschätzen. Ob künftig, wie auf dem Akademietreffen erwogen, Preise für Fußballkurzfilme oder -jugendbücher vergeben werden, wird sich weisen. Daß man, versicherte Günter Joschko, auf keinen Fall »die beste Stadionbratwurst« als Beleg für eine erfreulich ziselierte Fußballbratwurstkultur dekorieren werde, beruhigt immerhin. Doch jenseits der Preisverleiherei bliebe gewissermaßen prinzipiell zu fragen, ob die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur – neben der angeregten stärkeren Unterstützung klassisch-akademischer Forschungsprojekte – in den Fußball selbst zurückzuwirken und womöglich Tendenzen zu beeinflussen vermag, die im Sinne der Fußballkultur abträglich erscheinen. Stefan Erhardt ist da eher skeptisch:
»Ich fürchte: im Moment nicht. Dadurch, daß eben der, ja, jetzt gehen wir mal vom Populärfußball aus, sprich also vom Profifußball, daß der stark eingebunden ist und da auf absehbare Zeit auch so schnell nicht mehr rauskommen wird – eingebunden ist in die rein manchesterkapitalistischen Strukturen –, wird’s so sein, daß sich die Vereine eher vom Geld beeinflussen lassen als von einer Akademie. Wo die Akademie wirken könnte, wäre auf längere Sicht vielleicht, einen Gegentrend gegen diese Geldmaschine Fußball zu setzen – und das zu erreichen, was ja viele in England auch mit diesem ›Reclaim the game‹-Slogan vor Jahren schon ins Leben gerufen haben: nämlich ’ne Bewegung zurück zum eigentlichen Spiel, und da ein Bewußtsein zu schaffen.«
Das läßt im begrüßenswert altmodischen Sinne auf mehr Autonomie, auf Kritik und Aufklärung hoffen:
»Das ist ja, denk’ ich auch, meines Wissens und meines Verständnisses nach ’ne Aufgabe von einer Akademie, die ja unabhängig auch sein soll: Kritik im Sinne zu üben nicht, daß man Dinge schlechtmacht, sondern daß man Zusammenhänge aufzeigt, erhellt, daß man Abhängigkeiten verdeutlicht, die Zustände erklärt und dadurch auch versucht zu verbessern. Also, es ist schon ein, wenn man so will, aufklärerischer Anspruch, den ich zumindest mit ›Akademie für Fußballkultur‹ auch verbinde.«
Und der, der aufklärerische Anspruch, könnte sich vielleicht sogar an die Akademie selbst richten. Denn wenn man sieht, daß Ronny Blaschke, der mit seinem Reportagenband Im Schatten des Spiels – Rassismus und Randale im Fußball den Fußballbuchpreis 2007 gewann, einerseits Akademiemitglied ist, andererseits in der Jury für die Auszeichnung »Fangesang des Jahres« sitzt, in welcher zudem das Akademiemitglied Christoph Biermann hockt, der seinerseits den Silberplatz in Sachen Fußballbuch belegte; und daß, zum dritten, der dito untadelige FAZ-Mann Christian Eichler als Akademiemitglied neben anderen für die Nominierung des »Fußballspruchs des Jahres« geradestand und in dieser Funktion eine Sentenz von sich höchstselbst in die Finalrunde befördern mußte – dann möcht’ man sich schon mal drei, vier Sekunden lang die Augen reiben.
Und das sagt notabene jemand, der selber auf dem schmählichen dritten Buchrang gelandet und deshalb natürlich neidisch und zutiefst gekränkt ist.