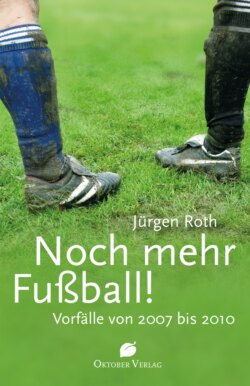Читать книгу Noch mehr Fußball! - Jürgen Roth - Страница 8
Allerschlimmste Irreführung
Оглавление»Ich glaube, wenn man den Fußball zur Professorenarbeit macht, verliert man seine Wurzeln.« Diesen Satz von Lothar Matthäus stellen Jürgen Mittag und Jörg-Uwe Nieland dem Vorwort des von ihnen herausgegebenen Sammelbandes Das Spiel mit dem Fußball – Interessen, Projektionen und Vereinnahmungen (Essen 2007) als Motto voran – sei es gewissermaßen entschuldigend gemeint, sei es, um zu signalisieren, sich der gängigen Reserviertheit gegenüber einer unterdessen umfänglichen wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Fußball bewußt zu sein.
Die insgesamt empfehlenswerte sechshundertseitige Anthologie, die den einzigen ubiquitären Massensport unter historischen, politischen, medien- und kulturtheoretischen sowie ökonomischen Aspekten in seiner Ganzheit darzustellen versucht, bestätigt mitunter die Bedenken des größten Mittelfranken aller Zeiten – etwa wenn das »ästhetische Potential des Fußballs« allzu uninspiriert synoptisch verhandelt und dann auch noch ein ahnungsloser Allschwätzer wie Peter Sloterdijk zustimmend zitiert wird. In solchen Momenten wird deutlich, daß die Fußballwissenschaft in eine Phase eingetreten ist, in der sich die Geisteswissenschaften seit Jahren befinden: in jene der Redundanz, in der nicht selten Scheinprobleme gewälzt werden, die längst hinreichend beschrieben und diskutiert sind.
Gleichwohl, Das Spiel mit dem Fußball ist weitenteils beachtlich sorgfältig gearbeitet und besticht nicht nur dort, wo es etwa um die »Talkshowisierung des Fußballs« geht und treffend heißt: »Tatsächlich hat der Sportjournalismus durch die kommerziellen Veranstalter und ihre flotten Sprücheklopfer ohne erkennbare fachliche Kompetenz die bundesdeutsche Medienlandschaft kräftig aufgemischt.« Vor allem die Aufsätze zur Geschichte des deutschen Fußballs sind äußerst lesenswert. Lutz Budraß weist zu Recht darauf hin, »daß sich die nationalsozialistische Politik im Fußball – wie in anderen Teilen der deutschen Gesellschaft auch – am stärksten in der Unterdrückung, im Ausschluß und schließlich der Vernichtung der jüdischen Vereine und der jüdischen Fußballspieler niederschlug«. Und Rudolf Oswald beleuchtet in seinem Essay zum »Ursprung der deutschen Fußball-Tugenden im Volksgemeinschaftsideal« jene »Gemeinschaftsmetaphorik«, die schon die Fußballpublizistik der zwanziger Jahre dominiert und einen antiindividualistischen, militärisch konnotierten Gruppenmythos propagiert hat, der den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand. »Weshalb Nils Havemann in seiner vom DFB in Auftrag gegebenen Studie vom ›Untergang des deutschen Fußballsports im Dritten Reich‹ spricht, bleibt wohl das Geheimnis des Autors«, schreibt Oswald. »Wahr ist vielmehr, daß ebendieser Fußball bereits Ende der 1940er Jahre mit nahezu gleichem Personal wieder auf der Bühne des deutschen Sports präsent war. Nicht zuletzt für den Sektor der Presse läßt sich dieser Befund bestätigen. Auch die Karrieren der meisten Fachjournalisten wurden durch die Zäsur des Jahres 1945 lediglich unterbrochen, nicht aber beendet. Und mit den Köpfen überlebte die Gesinnung.«
Vermißt habe ich in Das Spiel mit dem Fußball trotz der beeindruckenden Faktenfülle zwar die Erkenntnis von Ludwig Wittgenstein: »Fußball hat Tore, Völkerball nicht.« Dafür wurde ich jedoch durch ein Thomas-Bernhard-Zitat entschädigt: »Wer für den Sport ist, hat die Massen auf seiner Seite, wer für die Kultur ist, hat sie gegen sich, hat mein Großvater gesagt, deshalb sind immer alle Regierungen für den Sport und gegen die Kultur.«
Das hat sich neuerlich durch die Vergabe der Fußballeuropameisterschaft 2012 an Polen und die Ukraine bestätigt. »Wieder einmal ist der Fußball der Politik voraus«, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (22. April 2007) und lobte die Entscheidung der UEFA als eine »von seltener Hellsicht«, denn die weiten Ebenen zwischen Oder und Don würden nun durch den Fußball erst so recht zu einem Teil eines friedlichen, geeinten Europas.
Was das für die kulturellen oder gar die sozialen und politischen Verhältnisse in Polen und der Ukraine bedeuten wird, erfuhr man nicht. Immerhin präsentierte die FAS aber »abschreckende Zahlen« in anderer Hinsicht: »Wenn bei der Fußballeuropameisterschaft 2012 die Fans durch die polnisch-ukrainischen Steppen von Stadion zu Stadion fahren, werden sie im Durchschnitt 12,5 Stunden unterwegs sein. Wer lieber auf die wildromantischen Züge der Staatsbahnen setzt, muß gar [mit] 17,5 Stunden kalkulieren.«
Ja, man hätte vorher nur öfter mal Thomas Bernhard lesen sollen. Dann hätte man gewußt, daß die landschaftliche Weite in Polen und der Ukraine vom Abscheulichsten ist. Die erschreckende Weite, die geistferne, ja geistlose Leere der Steppen der Ukraine und Polens ist vom Fürchterlichsten, ist eine ungeheuerliche und durch nichts aufzuwiegende Zumutung, ist ein Ausdruck lebensfeindlichster, entsetzlichster Verwirrung.
Von »Direktflügen« zu reden, gab die FAS zu, käme der allerschlimmsten Irreführung gleich. Direktflüge, so die FAS, gebe es »kaum«. Und selbstverständlich könne in einer solchen Gegend, in einer derart verlassenen – und das heißt verkommenen – Gegend von Hotels, die den Namen Hotel verdienten, keine Rede sein, »die Hotels stellen die Ansprüche der UEFA ›nicht zufrieden‹«, hieß es.
In dieser durch und durch ausweglosen, lähmenden, infamen Situation ist jedoch auch Positives zu vermelden: »Der polnische Fußball droht nämlich in einer Korruptionsaffäre zu versinken, seit ein Schiedsrichter der ersten Liga gutgläubig genug war, aus dem Kofferraum einer Limousine ein Handgeld von etwa 25.000 Euro entgegenzunehmen, ohne zu merken, daß der Bote ein Polizist war.«
Der Fußball also ist, das dürfen wir abschließend erleichtert sagen, in ganz Europa in guten Händen.