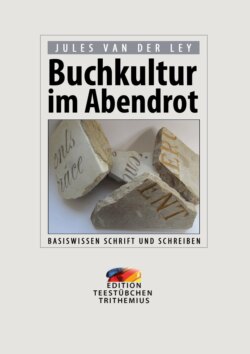Читать книгу Buchkultur im Abendrot - Jules van der Ley - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lesen wie Bienensummen
ОглавлениеBei den Römern war die Schrift in Wachstäfelchen geritzt oder in Stein gemeißelt worden. Beeinflusst vom Schreibgerät Federkiel und dem Beschreibstoff Pergament rundete sich die Schrift in den folgenden Jahrhunderten und bekam deutliche Ober- und Unterlängen. Die karolingische Minuskel, eine reine Kleinbuchstabenschrift, entstand. Fast gleichzeitig mit der Entwicklung der Kleinbuchstaben kam der Wortzwischenraum auf, ein Entwicklungsschritt, der die Lesetechnik revolutionierte. Nach Ivan Illich wurde die Aufteilung der Zeile in Wörter eingeführt, um halbisierten irischen Barbaren, „keltischen Ignoranten“ und „Idiotae“, die sich auf das Priestertum vorbereiteten, das Lateinlesen zu erleichtern. Mit dem Wortabstand entstanden sowohl die Technik des leisen Lesens als auch die Idee des Wortbildes. Es hat im Mittelalter analphabetische Kalligraphen gegeben, die allein Wortbilder abmalten, woraus sich die vielen fehlerhaften Abschriften aus dieser Zeit erklären. Als die Wörter noch ohne Abstand voneinander in Zeilen aufgereiht standen, konnte nicht leise gelesen werden. Das Einerlei der Buchstaben zwang zum lauten Buchstabieren. Indem der Leser sich selbst vorlas, wandelte er die aufgeschriebene Sprache wieder in Laute um und wurde stellvertretend für den Autor zum Sprecher. Demgemäß sind mittelalterliche Skriptorien erfüllt gewesen von einem leisen Murmeln. Die lesenden Mönche waren „Murmler im Weinberg des Textes“, schreibt Illich. Er nennt auch Bereiche, in denen sich das laute Lesen noch bis in die heutige Zeit erhalten hat: Der Hirtenbrief in der katholischen Kirche muss von der Kanzel verlesen werden. Desgleichen muss ein Notarvertrag laut gelesen werden, damit er wirksam wird. Die Vorlesung an Universitäten entspricht ebenfalls dieser Tradition. Darüber hinaus sollte ein Gedicht natürlich auch laut gelesen werden, damit es seine poetische Wirkung entfalten kann.
Der Kommunikationswissenschaftler Marshal McLuhan weist darauf hin, dass beim leisen Lesen die „Stimmwerkzeuge“ in Bewegung sind, so dass „manche Ärzte den Patienten mit schweren Halsentzündungen verbieten zu lesen, weil das stille Lesen Bewegungen der Stimmorgane auslöst, obwohl der Leser sich dessen vielleicht nicht bewusst ist.“
Voraussetzung für das leise Lesen war die leere Stelle zwischen Wörtern. Sie erst trennte die Schrift vom Laut. Es hat also etwa 1600 Jahre gedauert, bis sich die Schrift völlig vom Sprecher entfernen konnte und eigenständig wurde. Doch in der Vorstellung existierte die Idee noch 1000 Jahre länger.
Die Gleichsetzung von Schriftsprache und Sprachlaut lebt als Idee wieder auf in der erzählenden Literatur. Der Literaturwissenschaftler Heinz Schlaffer schreibt in der Einleitung zu Jack Goody, Entstehung und Folgen der Schriftkultur:
„Schon im Mittelalter wollen die Schreiber von Heldenepen den Schein erwecken, als seien sie Sänger und ihre Leser Zuhörer. Rabelais (1494-1553) fingiert im Vorwort zu Gargantua, er habe dieses Werk nicht in der Studierstube geschrieben, sondern beim Bankett zwischen Essen und Trinken diktiert. Bis ins 19. und 20. Jahrhundert geben sich Schriftsteller als 'Erzähler' aus und ahmen den Ton des mündlichen Erzählens nach“ und weiter: „Es hat mehr als zweieinhalbtausend Jahre gedauert, bis die 'Konsequenzen der Literalität' konsequent wurden.“
Die Trennung von Laut und Schrift hat gewiss nicht nur Vorteile. Es wird möglich, Papierdeutsch zu schreiben. Viele Verwaltungstexte sind in einer Sprache verfasst, die nie gesprochen wurde und hässlich tönt, wenn man es doch versucht. So ganz hat sich der alphabetisierte Mensch noch nicht von der Lautsprache gelöst: Ein Text ist nur schön, wenn er auch schön klingt. Wer seinen Schreibstil verbessern möchte, sollte sich die eigenen Texte selbst vorlesen und ändern, was beim Vorlesen schwierig war.