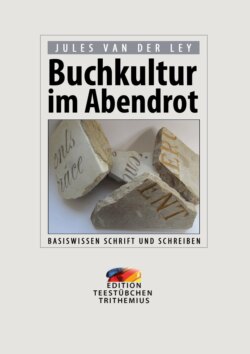Читать книгу Buchkultur im Abendrot - Jules van der Ley - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Faustischer Buchdruck – Die Schwarze Kunst
ОглавлениеDas Besondere an der Erfindung des Buchdrucks ist die bewegliche Druckletter aus Metall, genauer aus Blei, Zinn und Antimon. Als der Goldschmied Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, um das Jahr 1435 damit experimentierte, weihte er den Kalligraphen Peter Schöffer in seine noch geheim gehaltene „aventur und kunst“ ein, wie Gutenberg sein Unternehmen verschleiernd nannte. Schöffer sollte vermutlich bei der Gestaltung der Drucklettern helfen, denn Gutenberg hatte den Ehrgeiz, seine Drucke wie handgeschrieben aussehen zu lassen. Dazu übernahm er auch den typografischen Formenkanon mittelalterlicher Handschriften, den Satzspiegel (das Verhältnis von Textblock zum Papierformat), den Blocksatz, den Schriftcharakter, die für die Bibel gängige Schriftgröße und sah vor, dass Buchmaler nachträglich Initialen einfügen konnten. Das erklärt die herausragende Qualität seines Meisterstücks, der 42-zeiligen Bibel. Doch das hiermit aufziehende Zeitalter des Buchdrucks, beginnt mit einem Wirtschaftsverbrechen, das erst Mitte des 19. Jahrhunderts aufgedeckt wurde. Bis dahin galt nicht Johannes Gutenberg, sondern Johannes F(a)ust als Erfinder des Buchdrucks.
„Fausts so schön gedruckten und einander so gleich kommenden Bibeln, die er in Paris zwar immer noch theurer, aber viel wohlfeiler verkaufte, als die dasigen geschriebenen verkauft werden konnten, wurden für Werke gehalten, die nicht auf gewöhnliche, erlaubte Weise hervorgebracht waren“,
schreibt der Schriftschöpfer, Verleger und Gelehrte Johann Gottlob Immanuel Breitkopf noch 1793 in seinem Aufsatz „Über Buchdruckerey und Buchhandel in Leipzig“ . Gemeint ist der Mainzer Anwalt, Geldverleiher und spätere Buchdrucker Johannes F(a)ust. Am Anfang dieses historischen Irrtums steht ein kapitalistisches Lehrstück. Gutenberg hatte sich von Johannes Fust mehrmals Geld geliehen, zuletzt 800 Taler für den Druck der 42-zeiligen Bibel. Als die Bibel beinahe fertig gedruckt war, verlangte Fust sein Darlehen zurück, weil Gutenberg es angeblich zweckentfremdet hatte. Gutenberg konnte nicht zahlen, und so ließ Fust seine Werkstatt pfänden, um sich in den Besitz der Druckerei zu bringen. Vorher schon hatte er Gutenbergs Gehilfen Peter Schöffer zu seinem Kumpanen gemacht. Schöffer wurde später sein Schwiegersohn. Es kam zu einem Prozess, den Gutenberg verlor. Er erschien nicht einmal selbst vor Gericht. Denn als er erfuhr, dass Schöffer mit Fust gemeinsame Sache machte, wusste Gutenberg, dass er verloren hatte. Die Geschichte wird in dieser Werbeanzeige hübsch illustriert dargestellt. Die Motive des Verräters Peter Schöffer habe ich in der Dramatisierung „Die Lib zu Christinen“ erzählt, zu lesen am Schluss des Kapitels.
(Geschäftsanzeige in: Upper and lower case, 1/1983) Die Federzeichnung zeigt Gutenbergs Druckerei, darin den verzweifelten Gutenberg mit der 42-zeiligen Bibel in der Hand, hinter ihm einen Büttel, der die Hand auf seine Schulter legt, daneben den skrupellosen Fust, der die Schuldverschreibung präsentiert. Einer der vier Gesellen im Hintergrund muss Gutenbergs erster Gehilfe Peter Schöffer sein.
Gutenbergs weiteres Leben liegt im Dunkeln. Fust und Schöffer hingegen betrieben erfolgreich die erste Buchdruckerei der Neuzeit. Doch Fust wurde nachgesagt, dass er mit dem Teufel im Bunde war, denn gegen Ende des 16. Jahrhunderts kam es zu einer Vermischung der Legenden über den Buchdrucker Johannes Faust und den Taschenspieler Georg Sabellicus aus Knittlingen, der sich Faust der Jüngere nannte. In einer Reihe von Dramatisierungen um die Wende des 18./19. Jahrhunderts wird Faust als der Erfinder des Buchdrucks und gleichzeitiger Schwarzkünstler dargestellt, so in J. N. Komarecks Schauspiel: „Gemählde aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts“ von 1794. Das Faust’sche Haus ist hier „eine Wohnung des Satans, der Mittelpunkt der Hölle.“ Jean Paul verweist darauf, dass die durch die Druckerei arbeitslos gewordenen und hungernden Schreibermönche mit Recht sagen würden, „den Erfinder derselben, den Doktor Faustus, hätte leider der Teufel unstreitig geholet.“ Und Grillparzer dichtet im Jahr 1840:
O lichte Schwarze Kunst,
Ob Gutenberg, ob Faust,
War man zu Recht im Zweifel,
Denn halb kommst du von Gott,
Und halb kommst du vom Teufel.
Der schlechte Ruf der Druckkunst erklärt vielleicht den seltsamen Gruß der Buchdrucker:
„Gott grüß die Kunst!“, grüßt der Drucker. „Gott grüße sie!“, ist die korrekte Antwort. Indem sie sich so gottesfürchtig zeigen, glauben sie den Ruch des Teufelswerks zu widerlegen.
Drucken hieß früher „prenten“, im Niederländischen noch heute. Die Entsprechung im Englischen ist „to print“, vergl. „Printmedien.“ Die Niederländer glaubten, sie hätten einen eigenen Erfinder der Druckkunst: Der Küster Laurens Janszoon Coster soll 1423 in Haarlem (Nordholland) die ersten Lettern in einer Sandform gegossen und mit den Lettern Bücher gedruckt haben, genannt „Costeriana“. Anhänger der Coster-These können zum Beweis allerdings fast nichts vorweisen. Doch es gibt eine Legende, die besagt, Johannes Faust sei sein Geselle gewesen. Er habe dem Coster in der Heiligen Nacht die Druckkunst gestohlen, als alle anderen in der Christmette waren. Die Legende muss entstanden sein, als der eigentliche Erfinder Gutenberg schon vergessen war.
Die dunkle Herkunft und der schwarzmagische Ruf der Druckkunst gerieten im 19. Jahrhundert in Vergessenheit. Heute wissen wir, dass mit dem Buchdruck das Denken der Neuzeit begann. Das neuzeitliche Denken brachte die Trennung von Religion/Magie und Wissenschaft. Der Buchdruck verbreitete den Rationalismus der Aufklärung, er formte und verbreitete die Hochsprache und prägte unsere kulturellen Vorstellungen bis zum Ende des 20. Jahrhundert.
Die Macht des gedruckten Wortes schwand mit dem Aufkommen des Computers. Indem das gedruckte Wort buchstäblich sein Gewicht verlor und vom Blei über Fotopapier in die digitale Welt entfleuchte, kommt etwas Neues auf, ein Denken, das zunehmend vom körperlosen Internet geprägt wird. Welche Folgen das hat, wie sich das digitale Denken auf unsere Kultur auswirken wird, ist noch nicht abzusehen. Wir erleben diese Zeit des Umbruchs gerade und wirken daran mit. Noch fehlt den Internetpublikationen die Akzeptanz, wie sie auch dem Buchdruck in seinen Anfängen fehlte. Wer beispielsweise seine Texte nicht drucken lässt, sondern sie im Internet in einem Blog oder als E-Book veröffentlicht, erfährt noch lange nicht die Anerkennung, die ein gedruckter Autor hat. Was unabhängig vom klassischen Printmedium publiziert ist, wird vom Journalismus ignoriert. Durch Ignoranz und offene Schmähungen verteidigen die Journalisten ihre gedruckte Zeitung gegen die Internetauftritte wie einst die Kalligraphen und Berufsschreiber gegen den Buchdruck kämpften. Bernd Graff, leitender Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung, sieht das Internet „in der Hand von Idiotae“, und Gregor Dotzauer dünkelt im Tagesspiegel unter dem Titel „Graswurzelverwilderung“ von der bloggenden „Gewaltwillkür (…) pseudonymer Existenzen“, die aus purer Selbstherrlichkeit einen „Kulturkampf“ angezettelt hätten, – um nur einige Beispiele zu nennen. Diese pauschalen Luftstreiche verhindern nicht, dass das Zeitalter der Buchkultur versinkt.
Seit Mitte 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ist der Bleisatz und mithin der klassische Buchdruck museal. Setzkästen werden heute bei Ebay von Fingerhutsammlern für ihre Exponate ersteigert. Manche bewahren in Setzkästen ihre Überraschungseier-Figurensammlung auf. Am Ende wird eben alles Hehre banal.