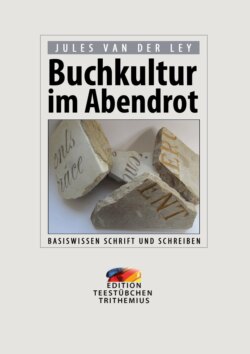Читать книгу Buchkultur im Abendrot - Jules van der Ley - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kritik an der Schrift
ОглавлениеMit Platon beginnt die Kritik am neuen Kommunikationsmittel Schrift. Im Dialog des Sokrates mit Phaidros lässt Platon Sokrates sagen, Gott Theuth habe dem ägyptischen König Thamus die Schrift gezeigt und gesagt: „(…) diese Kenntnis wird die Ägypter weiser machen und ihr Gedächtnis stärken; denn als Gedächtnis- und Weisheits-Elixier ist sie erfunden." Der aber erwiderte:
„O meisterhafter Techniker Theuth! Der eine hat die Fähigkeit, technische Kunstfertigkeiten zu erfinden, doch ein andrer, das Urteil zu fällen, welchen Schaden oder Nutzen sie denen bringen, die sie gebrauchen sollen. Auch du, als Vater der Schrift, hast nun aus Zuneigung das Gegenteil dessen angegeben, was sie vermag. Denn sie wird Vergessenheit in den Seelen derer schaffen, die sie lernen, durch Vernachlässigung des Gedächtnisses, – aus Vertrauen auf die Schrift werden sie von außen durch fremde Gebilde, nicht von innen aus Eigenem sich erinnern lassen. Also nicht für das Gedächtnis, sondern für das Wieder-Erinnern hast du ein Elixier erfunden. Von der Weisheit aber verabreichst du den Zöglingen nur den Schein, nicht die Wahrheit; denn vielkundig geworden ohne Belehrung werden sie einsichtsreich zu sein scheinen, während sie großenteils einsichtslos sich und schwierig im Umgang, – zu Schein-Weisen geworden statt zu Weisen."
Und weiter sagt Sokrates:
„Denn diese Schlimme hat doch die Schrift, Phaidros, und ist darin ganz eigentlich der Malerei ähnlich; denn auch diese stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so schweigen sie gar ehrwürdig still. Ebenso auch die Schriften: Du könntest glauben, sie sprächen, als verständen sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, so bezeichnen sie doch nur stets ein und dasselbe. Ist sie aber einmal geschrieben, so schweift auch überall jede Rede gleichermaßen unter denen umher, die sie verstehen, und unter denen, für die sie nicht gehört, und versteht nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt oder unverdienterweise beschimpft, so bedarf sie immer ihres Vaters Hilfe; denn selbst ist sie weder sich zu schützen noch helfen imstande.“ (Phaidros 274c-278b)
Dass die Schrift das Gedächtnis schwächt und die zu übermittelnden Weisheiten unsinnlich und unabhängig von Sprecher und Hörer verbreitet, so dass die Inhalte sich verselbstständigen, nicht begriffen, falsch verstanden oder fehl interpretiert werden können, ist eine noch heute gültige Kritik.
Trotz der von Platon aufgezeigten Schwächen ergänzte das neue Medium Schrift die Mündlichkeit, veränderte Denken und Handeln der Menschen und prägte Kulturen. Diese Schriftkulturen messen dem Medium Schrift hohe Bedeutung zu, was sich besonders bei den Buchreligionen zeigt. Gleichzeitig sinkt die Wertschätzung des vorangegangenen Mediums, der Mündlichkeit. Der mündliche Vertrag, durch den Handschlag besiegelt, wurde ersetzt durch den schriftlichen Pakt und die Unterschrift. Ein gegebenes Wort gilt jetzt weniger als ein handschriftlicher Vertrag. Die schriftliche Vereinbarung ist die Urkunde, im Sinne der ersten Kunde, nicht das Gesagte.
Was Platon in seinem Ausmaß noch nicht sehen konnte, ist die gesellschaftliche Umwertung der Alten. In oralen Kulturen sind sie hoch geehrt als die Träger des Wissens, die Bewahrer der Geschichte und der überlieferten Traditionen, wandelnde Bibliotheken. „Wenn in Afrika ein Greis stirbt, verbrennt eine Bibliothek“, sagt der malische Schriftsteller und Ethnologen Amadou Hampâté Bâ. Wenn jedoch das Wissen der Menschheit in Bibliotheken gesammelt wird, verlieren die Alten ihre wichtigste Funktion, und ihre Bedeutung für die Gemeinschaften sinkt. Wo die Alten gar verächtlich sind und belächelt werden, abgeschoben in Altenheime, geht das einher mit einer ahistorischen Denkweise, mit einer Überbetonung der gegenwärtigen Ereignisse, wie sie sich besonders in unserer Zeit zeigt, ablesbar am Kommunikationsmittel Internet.