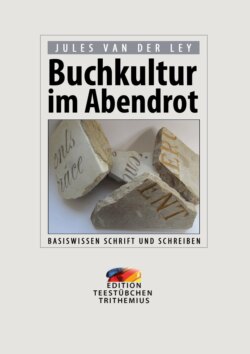Читать книгу Buchkultur im Abendrot - Jules van der Ley - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Herrschaft über Kommunikationsmittel sichert Macht über Köpfe – Zu den Vorteilen des digitalen Publizierens
ОглавлениеWer bei uns in ein Wahllokal geht, um auf einem Wahlzettel sein analphabetisches Kreuzchen zu machen, darf natürlich kein Analphabet sein, denn die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist erforderlich, wenn man an einer Alphabetkultur gesellschaftlich teilhaben will. Das gilt besonders für die Teilhabe an einer demokratisch organisierten Kultur. Die demokratische Teilhabe ist nicht selbstverständlich und steht auch nicht am Anfang der Entwicklung unserer Alphabetkultur. Noch Ende des 19. Jahrhunderts war Geläufigkeit im Lesen und Schreiben nicht das erklärte Bildungsziel. 1872 schreibt der preußische Konsistorialrat Münchmeyer:
“Wo keine Lust zum Lesen ist, rege man sie nicht an. Es ist nicht zu wünschen, dass der Bauer Zeitungen liest, auch das Verlangen nach guter Lektüre soll, wenigstens unter Landleuten, nicht hervorgerufen werden.”
Im Jahr 1878 schreibt Staatsminister Hofmann anlässlich der ersten Beratung des Gesetzentwurfes zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen im Reichstag:
„Wie leicht wird ferner all der gute Samen, den die Schule in das jugendliche Gemüt gestreut hat, zerstört und ausgerottet, wenn der junge Mann von dem Lesen, das er in der Schule gelernt hat, in der Weise Gebrauch macht, dass er sozialdemokratische Blätter studiert, wenn er etwa von seiner Fähigkeit im Schreiben [...] Gebrauch macht, um selbst Artikel in sozialistischen Blättern zu schreiben.“
Die Angst der herrschenden Elite, der einfache Landmann oder lohnabhängige Arbeiter könnte über das Lesen mit subversivem Gedankengut in Berührung kommen oder sogar seine Meinung schriftlich äußern und verbreiten, ist noch größer als der ökonomische Zwang zur schriftlichen Kommunikationsfähigkeit aller Bevölkerungsschichten. Der mit Beginn des 20. Jahrhundert sich abzeichnende Sinneswandel im staatlichen Bemühen um allgemeine Literalität und Bildung ist kein Akt der Menschenfreundlichkeit, sondern folgt ökonomischen Zwängen. Die sich rasch entwickelnde Wirtschaft benötigte Arbeiter, die Bedienungsanleitungen lesen konnten, Büroangestellte für die Korrespondenzen, Wissenschaftler und Ingenieure in großer Zahl, um die technische Entwicklung voranzutreiben.
Bildung steht immer unter dem Diktat der jeweiligen Machtverhältnisse, und die Bildungsinhalte hängen ebenso stark von den Bedürfnissen und Erfordernissen der Wirtschaft ab. Auch in unserer Demokratie nehmen Interessenvertreter aller wichtigen gesellschaftlichen Gruppen starken Einfluss auf die Lehrpläne, entscheiden also mit, was an den Schulen und Hochschulen gelehrt wird. Hier üben besonders die Interessenvertreter der Wirtschaft starken Druck aus, damit ihre späteren Arbeitnehmer über die erforderlichen Qualifikationen verfügen. Idealistisches Bildungsbemühen steht demnach immer im Spannungsverhältnis zwischen Erfordernissen der Wirtschaft und Bedürfnissen des Individuums nach Selbstbestimmung und Autonomie, was in den Präambeln der Schulrichtlinien „Mündigkeit“ genannt wird. Dem Sprachunterricht kommt hier große Bedeutung zu. Lernende sollen befähigt werden, Sprache als Element der Wirklichkeitserfassung zu benutzen, also zum unbevormundeten Bilden von Begriffen und mithin freiem Denken. Der Deutschdidaktiker Joachim Fritzsche hat diesen emanzipatorischen Ansatz schon in den 1970-er Jahren formuliert:
„Da Sprache durchaus ein taktisches Mittel zum Erreichen von Zwecken sein kann, da ferner die Menschen sehr unterschiedlich über dieses Mittel verfügen, erscheint es richtig, dass der Deutschunterricht alles tut, um die Ungleichheit zu beseitigen. […] Erfahrungen werden sprachlich, wenn schon nicht gemacht, so doch verarbeitet. […] Einen Sachverhalt begreifen heißt, ihn auf den Begriff zu bringen. Ich möchte dieses Begreifen, weil es etwas mit Bedeutungen zu tun hat, „semantisches Lernen“ nennen. […] Besondere Bedeutung kommt dem semantischen Lernen dort zu, wo die Sachverhalte ihre Bestimmtheit erst durch die Sprache erhalten, also im sozialen und politischen Bereich.“
Jede Minute, die ein Mensch dazu nutzt, sich hinzusetzen und schreibend seine Gedanken auszurichten, ist ein aktiver und freier Akt der Wirklichkeitsverarbeitung, ein Training der gedanklichen Begriffsbildung. Das verschafft Klarheit über die eigene Situation, man wird sich seiner selbst bewusst, denn (Zitat Fritzsche):
a) Schreiben objektiviert. Während der Sprecher, mit dem, was er sagt, eine Einheit bildet, veräußert der Schreibende seine Vorstellungen und tritt ihnen gegenüber. Er kann sich selbst beurteilen wie einen Fremden. Das Subjekt wird Text.
b) Schreiben isoliert. Der Schreibende ist auf sich selbst angewiesen; keiner springt ihm bei, wenn ihm ein Wort fehlt; aber es fällt ihm auch keiner ins Wort.
c) Schreiben provoziert. Der Schreibende muss alles, was er zum Ausdruck bringen will, verbalisieren, d.h. ihm eine verstehbare Form geben. In der geschriebenen Sprache muss alles bis zu Ende gesagt werden.
d) Schreiben fixiert. Der Schreibende legt sich beim Schreiben fest, er verpflichtet sich. Seine Äußerungen werden interpretierbar, kritisierbar, diskutierbar.
Man wird leicht sehen können, dass Schreiben im Internet ideale Voraussetzungen für semantisches Lernen bietet, an die Fritzsche noch gar nicht hat denken können. Denn …
a) Schreiben per Tastatur und Bildschirm objektiviert wesentlich stärker als die Handschrift. Der Transport in die Druckschrift macht den Text noch fremder, und so lässt er sich leichter kritisch bewerten.
b) Schreiben ist ein isolierter Prozess, doch dem Schreibenden stehen jederzeit diverse Hilfsmittel zur Verfügung. Er kann sich im Schreibprogramm Synonyme anzeigen lassen, er kann sich bei Wikipedia oder im weiten Internet über einen unklaren Sachverhalt informieren und sich dort anregen lassen.
c) Schreiben im Internet zwingt viel stärker, eine Sache zu Ende zu denken, weil hier nicht ein fiktiver Leser mitgedacht wird, sondern es gibt reale Adressaten, und man ist ihnen zeitlich nah. Die fixierten Gedanken werden veröffentlicht. Und auf die Veröffentlichung folgen unmittelbar Reaktionen. Im Idealfall entwickelt sich ein anregendes Gespräch oder eine Diskussion mit Lesern in den Kommentaren, man bekommt ggf. Hinweise, an die man nicht gedacht hat.
Auch Blogger und E-Book-Autoren haben unterschiedliche Voraussetzungen bei den sprachlichen Mitteln. Und sie verfolgen beim Schreiben unterschiedliche Ziele, je nach Kenntnisstand und Veranlagung. Doch alle befinden sich im Prozess des semantischen Lernens. Es ist nach oben nicht begrenzt, es ist auch nicht zu vermeiden. Es lässt sich also mit Recht sagen, dass digitales Schreiben und Publizieren bildet.
„Die Buchdruckerei ist das College des armen Mannes“, sagt Abraham Lincoln. Diese Rolle hat das Internet übernommen, da mag die professionell schreibende Zunft höhnen wie sie will. Es ist gut und richtig, wenn jeder sich die Erlaubnis gibt, die wunderbare Universität des einfachen Menschen zu besuchen, um sich der geistigen Bevormundung durch die Massenmedien zu entziehen. Es ist richtig und ratsam, nicht nur den zu Zeilen geordneten Gedanken von bezahlten Schreibern zu folgen, denn wir wissen nicht, welche Ziele ihre Geldgeber verfolgen. Es tut gut, sich die Oberhoheit über den eigenen Kopf von den bezahlten Schreibern zurückzuerobern, denn die geistige Bevormundung der Köpfe ist ein Faktor kultureller und politischer Macht. Und wenn auch die bezahlten Schreiber nicht die wirklich Mächtigen sind, so sind sie doch deren Vögte und Statthalter.
Man wende sich also getrost gelegentlich von ihnen ab und schreibe selber auf und lese bei denen, die ebenso handeln. Es liegt an uns, ob wir uns im Internet nur unterhalten und verblöden lassen wollen, oder ob wir es als basisdemokratische Universität begreifen, die keiner Zensur unterliegt und jedermann offen steht. Und es liegt an uns, diese offene Universität gegen jede Form der staatlichen Zensur zu verteidigen.
Die digitale Textverarbeitung hat eine Demokratisierung der technischen Schrift gebracht. Durch die Verbreitung über das Internet ist eine Gegenöffentlichkeit entstanden. Diese Gegenöffentlichkeit ist nicht durch Redaktionen oder Lektoren kontrolliert. Dadurch gewinnt der öffentliche Diskurs eine breitere Basis. Schreiben im Internet kann interaktiv sein. In Blogs und redaktionellen Online-Angeboten ist der Autor eine Weile da und kann zu seinen Worten befragt werden, man kann sich ob des Verständnisses bei ihm rückversichern, kann ihn bestätigen, korrigieren, ihn auf Aspekte hinweisen, die er nicht bedacht hatte, man kann mit ihm plaudern und Witze machen, ihn anregen und mit ihm streiten. Das alles sind Elemente der Mündlichkeit, vereint Herz, Hand und Verstand und trägt daher fast alle Vorzüge der Medien in sich, die es beerbt hat. Man muss den freien Onlineschreibern nur Zeit lassen, ihr Handwerk zu erlernen und sich in dessen Gebrauch zu üben.
Auch dieser Text wurde nicht mit der Hand auf irgendeinen Beschreibstoff geschrieben, sondern per Tastatur am Bildschirm. Ihm liegen allerdings eine Fülle handschriftlicher Aufzeichnungen und Reflektionen zugrunde. Beim Schreiben des Manuskriptes für das E-Book wurde mir am Bildschirm ein digital erzeugtes weißes Blatt von etwa dem Format DIN-A4 simuliert, und wenn ich auf der Tastatur einen Buchstaben angeschlagen habe, erschienen auf diesem simulierten Blatt die entsprechenden Buchstaben in der Drucktype Times New Roman in der Größe 12 Pica.
Fast alle Vorgänge des digitalen Schreibens sind automatisiert. In der Automatisierung steckt Expertenwissen, beispielsweise des Schriftgestalters der Times New Roman, Stanley Morison. Er hat sie in den Jahren 1931 bis 1932 im Auftrag der Londoner Times für den Druck geschaffen. Gestaltet habe ich das E-Book jedoch in Open Sans. Die Schrifttype ist im Jahr 2010 vom Schriftdesigner Steve Matteson für Google entwickelt worden. Ziel war eine gut auf Bildschirmen lesbare Schrift mit einer freundlichen Ausstrahlung.
Ob Sie als Leser den Text in Open Sans sehen, hängt davon ab, ob die Schrift auf Ihrem Gerät installiert ist. Sonst wird der Text Ihnen in einer anderen serifenlosen Schrift präsentiert. Die von mir voreingestellte Schriftgröße können Sie natürlich auch verändern, folglich verändern sich die Länge der Zeilen sowie der Seite, in Summe alles, was der Typograf den Satzspiegel nennt. Letztlich richtet sich der Satzspiegel nach dem Bildschirmformat Ihres Lesegerätes: Computer, Laptop, Tablett, E-Book-Reader oder Smartphone. Folglich ist auch die Anzahl der Seiten variabel. Dass das Aussehen eines Textes nicht festgelegt ist, ist eine Besonderheit des digitalen Publizierens. Als Autor muss ich zudem Abstriche bei den typografischen Gestaltungswünschen machen und bei der Anlage des Textes seine Plastizität berücksichtigen, was ich besonders beim Einbinden der Abbildungen bedauert habe.
Aber dieser aus Typografensicht dramatische Verlust an Einfluss auf das Aussehen eines Textes wird ausgeglichen durch die Leichtigkeit zu schreiben, zu korrigieren und zu publizieren. In der quasi auf einem totlaufenden Nebengleis noch weiter voran strebenden Buchkultur ist zur Publikation ein gewaltiger materieller, maschineller, personeller und finanzieller Aufwand nötig mit all seinen Begleiterscheinungen. Vieles davon übernimmt der digitale Schreiber. Er profitiert ungefragt von den Errungenschaften einer langen Tradition. Doch auf eines muss er verzichten: Der Preis für die schier grenzenlose Plastizität eines digitalen Textes ist seine geringere Verbindlichkeit.
„Die Macht des gedruckten Wortes“ ist unmittelbar verbunden damit, dass viele Menschen an der gedruckten Publikation beteiligt sind. Dass über den Autor hinaus ein Heer von Spezialisten zur Herstellung und Verbreitung eines Textes nötig sind, die alle vom Erlös ihrer Arbeit leben können müssen, ist ein Filter, der die Spreu vom Weizen zu trennen scheint, und den Wahrheitsanspruch des Printerzeugnisses begründet, eines Ergebnisses, das man in die Hand nehmen kann.
Die Freiheit der digitalen Publikation birgt eine Reihe von Nachteilen und Gefahren. Zum einen fehlen Selektionsmechanismen zur Qualitätssicherung, weil alles in einer Hand liegt. Hinzu kommt ein Problem, das schon bekannt war, als Texte noch handschriftlich verfasst wurden, etwa im antiken Rom. Die unmittelbare Nähe eines Autors zu seinem Text erschwert das kritische Urteil. Der Dichter und Kritiker Quintus Horatius Flaccus riet deshalb seinen jungen Kollegen: „nonumque prematur in annum“ und bis ins neunte Jahr werde es [das Manuskript] zurückgehalten. Der zeitliche Abstand erlaube dem Autor eine nüchterne Betrachtung seines Werks.
Die Neunerregel des Horaz passt nicht in unser durch Fernkommunikation beschleunigtes Zeitalter. Was kann der Autor tun, der nicht warten will, bis der eigene Text ihm fremd geworden ist? Der Germanist Carl Ludwig Naumann teilte mir mit, er tippe einen Text grundsätzlich nicht in der endgültig gewählten Schrift, sondern wandle den Text erst nach dem Schreiben um. Diese Umwandlung von einer Schrifttype in eine andere ist ein Transformationsprozess, durch den der Text dem Autor entfremdet wird, was eine leichtere Beurteilung und Korrektur erlaubt.
Wo es möglich ist, sollte man das Vier-Augen-Prinzip nutzen, besonders hinsichtlich Rechtschreibung. Die eigenen Fehler lassen sich schlecht finden. Man selbst weiß ja, welches Wort gemeint ist. Zudem birgt die leichte Verformbarkeit von digitalen Texten neue Fehlerquellen. In seinem Buch „Die Elektrifizierung der Sprache“, hat der Wissenschaftsjournalist Dieter E. Zimmer schon 1991 solche Fehlertypen beschrieben. Wenn Sätze beliebig umgestellt oder Textbausteine aus anderen Kontexten in Sätze hineinkopiert werden, können Sätze ihre grammatische Kongruenz verlieren. Das Querformat der meisten Computerbildschirme bringt mit sich, dass man als Autor seinen Text immer nur in einem kleinen Ausschnitt vor Augen hat, was die Textübersicht, die Beurteilung größerer Textzusammenhänge erschwert.
In unserer mehr als 2000-jährigen Schriftkultur hat sich enormes Expertenwissen angesammelt, von dem auch die digitalen Schreiber profitieren können. Die folgenden Kapitel stellen Einzelheiten dieser Schriftkultur dar und zeigen, welche Phänomene der Vergangenheit die heutige schriftliche Kommunikation und unser Denken weiterhin prägen, gleichzeitig soll sich zeigen, welche Veränderungen der Schriftkultur uns wie beeinflussen.