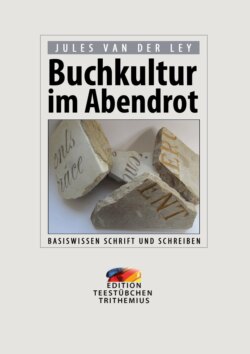Читать книгу Buchkultur im Abendrot - Jules van der Ley - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kritik am Buchdruck
ОглавлениеAuf die Kritik an der Schrift, die ja ursprünglich Handschrift ist, folgt vergleichbar eine Kritik des gedruckten Buches. Vespasiano da Bistici berichtet vom Herzog Federigo von Urbino (+ 1482), er habe jeden Band in seiner berühmte Bibliothek in Scharlachrot und Silber binden lassen. Zwischen all diesen prachtvoll ausgemalten, auf Pergament geschriebenen Büchern duldete er kein gedrucktes Buch. Er hätte sich seiner geschämt. Das war um 1490, etwa 50 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks. Der Herzog konnte es sich leisten, die neue Technologie abzulehnen, selbst gedruckte Bücher für seine Bibliothek abschreiben zu lassen. Für die meisten Menschen seiner Zeit wurde erstmals durch den Buchdruck möglich, überhaupt ein Buch zu besitzen. Das ästhetische Ideal war aber das handgeschriebene Buch. Mit ihm verband sich die Idee von Kostbarkeit. So verwundert es nicht, dass die frühen Drucker ihren Büchern den Anschein gaben, sie wären mit der Hand geschrieben. Bereits Gutenberg hatte sich die Schrifttypen für die 42-zeilige Bibel von dem Kalligraphen Peter Schöffer gestalten lassen. Gedruckte Bücher galten überdies noch lange Zeit als Werke, die nicht mit erlaubten Mitteln hervorgebracht waren. Buchdruck hatte den Ruch, Teufelswerk zu sein.
Dieses Misstrauen entstand aus der für damalige Verhältnisse erstaunlichen Tatsache, dass sich mit Hilfe des Buchdrucks identische Kopien eines Originals herstellen ließen. Denn handschriftliche Abschriften waren Unikate und wurden als solche geachtet. Doch diese Unikate waren voller Fehler, unabsichtlichen und vor allem absichtlichen. Der Historiker Horst Fuhrmann nennt das Mittelalter „Zeit der Fälschungen“. Noch traute man vielerorts auch dem Buchdruck nicht. So schreibt Bischof Heinrich von Ahlsberg im Vorwort des Regensburger Messbuchs von 1485, er habe das Werk nach dem Druck prüfen lassen; dabei habe sich ergeben, dass die Drucke übereinstimmten. In Freising wurden fünf Männern dafür bezahlt, 400 Exemplare eines neu gedruckten Messbuches zu vergleichen, wobei sie entdeckten, dass alle Messbücher denselben Wortlaut enthielten.
Das gedruckte Wort erfuhr in der Folge eine enorme Aufwertung, ermöglichte die Bildung breiterer Schichten, die Aufklärung und mithin die Trennung von Wissenschaft und Religion. Druckwerke verdrängten die Geltung der Handschrift wie die Handschrift die Geltung des gesprochenen Wortes verdrängt hatte. Handschriften stammten von einer Hand. Bücher und Periodika wurden von vielen Händen gemacht, von Menschen, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert hatten. Autor, Lektor oder Redakteur, Setzer, Korrektor, Drucker, – sie alle standen mit ihrer Sachkenntnis hinter einem gedruckten Werk. Dazu bedienten sie sich aufwendiger Technik, die allen anderen nicht zur Verfügung stand. Daraus bezog das gedruckte Wort seine Macht, die noch heute andauert, jedoch im Schwinden begriffen ist.
Mit Computer und Internet kehrt alles in eine Hand zurück. In der Regel ist auch nur ein Kopf am Werk. Doch es irrt sich, wer glaubt, dass die klassischen Medien deshalb grundsätzlich verlässlicher sind. Sie alle sind abhängig von gesellschaftlichen Umständen und politischen Vorgaben. In Diktaturen ist die Presse Verlautbarungsorgan, in islamischen Ländern überwiegt noch der Einfluss der Religion, in Ländern mit Pressefreiheit diktiert die Wirtschaftlichkeit die Ausrichtung. Wirtschaftlichkeit hängt von der verkauften Auflage, vom Anzeigenaufkommen oder den Einschaltquoten ab. Selbst in seriösen Redaktionen werden Informationen journalistisch gefällig frisiert. Und keine Redaktion erlaubt sich, einen großen Anzeigenkunden zu verprellen, indem sie allzu kritisch über ihn berichtet. Letztlich müssen Journalisten immer die vom Verleger festgelegte Blattlinie vertreten. Bücher werden im Hinblick auf die Vermarktung gedruckt. Und Verlage und Buchhandel leben in erster Linie von Bestsellern und populärer Stapelware.