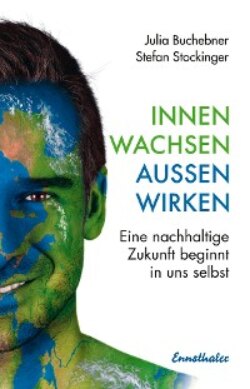Читать книгу Innen wachsen – außen wirken - Julia Buchebner - Страница 19
3.1 Wie Werte unser Verhalten beeinflussen
ОглавлениеIn den gängigen Definitionen werden Werte als »Vorstellungen vom Wünschenswerten« bezeichnet. Sie dienen uns als Beurteilungskriterien oder Maßstäbe, mit denen wir Dinge, Menschen oder Handlungen entweder positiv oder negativ bewerten können. Wenn also zum Beispiel in einer Bevölkerungsgruppe der Wert »Leistung« sehr hochgehalten wird, dann werden alle Handlungen, die auf Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz basieren, für gut befunden. Und alle »Faulsäcke« für schlecht.
Wir legen also mithilfe unserer Wertestandards fest, was wir als erstrebenswert erachten, moralisch oder ethisch für gut befinden und wie wünschenswerte Endzustände und Verhaltensweisen unserer Ansicht nach auszusehen haben. Wenn wir etwas positiv bewerten, dann führt dies dazu, dass wir diese Werte erreichen wollen, während negativ beurteilte Werte abgelehnt werden. Darüber hinaus fühlen wir uns gut und belohnt, wenn wir in Übereinstimmung mit unseren Werten handeln.41 Das verdeutlicht, wie sehr Werte die Auswahl und Beurteilung unserer Verhaltensweisen und der Verhaltensalternativen beeinflussen können. Sie bilden gewissermaßen die Identität einer Gesellschaft, weil sie das Handeln und auch das Denken der Gesellschaftsangehörigen systematisch regeln und lenken.42
Ob und inwiefern Werte die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt beeinflussen, wird etwa in der Umweltpsychologie, der Sozialpsychologie oder auch in der Anthropologie und Philosophie seit mindestens drei Jahrzehnten umfassend untersucht und diskutiert. Als gemeinsames Ergebnis lässt sich ableiten, dass neben anderen Faktoren, wie Bildung oder Verhaltensanreizen, auch unsere Werte einen wichtigen Einflussfaktor auf unser Umwelt- und Sozialverhalten darstellen.
Werte sind vor allem für die Suche und das Verarbeiten von Informationen relevant, denn sie bestimmen, welche Informationen wir bevorzugen oder wie wir Erfolg und Nutzen bewerten. Sie wirken auch auf die Stetigkeit und Regelhaftigkeit unseres Verhaltens. Also zum Beispiel, wie lange oder mit welchem Engagement wir eine bestimmte Aktivität oder eine Sache verfolgen. Zu guter Letzt sind sie auch bei der Entscheidungsfindung ein wichtiger Faktor und beeinflussen etwa die Wahrscheinlichkeit, mit der wir umweltfreundliche Entscheidungen den anderen vorziehen.43
Stell dir als Beispiel eine Person vor, die seit zehn Jahren mit dem Auto zur Arbeit fährt. Neulich hat sie von den ständig steigenden CO2-Emissionen gehört und dass der Verkehr einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Jetzt steht diese Person vor der Entscheidung, ob sie weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren oder auf Alternativen umsteigen soll. Laut dem US-amerikanischen Soziologen Talcott Parsons kommen bei dieser Entscheidung drei wesentliche Aspekte ins Spiel:44
Der kognitive Aspekt lässt uns mögliche Alternativen wahrnehmen, hier zum Beispiel den Bus, das Fahrrad oder die Mitfahrt bei einem Kollegen oder einer Kollegin, die in der Nähe wohnen.
Der kathektischec Aspekt erlaubt es uns, mögliche Alternativen im Hinblick auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse abzuschätzen. In unserem Beispiel wären dies Fragen über passende Busintervalle, die Dauer der Busfahrt, die Geografie und Lage der Fahrradstrecke oder auch die Beziehung zum Arbeitskollegen bzw. zur Arbeitskollegin.
Mit dem evaluativen Aspekt werden die Alternativen schließlich aufgrund von Wertestandards abgewogen und beurteilt. So könnte sich die Person etwa gegen den Bus entscheiden, weil ihr der Wert Pünktlichkeit sehr wichtig ist und sie diesen Wert mit der Variante »Bus« womöglich nicht einhalten könnte. Sie könnte sich aber auch für den Bus entscheiden, weil ihr der Wert Sparsamkeit viel bedeutet und das Busticket günstiger kommt als der Treibstoff für das Auto. Die Person könnte sich für das Fahrrad entscheiden, wenn sie Aktivität schätzt und gern etwas für ihren Körper tut. Wenn ihr aber gutes Auftreten wichtig ist und sie vielleicht nicht verschwitzt zur Arbeit kommen will, dann ist das Fahrrad tabu. Ebenso wird sie die Mitfahrgelegenheit entsprechend ihrem Grad an Sympathie, ihrer Offenheit für Neues oder ihrem Sinn für Gemeinschaft beurteilen.
Natürlich könnte man nun argumentieren, dass dieser Entscheidungsprozess grundsätzlich davon abhängt, ob es überhaupt die besagten Alternativen wie Bus, Bahn oder sichere Fahrradwege gibt. Strukturelle Einschränkungen, wie etwa ein fehlendes öffentliches Verkehrsnetz, werden wahrscheinlich dazu führen, dass unsere Person ihr Auto verwendet, obwohl ihr der Klimaschutz eigentlich viel wert wäre. Nichtsdestotrotz spielen immer auch innere Parameter eine Rolle. Denn selbst in flachen Gegenden mit gutem Verkehrsnetz nehmen viele Leute nach wie vor das Auto – ein strukturelles Problem kann also ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus müssen wir uns die provokante Frage stellen, ob nicht die strukturellen Einschränkungen an sich schon einen Spiegel unserer herrschenden Werte darstellen. Bringt denn nicht das Fehlen des öffentlichen Verkehrsnetzes die Prioritätensetzung der Politik und in weiterer Folge die Werte der Wählerschaft zum Ausdruck? Zeigen uns die schmalen und teils gefährlichen Fahrradstreifen auf unseren Straßen nicht auch, dass das kräftige Auto einfach höher bewertet wird als das gesunde, umweltfreundliche Fahrrad? Sind also äußere Beschränkungen nicht gleichzeitig auch wieder ein Hinweis für unsere inneren Wertehaltungen? Wir glauben schon!
Ein bisschen Forschung gefällig?
Egal wie man es auch drehen und wenden mag, unsere Werte wirken auf unsere Handlungen ein und sind somit mitverantwortlich für unser gesellschaftliches Verhalten. Eine spannende Studie dazu liefern Tom Crompton und seine Kollegen in ihrem Bericht »Common Cause – The Case for Working With Our Cultural Values« aus dem Jahr 2010.45 Darin erörtern sie den Zusammenhang zwischen gewissen Werthaltungen auf der einen und bestimmten Verhaltensweisen auf der anderen Seite. In Anlehnung an den weltweit anerkannten Wertekreis von Schwartz46 mit seinen zehn universellen Werten differenzieren sie unterschiedliche Kategorien. Auf der einen Achse finden wir selbsttranszendierende (über das eigene Ego hinausgehende) und selbstbezogene Werte, auf der anderen Achse wandlungsoffene und konservierende Werte.
Abb. 3: Wertekreis nach Shalom Schwartz47
Laut den Studienergebnissen zeigen Menschen mit starker Orientierung an selbsttranszendierenden und wandlungsoffenen Werten eine höhere Sensibilität für globale Probleme als andere Gruppen. Weiterhin sind sie eher bereit, diesen Problemen konstruktiv zu begegnen, sei es über eine Veränderung des persönlichen Verhaltens oder durch Einmischung in den gesellschaftspolitischen Diskurs.
Einer der für förderlich befundenen Werte ist beispielsweise »Universalismus«, definiert als Verständnis, Wertschätzung, Toleranz und Schutz für das Wohl aller Menschen und der Natur. Ein zweiter, sehr stark mit nachhaltigem Verhalten einhergehender Wert ist »Selbstbestimmung«, definiert als Unabhängigkeit in Gedanken und Handlungen.
Dem gegenüber steht eine Orientierung an selbstbezogenen Werten und Lebenszielen, die nachweislich mit einer geringeren Besorgnis für globale Umwelt- und Sozialprobleme einhergeht. Beispiele hierfür sind Macht, Leistung oder auch finanzieller Erfolg. Zudem steigt bei solchen Wertorientierungen die Wahrscheinlichkeit für geringere Empathie, vermehrt manipulatives Verhalten, hierarchisches Denken, stärkere Vorurteile, weniger Großzügigkeit, geringeres politisches Engagement und mehr Konkurrenzverhalten. Wie du dir sicherlich denken kannst, handelt es sich dabei um Qualitäten, die einer nachhaltigen Entwicklung nicht gerade dienlich sind.
Darüber hinaus gibt es mittlerweile einige Studien, die zeigen, dass selbsttranszendierende Werte auch mit dem persönlichen Klimaengagement in engem Zusammenhang stehen.48 In einer der ersten Publikationen, die sich explizit mit der Beziehung zwischen Werten und Überzeugungen zum Klimawandel befasste, sollte die Akzeptanz politischer Klimaschutzmaßnahmen untersucht werden. Man fand heraus, dass die Bereitschaft, politische Maßnahmen zu akzeptieren, positiv mit selbsttranszendierenden Werten zusammenhing. Außerdem zeigten nachfolgende Untersuchungen, dass jene Menschen, die biosphärisched und altruistische Werte vertraten, eher Bedenken hinsichtlich der Risiken und Folgen des Klimawandels hatten und weniger skeptisch waren gegenüber der Schwere des Problems als Menschen mit egozentrischen Werten.
Andere Studien wiederum untersuchten den Einfluss von extrinsischen und intrinsischen Werten auf das individuelle Verhalten. Zur Erklärung: Als intrinsisch werden jene Werte bezeichnet, welche die angeborenen, psychologischen Bedürfnisse direkt befriedigen und eher nicht von materieller Natur sind, während extrinsische Werte kompensatorisch eingesetzt werden, meist mit materiellen Gütern in Verbindung stehen und nicht per se befriedigend wirken.49
Beispiele für intrinsische Werte sind etwa persönliches Wachstum, emotionale Beziehungen oder das Gemeinschaftsgefühl. Extrinsische Werte gehen in Richtung Image, Status oder finanzieller Erfolg. Sieht man sich die Studienergebnisse an, so zeigen diese quer durch die Bank, dass intrinsische Wertorientierungen nicht nur mit höherem Wohlbefinden, sondern auch mit einer höheren sozialen und ökologischen Verantwortung gekoppelt sind, während sich Menschen mit extrinsischen Werthaltungen weniger umweltfreundlich verhalten.
So stellte man etwa bei einer Untersuchung mit knapp tausend Universitätsstudenten aus sechs Nationen fest, dass Studierende mit hohen Werten bezüglich Macht und Leistung andere Menschen eher als Konsumenten und nicht als Teil der Natur betrachteten.50 Diese Studierenden hatten auch viel weniger Sorgen angesichts der Tatsache, dass sich Umweltschäden negativ auf Mitmenschen, Kinder, künftige Generationen oder nicht-menschliches Leben auswirken.
Natürlich lassen sich solche Effekte nicht nur individuell, sondern auch auf der Ebene ganzer Nationen beobachten. So fand im Jahr 2011 eine Untersuchung statt, wie sich unsere kulturellen Werte auf das Wohlbefinden künftiger Generationen auswirken.51 Bei den zwanzig reichsten Nationen unseres Planeten wurde etwa festgestellt, dass jene Länder, die Harmonie und Miteinander als gesellschaftliche Werte verfolgten, pro Kopf weniger CO2 emittierten als Länder, die Wohlstand, Leistung und Status eine höhere Priorität einräumten. Die Harmonie-orientierten Länder wiesen auch ein größeres Wohlbefinden bei den Kindern auf, die nationalen Gesetze zum Mutterschaftsurlaub waren großzügiger gestaltet und es gab weniger an Kinder gerichtete Werbung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen!
Zusammenfassend ist es aus Sicht der Forschung also unbestritten, dass es gewisse Werte gibt, die ein sozial- und umweltrelevantes Verhalten stärker begünstigen, als andere Werte dies tun. Deshalb ist es auch so wichtig, die innere Dimension der Werte in all den Debatten rund um die Nachhaltigkeit genauso zu berücksichtigen wie soziale, ökologische, ökonomische oder technische Fragestellungen.