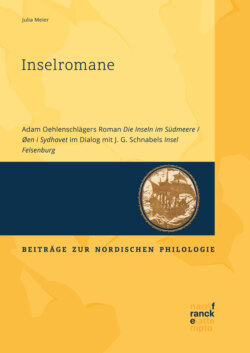Читать книгу Inselromane - Julia Meier - Страница 11
1.2.5 Aufbau der Arbeit
ОглавлениеDie Einleitung widmet sich dem Entwicklungsverlauf von Oehlenschlägers Verhältnis zu seiner Vorlage, sowie der Rezeption seines Romans und dem Stand der Forschung. In einem buchgeschichtlich orientierten Unterkapitel wird das Zustandekommen der deutschen Erstausgabe in den brieflichen Verhandlungen mit dem Verleger CottaCotta, Johann Friedrich nachgezeichnet, auch mit Blick auf Oehlenschlägers Interesse für die Gestaltung der Erscheinungsform seines Romans. Ausserdem wird über die Entstehung der späteren Fassungen in zwei Sprachen berichtet.
Kapitel 2 bringt eine Zusammenfassung der inhaltlichen und strukturellen Hauptzüge der Inseln im Südmeere und der Wunderlichen Fata, die verhältnismässig ausführlich gehalten ist, um gleichsam als Prämisse die wesentlichen Parallelen und Differenzen zwischen den beiden Werken aufzuzeigen und so die Grundlage für bestimmte Einzelanalysen zu schaffen. Diese folgen in ihrer Anordnung nicht der Romanchronologie, weshalb die Zusammenfassung auf einen kohärenten Handlungsüberblick angelegt ist, in den sich die Detailanalysen einordnen lassen.
Darauf folgt in Kapitel 3 eine Annäherung an die „Zweisprachigkeit“ von Oehlenschlägers Roman, eingeleitet von allgemeinen Bemerkungen zur deutschen und dänischen Produktion des Autors; anschliessend gehe ich auf die spezifische Ausprägung dieser Produktionsweise in den IS ein, wobei ich hier schwerpunktmässig auf Übersetzungstheorien zurückgreife, die aber auch sonst die Basis weiterer Vergleiche der dänischen und deutschen Fassung bilden, welche die analysierten Passagen in den meisten Fällen abschliessen. Ein Unterkapitel behandelt Fragen der Zwei- und Mehrsprachigkeit auch auf der Figurenebene.
Im 4. Kapitel werden exemplarisch polyphone und intertextuelle Beziehungen zwischen den beiden Romanen untersucht, teils basierend auf den vorgestellten Intertextualitätstheorien, aber auch auf Erkenntnissen aus paratextuellen und psychoanalytischen Forschungen.
Kapitel 5 und 6 behandeln verschiedene Aspekte der Figurendarstellung in ihrer Beziehung zu literarischen und allgemein künstlerischen Phänomenen, während Kapitel 7 auf die Funktion diverser Schauplätze im Roman fokussiert, die sich im 8. Kapitel zur Hauptsache auf einen Schauplatz, nämlich die Bühne, verdichten – nach oft vertretener Ansicht die eigentliche dichterische Sphäre Oehlenschlägers, die im Roman polyvalent für Aufführungen verschiedenster Art, aber auch als imaginärer Ort für dramentheoretische Reflexionen eingesetzt wird.
Diese unterschiedlichen Analysestrategien – gleichsam Annäherungsversuche aus verschiedenen Blickwinkeln – haben zum Ziel, den Roman auf mehreren Ebenen als Produkt und Schnittpunkt vielfältiger Textbeziehungen zu zeigen, die immer wieder bald explizit, bald in verhüllter Form reflektiert werden; dabei ergibt sich, wie die Arbeit zum Ausdruck bringen soll, eine Umakzentuierung des Prätextes, die dazu führt, dass die mehrstimmige Basis von Schnabels Werk für eine zwar ebenfalls polyphone Erzählform funktionalisiert wird, in der jedoch primär andere Textstimmen die Hauptrolle spielen: Es entsteht ein selbstreflexiver Text über Texte.