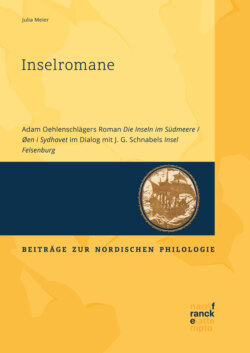Читать книгу Inselromane - Julia Meier - Страница 14
1.5 Materialität der Fassungen1
ОглавлениеInsgesamt wurde der Roman achtmal in gedruckter Form herausgegeben, fünfmal in dänischer und dreimal in deutscher Sprache. Dazu kommen ein Teildruck der deutschen Erstausgabe und eine dänische Ausgabe in elektronischer Form.
| Titel | Jahr | Verlag | Ort |
| Die Inseln im Südmeere | 1826 | Cotta | Tübingen |
| 1839 | Max u. Comp. | Breslau | |
| [1911] | Holbein | Stuttgart | |
| 2018 (nur Bd. 1) | Inktank | [Bremen] | |
| Øen i Sydhavet | 1824–25 | Verfasser | Kopenhagen |
| 1846 | Høst | Kopenhagen | |
| 1852 | Høst | Kopenhagen | |
| 1862 | Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter | Kopenhagen | |
| 1904 | Gyldendal | Kopenhagen | |
| 2013 | eBibliotek 1800 | Internet |
Angesichts der mehrheitlich ablehnenden Haltung sowohl der zeitgenössischen wie der späteren Rezeption mag die Anzahl der Ausgaben erstaunen. Dabei unterscheidet sich der Roman in der zweiten Auflage erheblich von der Erstausgabe, da Oehlenschläger als Reaktion auf die abweisende Kritik in beiden Sprachen eine stark gekürzte Fassung erstellte. Bevor ich auf diese gekürzten Ausgaben eingehe, sollen zunächst die beiden Erstfassungen besprochen werden, und zwar mit Blick auf bestimmte Aspekte ihrer Materialität, wie z.B. die Buchgestaltung und die verlagstechnischen Hintergründe des Zustandekommens der gedruckten Bücher. Über den Weg, den die Texte von Oehlenschlägers Projekt bis zur schliesslichen Edition durchliefen, orientieren vor allem briefliche Zeugnisse. Ich greife daher für die deutsche Erstfassung auf Oehlenschlägers Briefwechsel mit Johann Friedrich CottaCotta, Johann Friedrich zu Druck und Publikation des Inselromans zurück, denn auch in diesem Fall sind Briefe „die zentrale buchhandelsgeschichtliche Quelle für den eigentlichen Produktionsprozess, sie geben über die Genese eines Buchs oder das Scheitern eines Plans Auskunft“ (Estermann 2010: 265).
Da noch bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts die von den Druckereien gelieferten Publikationen in den Buchhandlungen lediglich als lose Bögen oder Broschüren ohne Einband verkauft wurden (Hilz 2019: 116), blieb es dem potentiellen Käufer überlassen, ob und allenfalls in welcher Ausstattung er das Buch binden lassen wollte, nachdem das Titelblatt auf den Druckbogen – das Erste, was ihm als zukünftigem Leser ins Auge fiel – sein Interesse geweckt und ihn in Kurzform über Titel, Autor und Gattung einer Publikation informiert hatte. Oehlenschlägers Inselroman präsentierte sich, was das Titelblatt betrifft, ausgesprochen einfach. Die beiden Titelblätter der deutschen und der dänischen Erstfassung weisen eine frappante Ähnlichkeit auf, wie die nebeneinander gelegten Seiten zeigen:
Abb. 1: Die Titelblätter der beiden Erstausgaben (Foto privat)
Nicht nur wird für beide Texte – wenn auch in etwas unterschiedlichen Varianten – Frakturschrift verwendet; die Seitengestaltung ist in der Anordnung der einzelnen Elemente ebenfalls weitgehend identisch. Insbesondere, was die Wahl des Schrifttypus betrifft, zeigen sich in der wechselhaften Geschichte der Verwendung von Fraktur und Antiqua deutliche Parallelen im dänischen und deutschen Buchdruck: Während um 1800 für gewisse auf Innovation ausgerichtete Publikationen die Antiqua bevorzugt wurde, da diese Schrift im Einklang mit dem avantgardistischen Anspruch des Inhalts auch formal Neuheit und Bruch mit Traditionen signalisierte, kehrten die Verlage schon bald wieder zur Fraktur zurück, was in beiden Ländern hauptsächlich mit den verbreiteten Lesegewohnheiten zusammenhing. Sehr anschaulich beschreibt dies Johnny Kondrup am Beispiel von Oehlenschlägers Digte und deren Inspirationsquelle, Henrich Steffens Inledning til filosofiske Forelæsninger, beide 1803 erschienen und in Antiqua gedruckt, während schon Oehlenschlägers folgende Publikationen, Poetiske Skrifter von 1805 und Nordiske Digte von 1807, wieder in Fraktur herausgegeben wurden, wie praktisch die ganze „Guldalder“-Literatur (Kondrup 2011: 287–288).2Schlegel, August WilhelmTieck, Ludwig Beim damaligen Lesepublikum war die traditionelle Fraktur beliebter als die ungewohnte Antiqua, die ursprünglich vorwiegend für Fremdwörter und fremdsprachige Texte verwendet wurde und deshalb den Eindruck erwecken konnte, man habe einen lateinischen Text vor sich, was zur Folge hatte, dass manche Leser sich auf die Lektüre gar nicht erst einliessen.3 Ähnliche Vorgänge schildert Susanne Wehde für dieselbe Zeit in Deutschland; auch sie stellt fest:
Der Durchsetzung der Antiqua standen (sic) vor allem die mangelnde typographische Kompetenz breiter Lesekreise entgegen. Die Lesefähigkeit war mehrheitlich an Fraktur-Schriften geschult. Antiqua-Formen waren dementsprechend ungewohnt und erschwerten das Lesen – so wie heute Fraktur-Schriften. (Wehde 2000: 236)4
Die Gestaltung der Titelblätter von Oehlenschlägers Roman folgt offensichtlich einem aus England und den romanischen Ländern stammenden Muster von bemerkenswerter Einfachheit und Klarheit, das im Gegensatz zur Antiqua auch in den deutschen Sprachraum übernommen wurde (Wehde 2000: 223–224 und 236). Dass Oehlenschläger sich an einem solchen Modell orientierte, scheint aus dem CottaCotta, Johann Friedrich gegenüber geäusserten Wunsch hervorzugehen, sein Roman solle „wie GoethesGoethe, Johann Wolfgang von Aus meinem Leben gedruckt seyn“ (Brief vom 21.8.1821, Breve B/3: 177)5Goethe, Johann Wolfgang vonCotta, Johann Friedrich oder, wie er später mit dem Verleger vereinbarte und in den Briefen an ihn mehrfach bekräftigte, „wie Goethes Kunst und Alterthum“ (BrC vom 16.2.1822).6Cotta, Johann FriedrichGoethe, Johann Wolfgang vonCotta, Johann Friedrich
Abb. 2: Titelblatt von Goethes Zeitschrift „Über Kunst und Alterthum“, Heft 1, 1816.
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Z 120 (1). © Klassik Stiftung Weimar.
Angesichts von Oehlenschlägers Goethe-Verehrung entsteht der Eindruck, dass sich der dänische Dichter, der Goethe immer wieder nachzueifern suchte, sogar die äussere Erscheinungsform von dessen Werken zum Vorbild nahm. Vielleicht empfand er in der inhaltlichen Fülle von GoethesGoethe, Johann Wolfgang von Zeitschrift, in der Gedichte, literarische Übersetzungen aus verschiedensten Sprachen sowie Kunst- und Literaturbetrachtungen über alle Grenzen von Zeit, Raum und Gattungen hinweg publiziert wurden, auch eine Verwandtschaft zum ähnlich weitgefächerten Spektrum seines Romans. Eine äussere Parallele besteht jedenfalls in der Mehrteiligkeit der beiden Werke – Goethes Zeitschrift erschien in umfangreichen, gut 200seitigen Einzelheften, von denen jeweils drei zu einem Band zusammengefasst wurden.7Goethe, Johann Wolfgang von Oehlenschläger gab CottaCotta, Johann Friedrich detaillierte Instruktionen, wie die verschiedenen Teile seines Romans zusammenzufügen seien (BrC vom 24.8.1824) und präzisierte im gleichen Brief mit der Nennung von Goethes Zeitschrift auch, dass das Buch wie diese eingerichtet werden solle, nämlich „jedes neue Kapitel auf seinem eigenen Blatte.“
Oehlenschlägers Wunsch bezieht sich also nicht nur auf die Gestaltung des Titelblattes, sondern auch auf den Druck und die Ausstattung des Buches insgesamt, das er sich „elegant“ und „hübsch“ wünschte, da dies den Absatz fördern würde: „Wäre es vielleicht aber nicht gut, und würde es zur Absetzung des Buches nicht beitragen, wenn es ein wenig elegant gedruckt würde?“ Oder: „[Das Werk] wird gewiss Leser bekommen, nur müssen Sie dafür sorgen, dass es hübsch gedruckt wird […].“ (BrC vom 3.8.1822 resp. 4.4.1823). Diese Anliegen zeigen Oehlenschlägers Interesse an der Materialität des Buches und sein Verständnis für deren ökonomische Auswirkungen auf dem Buchmarkt; es war ihm offensichtlich bewusst, dass „der verbesserten Ausstattung bei der gestiegenen Konkurrenz am Literaturmarkt eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu[kam]; die Ausstattung eines Buches wurde zum verkaufsfördernden Moment“ (Steiner 1998: 71; der Autor stellt die Bedeutung der Ausstattung für die Buchvermarktung im Übrigen schon für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fest). Oehlenschläger verlangt von CottaCotta, Johann Friedrich auch, das Buch nach dem Druck „schnell nach allen wichtigen Buchhaltungen [wohl irrtümlich für Buchhandlungen] zu schicken, damit der Augenblick der Neuigkeit benützt werde“ (BrC vom 4.4.1823).
Diese praktischen Anweisungen erstaunen nicht, wenn man bedenkt, dass Oehlenschläger sehr oft sein eigener Verleger war, womit auch ein augenfälliger Unterschied zwischen den beiden sonst so ähnlichen Titelblättern der deutschen und der dänischen Erstausgabe von Oehlenschlägers Roman zusammenhängt: Während die deutsche Fassung bei CottaCotta, Johann Friedrich, dem seit 1803 „führenden Verlag in Deutschland“ (Fischer, B. 2003, 1: 32) erschienen war, hatte der Autor die dänische Version im Eigenverlag herausgegeben. Für diese selbstverlegerische Tätigkeit scheint es verschiedene Gründe zu geben: Sicher bestand zu Beginn die Hoffnung, dadurch grössere Einnahmen zu erzielen als mit dem damals üblichen Verlagshonorar.8 Die Entscheidung für den Eigenverlag zeugt aber auch vom Selbstbewusstsein des Autors, der es sich zutraute, dank seiner Bekanntheit seine Werke erfolgreich selber zu vermarkten. Freilich scheint dies nur in der Anfangszeit von Oehlenschlägers schriftstellerischer Laufbahn wirklich gelungen zu sein, wie er selber einräumt: „Meine Schriften gingen wohl noch gut; aber nicht so reissend, wie in der ersten Frühlingszeit meines Auftretens […]. Ich verstand mich auch später nicht auf den Buchhandel […]“ (Meine Lebens-Erinnerungen 1850, 3: 8).9 Morten Møller erklärt in Dansk litteraturhistorie 4 zu den Bedingungen des dänischen Buchmarktes und des Verlagswesens im 18. und 19. Jahrhundert, der Eigenverlag sei als Publikationsplattform schon Ende des 18. Jahrhunderts kaum mehr benützt worden (1983: 545). Laut Møller begann sich damals das Verlagswesen als professionelle Institution zu etablieren, was dazu geführt habe, dass dem Lesepublikum allein schon das Erscheinen eines Werkes bei einem Verlag als Qualitätsgarantie galt, während den im Selbstverlag eines Autors publizierten Werken eher Misstrauen entgegengebracht wurde (1983: 545). Dies hinderte jedoch Oehlenschläger nicht daran, ab ca. 1811 nahezu sämtliche grösseren Arbeiten im Eigenverlag herauszugeben und sie ausserdem mehrmals zu vermarkten, indem er – ebenfalls im Eigenverlag – immer wieder neue Sammelausgaben seiner Werke veranstaltete, die er jeweils zur Subskription anbot (Liebenberg 1868, 1). Erst 1844 gab er diese verlegerische Tätigkeit auf und verkaufte die Verlagsrechte für einen Zeitraum von zehn Jahren an den Universitätsbuchhändler Andreas Frederik Høst, der in den folgenden Jahren in Zusammenarbeit mit dem Autor eine insgesamt 28 Bände umfassende, sogenannte „Godtkøbsudgave“ [„wohlfeile Ausgabe“] von Oehlenschlägers sämtlichen Werken herausbrachte, in die 10 Bände Tragödien, die der Autor zuvor noch im Eigenverlag ediert hatte, integriert waren (Dansk biografisk leksikon 2014–2016, online, Eintrag zu A.F. Høst).
Dass Oehlenschläger die dänische Fassung seines Inselromans im eigenen Verlag publizierte, entsprach also seiner jahrelangen verlegerischen Praxis, war aber gerade im Zusammenhang mit der Publikation in zwei Sprachen von besonderer Bedeutung: In mehreren Briefen bat er CottaCotta, Johann Friedrich, das versprochene Manuskript des Romans noch behalten zu dürfen; einerseits wollte er es erst von einem deutschen Freund durchsehen lassen, „um so viel wie möglich der etwannigen Danismen zu entfernen“ (BrC vom 28.10.1822), andrerseits aber beabsichtigte er, den Text gleichzeitig dänisch herauszugeben (BrC vom 3.8.1822, 28.10.1822 und 4.4.1823). Er plante sogar, den Roman deutsch, dänisch und englisch erscheinen zu lassen, alle drei Versionen zur gleichen Zeit (BrC vom 28.10.1822). Dank dem Bestehen seines eigenen Verlages hätte der Autor eine solche dreisprachige Publikation bis zu einem gewissen Grad koordinieren können, da er in der Lage war, zumindest das Erscheinen der dänischen Fassung zeitlich weitgehend selber zu bestimmen. Doch der Plan scheiterte: Walter ScottScott, Walter, der versprochen hatte, eine englische Übersetzung des deutschen Textes zu veranlassen und diese mit einem eigenen Vorwort herauszugeben, musste seine Zusage aufgrund erfolgloser Verlagsverhandlungen zurücknehmen, so dass eine englische Ausgabe nicht zustande kam (BrC vom 24.8.1824). Als die dänische Version bereit war, liess Cotta Oehlenschlägers Briefe und Bitten um nunmehr rasche Publikation des Romans längere Zeit unbeantwortet. Schliesslich teilt der Autor Cotta mit: „Das Buch erscheint jetzt im Dänischen auch, freilich habe ich in der Vorrede gesagt, dass ich selbst eine deutsche Ausgabe besorge, und Sie haben es ja auch in mehreren Blättern angekündigt, zu lange dürfen wir aber in keinem Falle mit der Herausgabe zaudern“ (BrC vom 24.5.1825). Es liess sich also auch mit dem Selbstverlag nicht einrichten, die deutsche und die dänische Version gleichzeitig erscheinen zu lassen. Die Publikation von Øen i Sydhavet erfolgte vorzeitig, weil Oehlenschläger auf die Einnahmen angewiesen war; zugleich befürchtete er, dass eine deutsche „Raubübersetzung“ diese schmälern könnte. Er erfuhr jedoch gar nicht, wann Cotta nun das deutsche Manuskript zu publizieren gedachte, und entdeckte erst 1826 in einer Kopenhagener Buchhandlung zufällig die Teile I und II der Inseln im Südmeere (BrC vom 7. Mai 1826.)
Diese Vorgänge erklären die merkwürdige Tatsache, dass der Roman, obwohl ursprünglich auf Deutsch verfasst, zuerst in dänischer Sprache erschien. Sie führten aber auch zu einer Verstimmung zwischen dem Autor und seinem Verleger, weshalb Oehlenschläger ihm ebenfalls am 7. Mai 1826 zwar mitteilte, er habe drei Theaterstücke gedichtet: „Meine dramatischen Arbeiten haben Sie ja bis jetzt immer noch haben mögen“, sich aber im selben Brief auf eine Trennung von CottaCotta, Johann Friedrich einstellte: „Wollen Sie gar nichts mehr mit mir zu thun haben – das sollte mir (sic) sehr schmerzen. Sagen Sie mir es dann auch gleich mit eingehender Post, damit ich mich zu einem andern Verleger wende […].“ Ein knappes Jahr später bietet Oehlenschläger Cotta jedoch sein Stück „Die Vareger (Nordhelden) in Constantinopel“ an, „das in meinem Vaterlande einstimmig für meine vielleicht beste Tragödie gehalten wird“ (BrC vom 28.4.1827). Cotta dankt für das Angebot und äussert seine Bereitschaft, das Stück herauszubringen, teilt dem Autor aber zugleich mit, dass er das Honorar mit dem hohen Verlust verrechnen müsse, den er durch die „Insel d. Sudmeers“ (sic) erlitten habe (Brief vom 10.7.1827, Breve B/3: 334).10 Möglicherweise führte der unerfreuliche Verlauf der Editionsgeschichte des Romans letztlich zum Ende der Verlagsbeziehung zwischen Cotta und Oehlenschläger;11Cotta, Johann Friedrich jedenfalls gab Oehlenschläger sein Stück nicht bei Cotta, sondern beim Berliner Verleger A.M. Schlesinger heraus und bot Cotta keine weiteren Arbeiten an.
Allerdings bleibt nachzutragen, dass Oehlenschläger den Kontakt im Jahr 1836 wieder aufnahm, indem er CottasCotta, Johann Friedrich Sohn Johann Georg, der nach dem Tod seines Vaters 1832 den Verlag übernommen hatte, ein Buch mit dem Titel Über die schöne Seele, die echte Humanität in GoethesGoethe, Johann Wolfgang von besten Werken in Aussicht stellte, das er als Verteidigung gegen Wolfgang Menzels Angriffe auf Goethe verfassen wolle (Brief vom 26.7.1836, Breve C/2: 17).12Goethe, Johann Wolfgang von Es war also vermutlich seine lebenslange Goetheverehrung, die Oehlenschläger bewog, sich in dieser Sache nach dem Kontaktabbruch doch wieder an den Cotta’schen Verlag und damit an Goethes Hauptverlag zu wenden. Eine Antwort J.G. CottasCotta, Johann Georg auf das Anerbieten ist allerdings nicht bekannt, und Oehlenschläger schrieb das geplante Buch nicht. Hingegen schlug ihm J.G. CottaCotta, Johann Georg mit Brief vom 2.12.1841 vor, eine von seinem Vater 1817 herausgegebene Gedichtsammlung in schönerer Aufmachung neu zu edieren, denn die Gedichte verkauften sich sehr schlecht, was er, Cotta, einzig der Ausstattung zuschreibe,13Cotta, Johann Friedrich während „Ihre [d.h. Oehlenschlägers] herrlichen, für immer schöne Dichtungen“ eine bessere Verbreitung verdient hätten (Breve C/2: 241). Oehlenschläger willigte sogleich ein, obwohl die Gedichte inzwischen Bestandteil einer von Josef Max verlegten Gesamtausgabe waren – aber der Autor war der Meinung, da das Werk früher dem Cotta’schen Verlag gehört habe, sei gegen eine Neuedition nichts einzuwenden. Er versprach, die Sammlung noch mit neuen Gedichten anzureichern, denn er habe „dänisch gewiss zwölfmal so viel lyrisch gedichtet als diese Sammling (sic) enthält.“ (Brief vom 18.1.1842, Breve C/2: 242). Die Gedichtsammlung erschien 1844. Ob sie sich in der neuen Ausstattung tatsächlich besser verkaufte, liess sich nicht eruieren. Jedoch scheinen diese letzten Kontakte mit dem Cotta’schen Verlag immerhin darauf hinzuweisen, dass eine gewisse, wenn auch vielleicht nur punktuelle Wertschätzung von Oehlenschlägers Arbeiten sogar in Deutschland noch bestand. Ausserdem wird deutlich, dass J.G. CottaCotta, Johann Georg die Bedeutung der Ausstattung seiner Verlagsprodukte für die Vermarktung erkannt hatte und sich um Verbesserungen bemühte, auch im eigenen Interesse, wobei solche Bemühungen natürlich dem Autor und seinem Werk ebenfalls zugutekamen.
Was die Inseln im Südmeere betrifft, so wurde der Roman, wie erwähnt, trotz der mehrheitlich kritischen Rezeption (vgl. Kap. 1.4) in beiden Sprachen ein zweites Mal herausgegeben, wobei die zweite Auflage als direktes Resultat der negativen zeitgenössischen Kritik zu sehen ist;14 diese brachte Oehlenschläger dazu, seinen Text in beiden Sprachen stark zu kürzen, was er in seiner Autobiographie Levnet, nach der Feststellung, dass sein Roman in Dänemark keinen Anklang gefunden habe, mit folgenden Worten ankündigt:
Forresten vil jeg gerne tilstaae, at Øen i Sydhavet har den almindelige Romanfeil: den er for vidtløftig. En Trediedeel kunde til Fordeel for Værket være udeladt. Dette vil ogsaa skee engang, hvis den skulde opleve et nyt Oplag. (Levnet II: 206)15
In Oehlenschlägers Lebens-Erinnerungen von 1850 lautet die Stelle:
Übrigens will ich gern gestehen, dass die Inseln im Südmeer einen üblichen Fehler von Romandichtungen hatten, das Werk war zu weitläufig. Ein Drittheil hätte zum Vorteil des Werkes fortgelassen werden können. (Meine Lebens-Erinnerungen 4: 18)
Dabei ist der letzte Satz des dänischen Zitats aus Levnet [deutsch: „Das wird auch einmal geschehen, sollte er (d.h. der Roman) eine neue Auflage erleben“] ersetzt durch die Erklärung: „Dies ist bei den neuen Auflagen sowohl im Dänischen wie im Deutschen geschehen“ (Meine Lebens-Erinnerungen 1850, 4: 18). Die deutsche gekürzte Version erschien 1839 in Adam Oehlenschlägers Werken, zum zweiten Mal gesammelt, vermehrt und verbessert, Bd. 15–18; die dänische 1846 in Oehlenschlägers samlede Værker Bd. 20–21, resp. Oehlenschlägers Digterværker Bd. 11–12; dabei wurden von den 2’500 Exemplaren des Romans 1000 Exemplare als Sonderausgabe mit eigenem Titelblatt gedruckt (Liebenberg 1868, 1: 209–211). Diese Edition wurde 1852 in der Werkausgabe Oehlenschlägers Digterværker og prosaiske Skrifter, Bd. 15–16, mit geringfügigen Änderungen nachgedruckt.
Für die Natur dieser Kürzungen interessierte sich die Forschung bisher nicht, da auch der Umstand, dass der Roman in verschiedenen Fassungen erschien, kaum je Beachtung fand. Eine Ausnahme bildet Frederik Ludvig Liebenberg, Oehlenschlägers treuester und fleissigster Herausgeber; er referiert die Fassungsgeschichte in seiner 32bändigen Gesamtausgabe Oehlenschlägers Poetiske Skrifter (1857–1862), wobei er auch auf die Tatsache der zweisprachigen Versionen eingeht (Bd. 27: 353) und bemerkt, dass die erste deutsche Ausgabe von 1826 für ihn nicht greifbar gewesen sei (Bd. 27: 359). Was die Begründung für die gekürzte Fassung angeht, stimmt er Oehlenschläger weitgehend zu:
Forkortningen er i det Hele foretaget med afgjort Held, idet den har afhjulpet Originalens altfor store Ordrighed, og fjernet en Mængde af vel almindelige Reflexioner og af historiske Specialiteter og Anecdoter, der var blevne hængende ved fra Oehl.s Forstudier til Værket. (Oehlenschlägers Poetiske Skrifter 1862, 27: 353)
Die Kürzung ist im Ganzen entschieden geglückt, indem sie die übermässige Weitschweifigkeit des Originals straffte und eine Menge recht allgemeine Reflexionen, sowie historische Spezialitäten und Anekdoten beseitigte, die aus Oehlenschlägers Vorstudien zum Werk hängengeblieben waren.
Allerdings macht er auch gewisse Einschränkungen:
Kun hist og her er Digteren kommen til at bortskære for Meget, saa at ikke blot enkelte Skjønheder (navnlig et Par Digte) ere faldne ud, men endog Sammenhængen undertiden har lidt derved. (Oehlenschlägers Poetiske Skrifter 1862, 27: 353)
Nur hie und da hat der Dichter den Text zu sehr beschnitten, so dass nicht nur einzelne schöne Dinge (namentlich einige Gedichte) weggefallen sind, sondern sogar der Zusammenhang manchmal gelitten hat.
Deshalb übernimmt er weder die erste noch die zweite Fassung in seine Werkausgabe, sondern kompiliert aus den beiden eine eigene,16 wobei er allerdings mehrheitlich der gekürzten Ausgabe folgt. Getreu seiner Editionspraxis nimmt er im Anhang die von Oehlenschläger gestrichenen Stellen – also ungefähr einen Drittel des Gesamttextes – integral auf, so dass sich das Lesepublikum, wenn auch auf eher mühsame Weise, immerhin ein Bild von der ungekürzten Version und dem Umfang der Streichungen machen könnte. Ein differenziertes Urteil über Liebenbergs Ausgabepraxis formuliert Johnny Kondrup in seiner Studie zur Editionsphilologie, wonach Liebenbergs Vorgehen den Usanzen seiner Zeit entsprochen habe, so dass die später erhobene Kritik, dieser habe die gesammelten Änderungen eines Autors an den eigenen Werken mehr oder weniger nach Gutdünken zur Herstellung seiner Ausgaben benützt, nicht wirklich berechtigt sei, da sie den historischen Gegebenheiten der damaligen Editionspraxis zu wenig Rechnung trage (Kondrup 2011: 120).
Die Kürzung der deutschen Fassung erschien, wie erwähnt, in der zweiten Gesamtedition von Oehlenschlägers Werken, die Josef Max in Breslau 1839 herausgab. Dieser Verleger hatte dem Autor mit Brief vom 25.5.1828 angeboten, seine „vortrefflichen Schriften […] vollständig gesammelt in einer neuen Ausgabe“ herauszubringen (Breve B/3: 358), zu einer Zeit, als Oehlenschläger „schon die Hoffnung aufgegeben [hatte], als Schriftsteller in Deutschland ferner noch aufzutreten“ (Meine Lebens-Erinnerungen 1850, 4: 56). Max nannte als ersten Punkt seiner „Verlag-Bedingungen“: „Mit Ausschluss des grössern Romans: Die Inseln der Südsee, erschiene in meinem Verlage eine Gesammt Ausgabe Ihrer Schriften, eingetheilt in dramatische, lyrische und erzählende Schriften“ (Brief vom 25.5.1828, Breve B/3: 359). Der Roman sollte also nicht aufgenommen werden, vermutlich, weil die Verlagsrechte noch bei CottaCotta, Johann Friedrich waren. So jedenfalls interpretiert Patricia F. Blume die Sachlage in ihrem umfassenden Artikel zu Josef Max’ Verlagstätigkeit, in dem sie hervorhebt, dass „Max das Recht anderer Verlage respektierte“ und sich noch vor der Einführung des Urheberrechtsgesetzes durch Preussen 1837 als Verleger „in einem fortschrittlichen Sinne loyal gegenüber geistigem Eigentum“ verhalten und „eine moderne Urheberrechtsauffassung“ vertreten habe (Blume 2015: 114). Die Autorin referiert ausführlich sowohl das Zustandekommen dieser Gesamtausgabe von Oehlenschlägers Werken, das sie als „Mammut-Projekt“ des Verlegers bezeichnet (Blume 2015: 112), wie auch den enttäuschend schleppenden Absatz der Ausgabe, für die nicht genügend Subskriptionen eingingen, so dass Max zunächst nur 1000 der vereinbarten 2000 Exemplare drucken liess (Blume 2015: 117–122). Die zweite Auflage sollte erst erscheinen, nachdem die erste, die 1829–1830 erschien, vollständig verkauft war. Im Hinblick darauf bietet Oehlenschläger mit Brief vom 30.5.1833 dem Verleger eine gekürzte Fassung seines Romans an: „Ich höre, dass mein Roman: Die Inseln im Südmeere doch einiges Aufsehen macht. Was sagen Sie dazu diesen Roman in drei Theilen verkürzt herauszugeben und zu verlegen?“ (Breve C/1: 198, gesperrt im Original). Einige Jahre später konkretisiert sich die zweite Auflage, und Oehlenschläger teilt dem Verleger Genaueres zu seinen Kürzungsabsichten in Bezug auf den Roman mit:
Was nun die Inseln im Südmeere betrifft, so freut es mich sehr, dass Sie dieses Produkt so sehr lieben, es ist mir auch immer eine meiner liebster (sic) Dichtungen gewesen. […] Was nun aber die Verkürzungen betrifft (ich habe das Werk wieder durchgesehen) so müssen wir uns doch hüten es knippelhaft zu machen, und gar zu viel abzuschneiden. Alle Ausschweifungen, und wo die Räsonnements etwas in ästhetische Abhandlungen hinauslaufen (wie Sie selbst ganz richtig bemerkten) müssen wir wegschneiden. Auch weitschweifige Redensarten; der Styl kann sehr verkürzt oft werden (sic), wodurch wir viel Raum gewinnen. Begebenheiten, Charakterzüge und das lebendige Colorit vieler Nebensachen, müssen wir aber behalten. Kurz: Sie müssen mir freie Hand darüber geben, und ich werde es gewiss gewissensvoll nach besten Kräften, wie mir Kunst und Geschmack biethen, ausführen. Und wohl möglich, dass es dann nicht mehr als zwei Bände (wie die stärksten unserer vorigen Ausgabe) ausmachen werde. (Brief vom 21.4.1838, Breve C/2: 102–103)
Offensichtlich wünscht sich der Verleger, im Interesse einer Aufnahme des Romans in die neue Werkausgabe, eine Reduktion der vierbändigen Fassung auf lediglich zwei Bände, was Kürzungen bedingen würde, deren Ausmass die vom Autor selbst vorgeschlagenen Streichungen überschreitet, weshalb er sie argumentativ zu begrenzen versucht. Im gleichen Brief äussert er sich auch über die verlagsrechtliche Bindung an CottaCotta, Johann Friedrich, dem er sich nicht mehr verpflichtet fühle, da er „gar keinen Accord“ mit ihm gemacht habe; zudem habe Cotta seinen Correggio jahrelang nicht publiziert: „10 Jahre hatte er das Stück vorher liegend im Pulte gehabt – und Palnatoke hatte er weggeschmissen, so dass erst das Manuscript nach mehreren Jahren gefunden und gedruckt ward.“ (Breve C/2: 103).17Cotta, Johann Friedrich Aus all diesen Gründen fühle er sich nun berechtigt, den Roman in einer Gesamtausgabe herauszugeben, umso mehr, als er ihn verändert und verkürzt habe. Die Fassungsvergleiche der vorliegenden Arbeit sollen unter anderem auch zeigen, wie das skizzierte Kürzungsprogramm konkret umgesetzt wurde.
Ob dieser gekürzten Fassung mehr Erfolg beschieden war als dem ursprünglichen Text, lässt sich anhand der überlieferten Dokumente nicht eindeutig feststellen. Aus Briefzeugnissen ist ersichtlich, dass auch der Absatz der zweiten deutschen Werkausgabe von 1839 nur langsam vor sich ging, wie u.a. der Brief von Josef Max vom 26.3.1840 dokumentiert (Breve C/2: 190–191). Dabei hatte Oehlenschläger eigens für diese Ausgabe noch „eine ziemlich grosse Vorrede“ verfasst, in der Absicht, „den Leser auf den richtigen Gesichtspunkt meiner Werke zu bringen“ (Brief vom 3.7.1838, Breve C/2: 118). Er empfiehlt dem Verleger, diese Vorrede in den „litterarischen Unterhaltungsblättern“ drucken zu lassen, denn, wie er aufgrund leidvoller Erfahrungen fortfährt:
Das würde uns vielleicht vor diesem oder jenem hassenden und anonymen Feind hüten, der Lust haben könnte, das Werk niederzureissen. Schön und nützlich wäre es, wenn Sie diesen oder jenen Ehrenmann dazu bewegen könnten, ein gutes und bedeutendes Wort über das Werk zu sagen, ehe wieder ein armer Schmierer in seiner Anonymität verschanzt Koth danach wirft. (Breve C/2: 118–119)18
Eine Rezension in den Blättern für literarische Unterhaltung vom 15. Februar 1839 behandelt denn auch die neue Gesamtausgabe sehr respektvoll und äussert, neben kritischen Bemerkungen, viel Lob und Anerkennung, bezieht sich aber fast ausschliesslich auf Oehlenschlägers dramatische Produktion und reiht Die Inseln in der Südsee (sic) in die „übrigen Werke Öhlenschläger’s“ ein, die der Rezensent19 in seiner Besprechung übergehen möchte, „insofern sie, obgleich an sich werthvoll, nicht zu seinen Hauptdichtungen gehören“ (Blätter für literarische Unterhaltung 46/1839: 187).
In seiner gekürzten Form wurde der Roman in der dänischen wie in der deutschen Version anfangs des 20. Jahrhunderts noch einmal herausgegeben. Dies überrascht naturgemäss weniger bei der dänischen Neuausgabe, die 1904 in zwei Bänden vom Verlagshaus Gyldendal – übrigens erstmals in Antiqua – publiziert wurde und laut einer kurzen, dem Text vorangestellten Erklärung des Verlags als Ergebnis einer Abgleichung des 1852 erschienenen Nachdrucks der Kürzung von 1846 mit Liebenbergs Ausgabe von 1862 zustandekam. Trotz aller Fehden, Angriffe und einer zunehmend kritischen Einschätzung seiner Werke war Oehlenschläger im nationalen Gedächtnis als herausragende Dichterpersönlichkeit präsent geblieben. Ausserdem ist die Ausgabe wohl auch im Zusammenhang mit dem Gedenken an Oehlenschlägers Tod zu sehen, der sich 1900 zum 50. Mal jährte, – ein Ereignis, das u.a. Vilhelm Andersen veranlasste, seine bereits erwähnte, umfassende Monographie über Oehlenschlägers Leben und Werk herauszugeben.
Abb. 3: Titelblatt der Ausgabe von 1904 (Foto privat)
Eine Neuausgabe hat der Roman – trotz des Verdikts von Jens Kistrup und Jurij Moskvitin in Weekendavisen – in jüngster Zeit wieder erlebt: der online-Verlag eBibliotek 1800 hat Øen i Sydhavet 2013 im epub-Format herausgebracht. Als Grundlage für die Publikation diente nicht etwa Gyldendals verhältnismässig modern anmutende Ausgabe, sondern jene Liebenbergs von 1862, d.h. dessen Version der gekürzten Romanfassung. Der Verlag gibt an, er nehme für seine Publikationen aus der Zeit zwischen 1800 und 1945 jeweils eine „schonende Bearbeitung“ vor, indem er die „typographischen Hindernisse“, wie „altmodische Rechtschreibung und gotische Schrift“ beseitige und „in gewissen Fällen“ auch Teile des Textes sprachlich modernisiere.20 Die epub-Ausgabe von Øen i Sydhavet wurde mit einem farbenprächtigen Cover geschmückt: Das Gemälde Miranda – The Tempest des präraffaelitischen Malers John William Waterhouse von 1916 prangt nun als virtueller Buchdeckel auf Oehlenschlägers Werk, eine Wahl, die der Autor vielleicht gebilligt hätte, besonders angesichts der wichtigen Rolle, die ShakespeareShakespeare, William – und nicht zuletzt The Tempest – in seinem Roman spielt. Es ist zu hoffen, dass das dramatische Coverbild21 und die veröffentlichte „Leseprobe“ attraktiv genug sind, um das Interesse der Lesenden zu wecken und festzuhalten, auch wenn man es bedauern mag, dass nicht die ungekürzte Fassung für diese neue Publikation gewählt wurde; in deren Impressum wird die Erstausgabe von 1824–1825 immerhin noch aufgeführt.
Abb. 4: Buchcover der dänischen e-book-Ausgabe. © eBibliotek 1800
Was nun die deutsche Kurzfassung betrifft, so wurde sie im Jahr 1911 nochmals ediert, zu einer Zeit also, da Oehlenschläger im deutschen Sprachgebiet kaum mehr zu den bekannten oder gar berühmten Dichtern zählte.22 Das literarische Umfeld dieser Publikation scheint darauf hinzuweisen, dass sie mit dem seit einiger Zeit wieder erwachten Interesse an Schnabels Insel Felsenburg zusammenhängen könnte. Ausschlaggebend für diese neue Aufmerksamkeit dürfte einerseits gewesen sein, dass der Literarhistoriker Adolf Stern in einem längeren Artikel Näheres zu Schnabels bis dahin im Dunkeln gebliebener Biographie veröffentlicht hatte (Stern, A. 1880: 317–366), andrerseits wurde die Insel Felsenburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend als historischer Roman gelesen, eine Gattung, die sich gerade in jener Zeit ausserordentlicher Beliebtheit erfreute.23 Auch Stern selbst sah Schnabels Roman teilweise als historiographisches Dokument, was allein schon die Veröffentlichung seines Artikels, der sich mit der Insel Felsenburg ebenso befasst wie mit der Person ihres Verfassers, im Historischen Taschenbuch zeigt,24 was aber auch in seiner Auffassung deutlich wird, Schnabel habe durch die vielen eingeflochtenen Biographien ein prägnantes Bild der bürgerlichen Welt Deutschlands in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gezeichnet (Stern, A. 1880: 342). Mit Sterns Artikel setzte eine eigentliche Forschungstätigkeit zu Schnabel und seinem Werk ein, die zu einer neuen Edition von Band 1 der Erstausgabe der Insel Felsenburg führte,25 sowie in den Jahren 1911/12, also gleichzeitig mit dem Erscheinen der Neuausgabe von Oehlenschlägers Inselroman, erste Dissertationen hervorbrachte.26 Zudem erschien, ebenfalls 1911, unter dem Titel Der deutsche Robinson, eine stark gekürzte und sprachlich vereinfachte Lebensgeschichte des Albert Julius, bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Fischer (Stach 1991: 117).
In der Einleitung des Berliner Literaturwissenschaftlers Richard Moritz Meyer zur Neuausgabe von Oehlenschlägers Inseln im Südmeer wird die vermutete, vom Interesse für Schnabel und sein Werk ausgehende Motivation für die Neuauflage von Oehlenschlägers Roman greifbar, denn diese Einleitung befasst sich viel ausführlicher mit Schnabel und der Insel Felsenburg als mit dem Roman, dem sie vorangestellt ist. Zunächst jedoch beschreibt Meyer das äussere Erscheinungsbild der verschiedenen Werke, die er in seinem Aufsatz behandelt:
Vor mir liegen die „Wunderlichen Fata einiger Seefahrer“ in drei Bearbeitungen. Da ist zunächst die Originalausgabe oder vielmehr eine der Originalausgaben mit dem schön in Rot und Schwarz gedruckten Titel, Band drei mit einer zweiteiligen Abbildung von Sarg und Grabpyramide des Albertus Julius verziert; dann die beiden Erneuerungen, auf schlechtem Papier und in grauem Druck: TiecksTieck, Ludwig „Insel Felsenburg“ in sechs und Öhlenschlägers „Inseln im Südmeer“ in vier Bänden, jene von 1828, diese von 1826. (Meyer [1911]: VII)27
Der Aufsatz offenbart die Hochschätzung Meyers für Schnabels Roman, während er die damals noch allgemein Tieck zugeschriebene Bearbeitung weitgehend negativ beurteilt, vor allem in Bezug auf die sprachlichen Neuerungen, die ein „ziemlich mattes Deutsch zweiter Hand“ ergeben hätten (Meyer [1911]: XIII). Diese Einschätzung Meyers scheint eine Entsprechung in der äusseren Gestaltung der Ausgaben zu finden: Das schön geschmückte und mit einer Abbildung verzierte Buch repräsentiert Schnabels Werk in würdiger Form, der „graue Druck“ auf „schlechtem Papier“ dagegen passt zu „TiecksTieck, Ludwig unzureichender Modernisierung“ ([1911]: XIV). Ganz anders verhält es sich bei Oehlenschläger, in dem Meyer den „einzige[n] wirkliche[n] ‚Bearbeiter‘ des Buches“ sieht ([1911]: X), der durch seine Erneuerung Schnabels Werk gewissermassen zu neuem Leben erweckt, ja, eigentlich zu höherer Vollendung geführt habe, indem er „in die planlose Fülle der Erlebnisse des alten Buches ein ordnendes Prinzip einzufügen“ vermochte ([1911]: XV). Auch Meyer liest Schnabels Insel Felsenburg stellenweise als historischen Roman, wie schon Adolf Stern, den er explizit erwähnt. Oehlenschläger hat in Meyers Augen die Gattung im Vergleich zu Schnabel weiterentwickelt, da er sich auf Walter ScottScott, Walter, den grossen Lehrmeister auf diesem Gebiet, stützen konnte. Ausserdem hebt Meyer die Fähigkeit Oehlenschlägers hervor, das Kunstgespräch, ein Hauptelement des romantischen Romans, auf natürliche Weise mit den Figuren und der Handlung zu verknüpfen. Was aus Meyers Einleitung implizit hervorzugehen scheint: Das „schlechte Papier“, der „graue Druck“, sind Oehlenschlägers Werk nicht angemessen. Deshalb erscheint dieses jetzt – was Meyer allerdings nicht erwähnt – analog zur schönen Ausgabe der Insel Felsenburg in einer sorgfältig gestalteten, der Erscheinungszeit entsprechend mit Jugendstilelementen verzierten Edition, deren meerblauen Einband goldene Lettern und eine goldfarbene Vignette mit Schiffsmotiv schmücken. Weitere Vignetten zeigen auf den reich ornamentierten Vorsatzblättern neben Titel und Autornamen eine Burg auf felsiger Insel im Meer – eine graphische Umsetzung der Bezeichnung „Insel Felsenburg“ also. Dass dieses Buch aber nicht etwa die vierbändige Erstausgabe von 1826, die Meyer eingangs erwähnte, sondern einen orthographisch modernisierten Neudruck der gekürzten Version von 1839 enthält, darüber wird der Leser nicht informiert.28
Abb. 5: Buchdeckel der Ausgabe von 1911 (Foto privat)
Die Ausgabe von 1911 wurde von Franz Deibel ganz im Sinne von Meyers Einleitung rezensiert; er nennt den „eben den Staubkammern der Weltliteratur entrissene[n] Roman des Dänen Adam O e h l e n s c h l ä g e r“ (gesperrt im Original) ein „verschollenes Werk […], das wohl von einem nordischen Autor stammt, aber von den Quellen deutschen Geistes und deutscher Dichtung gespeist ward“ (Deibel 1911: Sp. 1515–1516). Hier wird also Oehlenschläger weniger als Vermittler zwischen deutscher und dänischer Kultur gesehen, sondern als ein von deutschem Schrifttum abhängiger Dichter.29Andersen, Hans Christian In enger Anlehnung an Meyer, auf den Deibel sich explizit beruft, spricht er von Oehlenschläger als dem „GoetheGoethe, Johann Wolfgang von des Nordens“ (Sp. 1516). (Meyer nannte ihn den „dänischen Goethe“ [1911: XIV).30Goethe, Johann Wolfgang vonAndersen, Hans Christian Auch Deibel befasst sich in aller Ausführlichkeit mit der Insel Felsenburg, und auch er hält, wie Meyer, die Inseln im Südmeer für eine Aktualisierung, teilweise sogar Verbesserung von Schnabels Werk.
Nur am Rande sei erwähnt, dass Arno SchmidtSchmidt, Arno seit 1959 ein Exemplar der Ausgabe von 1911 besass, wie aus der Katalogisierung seiner Bibliothek hervorgeht (Gätjens 1991: 295). Einem Vermerk auf dem Vorsatzblatt zufolge hatte er Oehlenschlägers Roman bereits 1945 im Rahmen seiner kriegsbedingten Stationierung in Oslo erstmals gekauft; das Buch ging jedoch noch im selben Jahr auf der Flucht aus Schlesien verloren und wurde von Schmidt 1959 ersetzt. Anlässlich seiner Beschäftigung mit der Insel Felsenburg kommt Schmidt in mehreren Texten auf „Öyene i sydhavet“ (sic) zu sprechen, u.a. in den Dialog-Essays Herrn Schnabels Spur (1989: 240) und Das Gesetz der Tristaniten (1995: 311); beide Dialoge stellen Schnabels Roman ausführlich dar, wobei Schmidt vor allem in Herrn Schnabels Spur durch z.T. seitenlange Zitatenmontagen eine besonders anschauliche Präsentation anstrebt, die das Leserinteresse auf den Roman lenken und einen Aufruf an die Verleger für eine Neuausgabe untermauern soll (1989: 257–258).31
SchmidtsSchmidt, Arno Einsatz erstreckte sich bedauerlicherweise nicht auf Oehlenschlägers Roman. Dennoch gibt es seit kurzem eine Neuausgabe des ersten Bandes der IS, d.h. der Fassung von 1826. Für die Herstellung wurde ein vor vielen Jahren angefertigtes und im Internet veröffentlichtes Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München unverändert gedruckt, zu einem Taschenbuch (mit nichtssagendem Buchdeckel) gebunden und 2018 vom Verlag „Inktank Publishing“ herausgebracht.32 Im Gegensatz zur redigierten dänischen e-book-Ausgabe, die auf einem gedruckten Buch beruht, bietet die deutsche Taschenbuchausgabe ein genaues Abbild des Digitalisats, was aus buchwissenschaftlicher Perspektive und zu Studienzwecken sicher vorzuziehen ist, leider aber auch die Mängel des Digitalisats (unleserliche Stellen, Flecken, etc.) aufweist. Eine Auskunft darüber, ob der Verlag die weiteren Bände ebenfalls herausgeben werde, war trotz mehrfachen Nachfragens nicht zu erhalten. Es ist natürlich sehr zu begrüssen, dass der Roman neu aufgelegt wird, und zwar in der ungekürzten Fassung von 1826; allerdings bestehen gewisse Zweifel, ob das Buch in dieser nicht sehr ansprechenden Aufmachung die Leser erreichen wird.
Nach der insgesamt eher ablehnenden Rezeption der Erstausgabe von Oehlenschlägers Roman, den dadurch bedingten, kaum erfolgreicheren gekürzten Fassungen und deren gestalterisch verbesserten Neuauflagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeuten die elektronischen Publikationsverfahren der neuesten Zeit immerhin eine Möglichkeit, auch weniger erfolgreiche Werke ohne grossen Aufwand und Verlust für Verlage und Buchhandlungen dem Lesepublikum wieder näherzubringen.