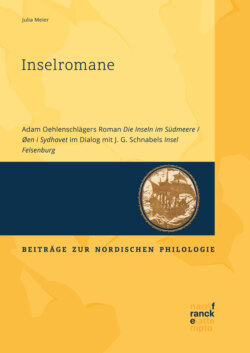Читать книгу Inselromane - Julia Meier - Страница 17
2.1 Die wunderlichen Fata
ОглавлениеJeder der vier Teile von Schnabels WF, entstanden in den Jahren 1731–1743, wird von einer an den Leser gerichteten Vorrede eingeleitet (vgl. dazu Kap. 4.1.2 dieser Arbeit). Über die zentralen Begebenheiten im ersten Teil orientiert schon das zeittypisch ausführliche Titelblatt:
Abb. 6: Titelblatt der Erstausgabe des 1. Teils der Wunderlichen Fata.
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Lm1059. © Verlag Zweitausendeins
Darauf wird als erster Name, hervorgehoben mit grossen roten Antiqua-Lettern, jener von Albert Julius genannt, der sich als einer von vier Schiffbrüchigen auf eine unbewohnte Felseninsel retten konnte und dort zusammen mit der ebenfalls geretteten Concordia eine Familie gründete, die durch mehrere Generationen noch zu Alberts Lebzeiten auf über 300 Mitglieder anwuchs.1Neville, Henry Sein Urgrossneffe Eberhard Julius, dessen Name auf dem TitelblattNeville, Henry ebenfalls in roter Antiqua erscheint, hat die Wunderlichen Fata „entworfen“, während sie von Gisander im Jahr 1731 redigiert und in Druck gegeben wurden. Das Titelblatt bietet also eine Fülle von Informationen und lenkt in seiner variantenreichen Gestaltung (rote und schwarze Fraktur- und Antiqua-Buchstaben in verschiedenen Schriftgrössen und durchkomponierten Absätzen) die Auffassung des Lesers hinsichtlich Gewicht und Bedeutung des Mitgeteilten,2 verrät aber nichts vom erzählerischen Reichtum, den das Buch vor allem in den turbulenten, dramatischen Lebensläufen der Inselbewohner birgt, und lässt auch nichts von der komplexen Struktur des Romans erahnen, dessen kunstvolles Erzählgeflecht auf mehreren Zeitebenen und in verschiedenen Rahmungen spielt und die ursprünglich leere Insel nicht nur mit Menschen, sondern vor allem mit Erzählungen anfüllt, wobei gewissermassen das „Erzählen des Erzählens“ immer wieder thematisiert wird.
Die näheren Umstände der auf dem Titelblatt des ersten Teils angekündigten Rettung nach dem Schiffbruch erfährt der Leser aus Alberts Lebenserinnerungen, die dieser dem engsten Kreis seiner Vertrauten auf der Insel Felsenburg Abend für Abend vorträgt; jedoch ist seine Erzählung eingebettet in die Biographie Eberhards, der seinerseits als Ich-Erzähler das eigene Leben schildert: Dank einem geheimnisvollen Brief seines Urgrossonkels Albert gelangt auch er auf die Insel Felsenburg, zusammen mit anderen, nach ihren beruflichen Funktionen und Fähigkeiten sorgfältig ausgewählten Europäern, unter ihnen ein protestantischer Pfarrer namens Schmeltzer, der alle religiösen Handlungen für die streng lutherische Inselgemeinschaft verrichten soll; ausserdem Litzberg, ein Literat und Mathematiker, ferner Kramer, ein Chirurg, und Lademann, ein Musiker und Tischler, sowie weitere, auf der Insel Felsenburg benötigte Handwerker. Eberhard verkörpert die übergeordnete Erzählstimme, die durch den Gang der Handlung führt. Seine Aufzeichnungen bilden, wie auf dem Titelblatt angegeben, die Grundlage der Wunderlichen Fata und bestehen zur Hauptsache aus den zahlreichen Lebensgeschichten, die auf der Insel Felsenburg, aber auch – wie jene des Kapitäns Wolffgang, der Eberhard zur Insel bringt – schon auf hoher See erzählt werden. Eberhards eigenes Ich tritt dabei zurück und lässt Raum für das Ich des jeweiligen Erzählers, wie z.B. im Fall von Albert Julius, dessen Erzählung sich über gut 300 Seiten des ersten Teils erstreckt und ihrerseits wiederum andere Lebensläufe in sich aufnimmt, wie z.B. jenen des Kapitäns Lemelie, der sich mit Albert zusammen auf die Insel Felsenburg retten konnte; seine kurz vor dem Tod erzählte, verbrecherische Lebensgeschichte ist nun als Ich-Erzählung in Alberts Bericht integriert, wie auch einige Biographien von später auf die Insel gelangten Schiffbrüchigen. Auf diese Weise präsentiert sich der erste Teil der WF weitgehend als dreistufiges Erzählmuster, indem der Ich-Erzähler Eberhard Alberts Ich-Erzählung aufzeichnet, in die wiederum mehrere andere Ich-Erzählungen eingelassen sind. Den Rahmen dieser intensiven polyphonen Erzähltätigkeit bildet die Begehung der Insel: Eberhard und die mit ihm angereisten Europäer werden durch die Besiedlungsräume der Insel geführt und erfahren deren Hauptzüge und Merkmale jeweils in den Erzählpausen. Diese werden dabei zu eigentlichen Ruhepausen zwischen den vorgetragenen Lebensgeschichten, denn der idyllische Charakter der Inselräume kontrastiert aufs schärfste mit den erzählten Biographien, die zumeist von allen Formen der Gewalt, von Hunger, Armut, Elend und überhaupt allen erdenklichen Übeln und Gräueltaten geprägt sind, so dass die Erzählenden sich glücklich schätzen, auf der Insel Felsenburg Asyl3 gefunden zu haben.
Im Anhang zum ersten Teil der WF zeigen genealogische Tabellen die Entwicklung von Alberts Nachkommenschaft, die sich, wie genauestens vorgerechnet wird, im Jahr 1725 auf 346 Personen beläuft, jene Europäer mitgezählt, die mit Kapitän Wolffgang auf die Insel gereist sind.
Ein weiterer Anhang bringt die Lebensbeschreibung des Don Cyrillo de Valaro. Aus dem lateinischen Manuskript, das Eberhard ins Deutsche übersetzt hat, geht hervor, dass auch Cyrillo als Schiffbrüchiger an die Küste der Insel Felsenburg geworfen wurde, und zwar gut 130 Jahre vor Albert. Dieser Verlängerung der Zeitachse entspricht auch eine geographische: Von den Erzählungen aus dem Raum Deutschland – England – Holland (und ein einziges Mal Frankreich, im Fall von Lemelie) verlagert sich der Schauplatz nun nach Spanien, woher Cyrillo stammt. Im Gegensatz zu den meisten andern Erzählenden bewegte er sich nicht in Bürger- oder Handwerkerkreisen, sondern wuchs als Adliger am kastilischen Königshof auf. Seine Biographie umspannt ein grosses Spektrum verschiedenster Lebensformen: Dem Beginn mit Tournieren, Duellen, Kriegszügen und Intrigen in der Adelswelt folgen nach der Teilnahme an den Eroberungs- und Raubzügen der spanischen Konquistadoren schliesslich Schiffbruch und Strandung an der Insel Felsenburg, wo sich Cyrillo zum frommen Einsiedler wandelt, der im Alter von 105 Jahren seine Biographie für zukünftige Ankömmlinge auf der Insel niederschreibt, und zwar, wie Cyrillo dabei mitteilt, in zwei Sprachen: lateinisch und spanisch (WF I: 648).4 Am Schluss des ersten Teils der WF steht folglich ein Manuskript, das den eigentlichen Beginn menschlichen Daseins auf der Insel Felsenburg beschreibt und überdies statt des Erzählens das Schreiben thematisiert.
Abb. 7: Titelblatt der Erstausgabe von Teil 2 der Wunderlichen Fata.
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar 32,3: 59b. © Verlag Zweitausendeins
Der zweite Teil der WF präsentiert sich schon im Titelblatt als Fortsetzung und erwähnt nun auch den Namen „Insel Felsenburg“ – in roten gotischen Buchstaben, was die Hauptperson Albert Julius (in schwarzer Antiqua) optisch etwas zurückdrängt; sonst aber bringt das Titelblatt im Vergleich zu jenem des ersten Teils wesentlich weniger Informationen, wohl, weil der Leser ja schon weiss, worum es sich bei dem neuen Buch handelt, das 1732, also nur ein Jahr nach dem ersten Teil, erschienen und ganz ähnlich wie dieser strukturiert ist: Eberhard führt wiederum als Ich-Erzähler durch die Handlung, welche die Geschehnisse auf der Insel, d.h. in der Erzählgegenwart, mit biographischen Erzählungen kombiniert. Diesmal sind es keine eigentlichen Seefahrer-Geschichten, denn es erzählen die Europäer, die von Kapitän Wolffgang für die Insel rekrutiert und mit Eberhard zusammen auf die Insel Felsenburg gebracht wurden; sie haben zwar eine Seefahrt hinter sich, doch wurde diese von Eberhard schon im ersten Teil geschildert, würde also hier keinen neuen Stoff mehr bieten und verlief zudem ohne Schiffbruch, so dass die Passagiere unbeschadet auf der Insel Felsenburg landen konnten. Nach neun Erzählauftritten schaltet sich der Herausgeber Gisander mit einer Fussnote ein: Eberhard habe die restlichen vier Lebensläufe auch an dieser Stelle eingefügt, jedoch wolle er, Gisander, sie für den unfehlbar bald folgenden dritten Teil sparen, da sonst „dieser andere Theil des Wercks, den Ersten um viele Bogen übertreffen dürffte, […]“ (WF II: 538–539). Stattdessen folgt doch noch eine Seefahrer-Geschichte: Kapitän Horn, der nach der Landung Eberhards und der anderen Europäer auf der Insel Felsenburg das Schiffskommando von Wolffgang übernommen hatte und nach Ostindien weitergesegelt war, kommt auf die Insel zurück und schildert seine durch furchtbare Stürme und anderes Ungemach immer wieder aufs äusserste gefährdete Seereise, die aber schliesslich doch glücklich endete. Nach Horns Bericht übernimmt Eberhard für den Rest des Buches wieder die Erzählerrolle. Inhaltlich tritt nun ein neuer Schauplatz in den Vordergrund: Die Leute, die Kapitän Horn mitgebracht hat, werden auf der Insel Klein-Felsenburg einquartiert, einer kleineren Nachbarinsel, deren Entdeckung Albert schon im ersten Teil kurz erwähnt hatte (WF I: 465), und die Eberhard mit seinen Freunden später genauer erkundete, obwohl Albert dies eigentlich nicht wünschte und von Eberhard dazu überredet werden musste. Horns Passagiere erhalten, bis auf wenige Auserwählte, keinen Zutritt zur Insel Felsenburg: Gewisse Abschottungs- und Ausschlusstendenzen, die schon im ersten Teil sichtbar geworden waren, verstärken sich im zweiten Teil deutlich.
Eberhard schifft sich mit Kapitän Horn nach Europa ein, um seinen Vater und seine Schwester zu suchen und mit ihnen zur Felsenburg zurückzukehren. Unter grossen Mühen und Anstrengungen – die Schwester muss aus einer erzwungenen Verlobung freigekauft werden – gelingt es Eberhard, alle Verhältnisse soweit zu ordnen, dass er mit Vater und Schwester nach Amsterdam reisen kann, wo ihn Kapitän Horn zur Einschiffung nach der Felsenburg erwartet. Vor der Abreise sorgt Eberhard noch dafür, dass sein Manuskript in Druck gegeben wird, und verspricht eine Fortsetzung. Ein Anhang, bestehend aus einigen Briefen, orientiert andeutungsweise über die Reise nach Amsterdam und letzte Vorbereitungen auf die Abreise von Europa.
Abb. 8: Titelblatt und Frontispiz der Erstausgabe des 3. Teils der Wunderlichen Fata.
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Lo 6958. © Verlag Zweitausendeins
Das Titelblatt des dritten Teils, mit den gleichen graphischen und farblichen Elementen gestaltet wie die vorhergehenden Titelblätter, erwähnt Alberts Tod im Alter von 103 Jahren. Diese in kleiner, unauffälliger Schrift gedruckte Mitteilung erhält besondere Aufmerksamkeit durch das beigefügte Frontispiz, welches in der oberen Hälfte das Grabmonument für Albert Julius mit dessen Lebensdaten zeigt, während die untere Hälfte seinen von neun Kerzen umstandenen Sarg abbildet.5 Alberts Sterben, das sich über mehrere Seiten hinzieht, ereignet sich ungefähr in der Mitte des dritten Teils, steht also in dessen Zentrum. Nach Alberts Beerdigung wird die Grabpyramide, die der Leser schon vom Frontispiz her kennt, errichtet und mit mehreren Symbolen und lobpreisenden Inschriften in lateinischer, deutscher und englischer Sprache geschmückt. Wenig später begeben sich Eberhard und seine Freunde auf die Insel Klein-Felsenburg, wo ihnen seltsame Phänomene erscheinen, wie Flammen und Feuerkugeln, begleitet von schrecklichen Stimmen, die Unverständliches sprechen. Sie finden zehn steinerne Urnen mit rätselhaften Zeichen und Figuren, später einen Tempel mit zwölf goldenen Götzenbildern sowie eine grosse Zahl von beschriebenen Tafeln aus Stein, Kupfer und Gold. Alles wird auf die grosse Felseninsel gebracht, wo man nach längeren Diskussionen auf den Rat Pfarrer Schmeltzers beschliesst, die Tafeln zur Entzifferung nach Europa zu senden. Erstmals wird nun auf der Insel Klein-Felsenburg erzählt, was auch sie zu einem Erzählraum macht.
Kapitän Horn reist mit verschiedenen Aufträgen wieder nach Europa, u.a. soll er eine voll ausgerüstete Druckerei samt allen dafür benötigten Fachleuten auf die Insel bringen, auch soll er die Tafeln der Insel Klein-Felsenburg entziffern lassen und Eberhards Manuskript des dritten Teils der WF an Gisander übergeben. Dieser fährt nun anstelle von Eberhard, dessen Manuskript ja abgeschlossen ist, mit der Erzählung fort; er berichtet, dass Kapitän Horn seine Redaktion der beiden bisherigen Bände gelobt und ihn gebeten habe, ihm den dritten Teil vorzulesen, wobei Horn das Manuskript stellenweise verbessert habe. Es folgt – von Gisander aufgezeichnet – der Bericht Horns, wie er versuchte, jemanden zu finden, der die Klein-Felsenburger Tafeln entziffern konnte; dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er sie unentschlüsselt bei einem Gelehrten zurücklassen musste, der versprach, sie an die „vornehmsten Societäten der Künste und Wissenschaften in Europa“ zu senden. Gisanders Schlusswort orientiert den Leser noch über die Einschiffung Horns nach der Felsenburg und über die endgültige Redaktion der „Felsenburgische[n] Geschichtsschreibung“. (WF III: 485–486)
Abb. 9: Titelblatt der Erstausgabe des 4. Teils der Wunderlichen Fata.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 8° Fab.Rom. VI, 2525b.
© Verlag Zweitausendeins
Der vierte Teil der WF, der im Gegensatz zu den Teilen 2 und 3 von Schnabel nicht angekündigt wurde, bringt im Titelblatt, nach der bereits bekannten Fortsetzungsformel, in roten Antiqua-Grossbuchstaben den Namen der persisch-candaharischen Prinzessin Mirzamanda, deren Lebensgeschichte „fast ein Haupt-Stück der Felsenburgischen Geschichte“ ausmache. Dies unterstreicht das dreigeteilte Frontispiz, dessen grösstes und detailreichstes Bild ein schreckliches Ereignis im Leben der Mirzamanda darstellt, nämlich die Ermordung ihrer Mutter, die sie als ganz kleines Kind miterlebte.
Abb. 10: Szene aus dem Frontispiz des 4. Teils der Wunderlichen Fata.
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 8° Fab.Rom. VI, 2525b.
© Verlag Zweitausendeins
Möglicherweise sollte das persische Element im Titel dem Leser signalisieren, dass in diesem Roman von Magie, Zauberei, Geisterbeschwörung und Ähnlichem die Rede sein würde,6 und tatsächlich durchziehen solche Phänomene nicht nur Mirzamandas Lebensgeschichte, sondern breiten sich über grosse Teile des vierten Bandes aus. Als eine Art Gegenkraft zu diesen heidnischen Praktiken mag man die zahlreichen, sich über viele Seiten ausdehnenden frommen Predigten, Kantaten, Gebete etc. des vierten Teils verstehen. Die Zaubereien und Geisterauftritte werden zwar jeweils als real erlebte Ereignisse geschildert, gleichzeitig aber implizit verurteilt, denn sie sind mit dem Fremden, mit Irrglauben und Aberglauben verbunden und gehen von der Insel Klein-Felsenburg aus; dort treibt einer der auf der Insel stationierten Portugiesen schwarze Magie, und dort strandet auch Mirzamanda als Schiffbrüchige – in Begleitung einer Teufelsanbeterin, die später in einer schauerlichen Spukszene vom Satan geholt wird.
Auf Klein-Felsenburg werden ausserdem portugiesische Spione entdeckt, die vermutlich etwas mit der späteren Belagerung und Bombardierung der grossen Insel durch portugiesische Kriegsschiffe zu tun haben. Die Felsenburger schlagen die Angreifer in die Flucht, doch das Bewusstsein der Gefährdung ihres Inselparadieses ist geweckt.
Das Ende des vierten Teils bildet der Brief eines unbekannten Gelehrten an die Felsenburger über die im dritten Band auf Urnendeckeln gefundenen rätselhaften Zeichen. Der Gelehrte deutet sie als Symbole für die Götzenbilder aus dem klein-felsenburgischen Tempel und beschreibt die von den Statuen dargestellten heidnischen Götter ausführlich in ihren Eigenschaften und Funktionen, die in ihrer Gesamtheit das System einer archaischen Naturreligion ergeben. Dieser Anhang, der ohne Kommentar und ohne jede Wertung das vierbändige Romanwerk abschliesst, scheint die engen Klammern der alles beherrschenden evangelisch-lutherischen Orthodoxie etwas zu lockern und den Blick auf eine uralte, gänzlich andere religiöse Auffassung zu erlauben.