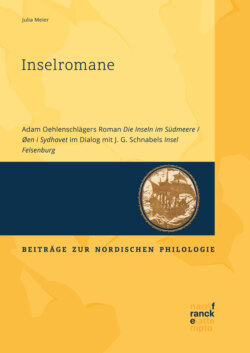Читать книгу Inselromane - Julia Meier - Страница 12
1.3 Entstehungsprozess
ОглавлениеOehlenschlägers Neuschreibung von Schnabels Wunderlichen Fata einiger Seefahrer fällt in eine Zeit, in der Schnabels Roman auch in den Kreisen gebildeter Leser wieder auf Interesse stiess, nachdem er – trotz ursprünglich grosser Beliebtheit1 – gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Misskredit geraten war, da er den Anforderungen einer von Lehrsätzen der Aufklärung geprägten Pädagogik nicht entsprach.2 Die Aufwertung der Insel Felsenburg3 hatte schon im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begonnen4 und lässt sich wohl – mindestens teilweise – mit der Vorliebe der Romantik5 für historische Romane, Volksbücher, Gespenstergeschichten und Märchen erklären – Gattungen, zu denen Schnabels Roman Bezüge aufweist.
Natürlich handelt es sich bei der Insel Felsenburg nicht um einen historischen Roman im eigentlichen Sinn, schon deshalb nicht, weil der Hauptstrang des Geschehens in der Erzählgegenwart spielt, aber durch präzise zeitliche und räumliche Verankerung der erzählten Geschehnisse, die sich überdies zum Teil lange vor der Erzählgegenwart zugetragen haben, entsteht der Anschein der Historizität des Romangeschehens. Der volksbuchähnliche Charakter ergibt sich teils aus der Verbindung von Elementen des Abenteuer- und Schelmenromans mit der Robinsonadenthematik6 und der damit zusammenhängenden grossen Verbreitung des Buches,7 teils aus der Tatsache, dass die Identität des Verfassers lange Zeit im Dunkeln geblieben war.8Tieck, Ludwig Märchenhafte Züge schliesslich bestimmen immer wieder das Romangeschehen, wobei die Steigerung des Märchenhaften ins Phantastische und Gespenstische, die sich vor allem im 3. und 4. Band abspielt, auf die Romantiker eine besondere Anziehungskraft ausgeübt haben dürfte. Die Literatur früherer Zeiten bedeutete den Romantikern aber weit mehr als nur interessante Lektüre: In unterschiedlichster Weise dienten ihnen Volksbücher, Märchen, Sagen, Mythen ebenso wie geschichtliche Überlieferung als Inspirationsquelle und Stoffreservoir für ihre eigene Textproduktion. In besonderem Masse gilt dies für Achim von Arnim,Arnim, Achim von der seine Texte oft aus einer Vielzahl alter Quellen gewann, die er einem intensiven Gestaltungs- und Umgruppierungsprozess unterzog und anschliessend in einem collageähnlichen Verfahren zu einem neuen literarischen Produkt zusammenfügte. Ähnlich ging er auch bei der Bearbeitung der Insel Felsenburg vor, die er in seinen 1809 unter dem Titel Der Wintergarten erschienenen Novellenkranz integrierte (Arnim 1990, 3).9Arnim, Achim von Auf seinen Text, der durch „Quellenkombination“ (Martin 1996) polyphone Aspekte erhält und bei aller Verschiedenheit auch sonst gewisse Parallelen zu Oehlenschlägers Bearbeitung zeigt, soll in Kapitel 4.3 näher eingegangen werden.
Auch Oehlenschläger selber trug sich schon in jenen Jahren mit dem Gedanken, die Insel Felsenburg als Stoff für ein eigenes Werk zu verwenden, wie ein Zitat aus einem Brief an Goethe vom 4.9.1808 belegt: „Einen Albert Julius oder Felsenburg möchte ich auch machen, wo das Romantische wieder sein Recht behaupten sollte“ (Breve A/3: 161). Die Bemerkung steht mitten in einer Aufzählung von Dramen, die Oehlenschläger bereits geschrieben hatte: Aladdin, Hakon Jarl, Palnatoke, Axel und Walborg, und solchen, die er noch zu schreiben beabsichtigte: Correggio, Sokrates, Tordenschild (Breve A/3: 160–161),10Goethe, Johann Wolfgang von was darauf hinzuweisen scheint, dass er damals im Sinn hatte, Schnabels Roman zu einem Theaterstück umzuformen. Im Anschluss an eine längere panegyrische Passage über GoethesGoethe, Johann Wolfgang von Romane fügt Oehlenschläger jedoch an:
Ich hätte auch Lust (sans comparraison) (sic) einen Roman zu schreiben; ich darf es aber nicht; man kriegt immer Lust sein eignes Leben zu schreiben; wenigstens geht es mir so, und da muss man sich hundertmahl in Acht nehmen, und darf es nicht ein mahl (sic) so gut machen wie es wirklich in der That war. (Breve A/3: 162; gesperrt im Original)
Jahre später überwand er sein Zögern, einen Roman zu schreiben, und wählte als Stoff für sein Vorhaben die Insel Felsenburg, die er – entgegen seinen (vermuteten) ursprünglichen Plänen – schliesslich doch nicht für ein Drama benützt hatte.11 Seine Stoffwahl verbindet ihn mit mehreren anderen Autoren, die fast zur gleichen Zeit ebenfalls an einer Neuschreibung von Schnabels Roman arbeiteten.
Zu erwähnen sind insbesondere Karl Lappes Ausgabe von 1823, eine zusammenfassende und erheblich verkürzende Nacherzählung, die vor allem für die Jugend bestimmt war,12 und die weit berühmtere, sogenannte „TieckTieck, Ludwig’sche Ausgabe“, die 1828 unter dem Titel Die Insel Felsenburg oder Wunderliche Fata einiger Seefahrer – Eine Geschichte aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts erschien. Von Tieck stammt in dieser stark überarbeiteten, sechsbändigen Ausgabe allerdings nur das Vorwort, eine dialogisierte „Vorrede“13Tieck, LudwigCervantes, Miguel de, die in detaillierter Argumentation die Neuausgabe „diese[r] alte[n] Robinsonade“ (Tieck 1848: 135) rechtfertigt und am Ende feststellt: „Ein berühmter dänischer Dichter, Oehlenschläger, hat mit dem deutschen Bearbeiter zugleich dieses Buch angekündigt“ (Tieck 1848: 169). Oehlenschlägers Roman wird dabei nicht etwa als lästiges Konkurrenzprodukt angesehen, sondern gilt, ganz im Gegenteil, als „Zeichen, wie sehr man etwas Besseres und Veraltetes in unserer neuen Zeit wieder benötigt“ (Tieck 1848: 170).
Das wesentliche Argument für die Neuausgabe, das sich aus TiecksTieck, Ludwig Vorrede herauskristallisiert, bildet die Einschätzung der Zeitumstände: Die „neue Zeit“, so wird gesagt – gemeint sind die Restaurationsjahre nach der Französischen Revolution –, sei trotz restaurativer Bemühungen von Auflösungstendenzen in Familie und Staat geprägt, sie sei „verwirrt und verstimmt“, während die Insel Felsenburg aus einer „naiven Zeit“ herrühre, in der die Schriftsteller
noch ohne Kunst und Bildung, ohne eigentliches Studium, aber auch ohne alle Kränklichkeit und süsse Verweichlichung wie ohne falsches Bewusstsein und literarischen Hochmut nur ihrer Phantasie […] so bescheiden und redlich folgten und eben deshalb so vieles in einem richtigen Verhältnis, ja mit einem grossartigen Verstand, darstellen konnten, was bei anscheinend grösseren Mitteln so vielen ihrer Nachfolger, die so oft das Verzerrte als das Geniale nahmen, nicht gelingen wollte. (TieckTieck, Ludwig 1848: 168)
Deshalb eigne sich die Insel Felsenburg, obwohl ihr Name lange Zeit „etwas ganz Verächtliches“ bezeichnete, als „treuherzige Chronik“ zur Ergötzung, Belehrung und Erbauung einer Zeit, die ihre Naivität verloren habe (TieckTieck, Ludwig 1848: 168–169).
Im Gegensatz zu TiecksTieck, Ludwig auf allgemeiner Zeitkritik basierender Begründung für die Neuausgabe der Insel Felsenburg gibt Oehlenschläger in seiner Vorrede zu Die Inseln im Südmeere für seine Bearbeitung rein individuelle Gründe an:
Wenn es wahr ist, dass unsere Kindheit, mit ihren Gefühlen und Vorstellungen, das Thema aller künftigen Compositionen des Lebens gibt,14Herder, Johann GottfriedMoritz, Karl Philipp so ist der Grund auch angegeben, warum der Verfasser dieses Werkes einige Hauptzüge des alten Romans Felsenburg zum Stoffe gegenwärtiger Dichtung nahm. Dieses alte Buch hatte grossen Eindruck auf meine jugendliche Phantasie gemacht. (IS I: III; gesperrt im Original)15Goethe, Johann Wolfgang vonMoritz, Karl PhilippLaxness, Halldór
Damit greift er – ohne gleich „sein eignes Leben zu schreiben“16Goethe, Johann Wolfgang von – doch auf autobiographische Elemente zurück. Obwohl sich eine gewisse Parallele zwischen TiecksTieck, Ludwig Empfehlung eines Romans aus „naiver“, unverdorbener Zeit und Oehlenschlägers Beschäftigung mit einem Text aus seiner Kindheit, seiner persönlichen „naiven“ Zeit also, erkennen lässt, ist doch die jeweilige Ausgangslage der beiden Verfasser grundlegend verschieden: Tieck schrieb seine Vorrede auf die Bitte des Verlegers zu einer von unbekannter Hand redigierten Neuausgabe, hatte also mit der Bearbeitung selbst, wie schon erwähnt, gar nichts zu tun,17Tieck, Ludwig während Oehlenschläger den Text selber umgeschrieben, oder vielmehr, wie er sich ausdrückt, neu erfunden hat – sein Roman könne nur bedingt eine „Bearbeitung des alten“ heissen (IS I: IV), denn: „In keinem Werke habe ich mehr selbst erfunden […]“ (IS I: IX; beide Zitate gesperrt im Original). Dies erklärt auch, warum er in seiner Vorrede den Inhalt des alten Romans nur kurz streift – wie schon in der Einleitung (Kap. 1.1 dieser Arbeit) angedeutet, betrachtet er den neuen Text als seine eigene Dichtung, was sich übrigens auch in der Wahl eines eigenen Titels ausdrückt. Näheres zur Titelwahl und zu Oehlenschlägers Vorrede werde ich in Kapitel 4.1 ausführen.