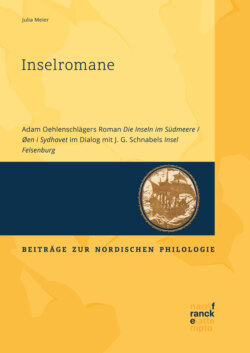Читать книгу Inselromane - Julia Meier - Страница 18
2.2 Die Inseln im Südmeere
ОглавлениеDie folgenden Angaben zu Inhalt und Aufbau von Oehlenschlägers Roman beziehen sich auf die deutsche Ausgabe von 1826, die in dieser Arbeit im Sinne einer Fokussierung auf die prozessuale Entwicklung des Werks generell als Ausgangstext und Basis für die weiteren Fassungen gewählt wurde. Diese Wahl steht im Widerspruch zu früheren Vorgehensweisen, denn bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts pflegten die Literaturwissenschaftler ihren Analysen die „Ausgabe letzter Hand“ eines Textes zugrundezulegen, die als endgültig abgeschlossene Werkfassung, sozusagen als Repräsentation des „letzten Willens“ eines Autors in Bezug auf sein Werk betrachtet wurde, eine Auffassung, die sich mit den neuen Ansätzen, wie sie z.B. von der New Philology, der Diskursanalyse oder den Intertextualitätskonzepten entwickelt wurden, grundlegend änderte: Die Sicht des Autors als „Herr über seinen Text“ wurde ersetzt durch die Idee einer Autorinstanz, die als Instrument der Textgenerierung fungiert und also keinen Willen, keine Intention besitzt, nach der geforscht werden kann; die gängige Vorstellung vom Werk als geschlossene, alle Vorstufen hierarchisch dominierende „Ausgabe letzter Hand“ wurde geöffnet auf einen Textbegriff hin, der die Dynamik, die Polyvalenz, die Instabilität und Unabgeschlossenheit eines textuellen Produktes in den Blick nimmt.1 Dieser Paradigmenwechsel legt nahe, jeweils den Erstdruck als Textgrundlage zu wählen, da er als Ausgangspunkt für alle späteren Fassungen/Varianten das Prozessuale der Textgenese einleitet und damit deren dynamischen Charakter wahrnehmbar macht. Freilich stellt sich hier die Frage, warum dann nicht auf das Manuskript – soweit noch vorhanden und auffindbar – als allererste, medial fassbare Stufe des Entstehungsprozesses zurückgegriffen wird. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Wahl des Erstdruckes als Grundlage für die durchgeführten Analysen vor allem im Hinblick auf die Möglichkeit der Rezeption, die in den meisten Fällen erst auf die Druckfassung reagieren kann, d.h. es ist die gedruckte Ausgabe, die eine öffentliche und damit erst literaturwissenschaftlich einzuschätzende Wirkung hervorzubringen vermag.2
Nimmt man Oehlenschlägers Roman in der Ausgabe von 1826 zur Hand, so fallen zwei Neuerungen gegenüber Schnabel sofort ins Auge: Als erstes der kurze Titel (vgl. dazu Kap. 4.1.1), dann aber auch die Einteilung des Textes in Kapitel, eine leserfreundliche Massnahme, die Übersichtlichkeit schafft. Jeder Teil enthält zwischen zwanzig und dreissig, mit kurzen Überschriften versehene Kapitel von variabler Länge.3Cervantes, Miguel de
Teil 1 beginnt, wie bei Schnabel, mit dem Auftritt von Eberhard Julius. Bei Oehlenschläger wird Eberhard jedoch in die dritte Person versetzt; ein auktorialer Erzähler führt durch den Text. Dieser Wechsel der Erzählinstanz resultiert in einer wesentlich stärkeren Konturierung der Figur Eberhards; er wird zu einer facettenreichen Person aufgewertet und erhält ein detailliert geschildertes, mit einer grossen Anzahl neuer Episoden und neuer Figuren angereichertes Schicksal, das den ganzen ersten Teil füllt. Auch seine Eltern werden eingehender charakterisiert; über die Mutter heisst es:
[S]ie war […] aus dem Geschlechte LuthersLuther, Martin, mit seinen Liedern und Gesangsweisen auferzogen, die persönlichen Verhältnisse Luthers, Melanchtons (sic), Bugenhagens u.s.w. kannte sie alle sehr genau und wusste sie in lebhaften Zügen vorzutragen. Eine für ihre Zeit so gebildete Frau hatte auf den Sohn grossen Einfluss gehabt. (IS I: 3)
Schon auf der dritten Seite wird also die Abstammung von LutherLuther, Martin erwähnt, eine Verwandtschaftsbeziehung, die für Eberhard und besonders für seinen Urgrossonkel Albert Julius von entscheidender Bedeutung ist, wie im Verlauf des Romans noch deutlich wird. Der Student Eberhard wird gleich zu Beginn vom Tod der Mutter und dem Bankrott des Vaters getroffen. Trotz der Unterstützung durch Hanna Hellkraft, eine aus der Schweiz stammende mütterliche Freundin, die – offenbar aufgrund ihrer schweizerischen Herkunft – ihrem sprechenden Namen zufolge als Inbegriff bodenständiger Vernunft und Tüchtigkeit erscheint, fällt es ihm schwer, sich in seiner neuen Lage zurechtzufinden. In dieser Situation trifft, wie bei Schnabel, ein Brief ein, mit dem ihn ein gewisser Kapitän Wolfgang4 nach Amsterdam einlädt. Eberhard entschliesst sich zur Reise, auf der ihn Hanna Hellkraft begleitet. Unterwegs besichtigt er den Kölner Dom und lernt dabei zwei Personen kennen, die schon in den WF eine grössere Rolle spielten: Litzberg und Lademann. Eberhard trifft sie bei der Ausübung künstlerischer Tätigkeiten: Litzberg zeichnet das Domportal und Lademann spielt Bach’Bach, Johann Sebastiansche Orgelmusik. Ein „Künstler“ ganz anderer Art ist Obadias Schlenk, der Eberhard aus einer misslichen Lage in der Krypta des Doms befreit und ihn gleichzeitig bestiehlt, dank Eberhards Grossmut aber einer Verhaftung entgeht. Da auch Litzberg und Lademann nach Amsterdam unterwegs sind, schliesst man sich zu einer kleinen Reisegesellschaft zusammen und führt auf der Rheinfahrt nach Holland mit den übrigen Passagieren, zu denen später auch LeibnizLeibniz, Gottfried Wilhelm stösst, lebhafte Streitgespräche.
An dieser Stelle löst sich der auktoriale Erzähler von seinen Figuren: „Wir lassen jetzt unsere Reisende segeln oder fahren, wie es ihnen gefällt“ (IS I: 121), und wendet sich explizit an den Leser, indem er über die Möglichkeiten der Dichtung reflektiert, Landschaft in Worten wiederzugeben. In einer ironischen Wendung bemitleidet er den Leser, der in Romanen immer wieder dieselben Landschaftsbeschreibungen lesen müsse, und spottet über die romantischen Topoi der Naturschilderung: „wie grün die Wälder, wie majestätisch die Berge, wie rauschend die Wasserfälle […]. Wie die Lerchen des Morgens im Felde sangen, und die Nachtigallen am Abend im Haine flöteten“ (IS I: 122). Er hält nichts von „Wortgemälden“ (IS I: 123), da dem Dichter ausser der schwarzen keine Farben zur Verfügung stünden, und damit liessen sich nur Begebenheiten erzählen oder „den inwendigen Menschen“ malen. Dann führt er den Leser durch die holländische Landschaft, beschreibt ihm eine ganze Reihe von Szenen holländischen Lebens, die er sich ansehen könnte, doch rät er ihm von solchen Besichtigungen ab, denn all das sehe der Leser weit besser auf den Bildern der „grossen Meister der niederländischen Schule“ (IS I: 127).5 Da sich die holländischen Szenen wie Beschreibungen von Genrebildern der flämischen und niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts lesen,6 scheint hier ein Medienwechsel stattzufinden, der mit dem Phänomen der romantischen Ironie spielt, indem gemalte Szenen wiederum mit Worten gemalt werden, wodurch die Kritik gegen die „Wortgemälde“ ironisch subvertiert wird. Der Vorgang lässt sich aber auch als Hinweis auf ein Wechselspiel, eine gegenseitige „Befruchtung“ von Malerei und Dichtung verstehen.
Bezeichnenderweise ist es ein prosaischer Einwurf Hanna Hellkrafts, der den Kunstdiskurs des Erzählers beendet, so dass der Leser von der Höhe der kunsttheoretischen Reflexionsebene abrupt auf die „flache seichte Ebene“ stürzt, wie Hanna Hellkraft die holländische Landschaft bezeichnet, welche sie als „Schweizerin, auf dem Rigi geboren“ (IS I: 128), geradezu verabscheut; ihr Urteil führt bei den Gefährten zu einem Gespräch über die Lebens- und Wesensart der Holländer, wobei die Anhäufung teilweise kruder Holländerklischees wie eine Antithese zu den erwähnten romantischen Topoi wirkt.
Auf der Weiterreise werden Eberhard und seine Freunde Zeugen der Hinrichtung ihres Bekannten Obadias Schlenk, der wegen Diebstahls gehängt wird. Wie in einer biblischen Traumvision sieht Eberhard in der folgenden Nacht Obadias auf dem Regenbogen, den der Dieb einst als unnütze „Schnurrpfeiferei der Natur“ bezeichnet hatte (IS I: 88–99), gegen den Himmel klettern. Des Regenbogens bedienen sich in dieser Vision auch die nordischen und germanischen Götter, genannt werden Thor und Heimdall (IS I: 200–201). Der Regenbogen verbindet hier also nicht nur Himmel und Erde, sondern auch heidnische und christliche Mythologie. Mit der Integration der ursprünglichen Religion seines Landes in den biblischen Kontext führt der dänische Autor in gewisser Weise LeibnizLeibniz, Gottfried Wilhelm’Leibniz, Gottfried Wilhelm Vorstellung des alles in sich aufnehmenden Weltganzen fort. Synkretistische Tendenzen verschiedener Art lassen sich im Roman immer wieder feststellen, wie noch zu zeigen sein wird.
Obadias’ Leiche soll als anatomisches Anschauungsmaterial seziert werden, was Eberhard jedoch verhindert, indem er sie den Medizinern abkauft, obwohl er weiss, dass der Tote der Wissenschaft und damit den Lebenden gedient hätte. „Ich bin aber nun einmal so“, gibt er als Begründung an (IS I: 211). Eberhards pietätvolle Tat kontrastiert eine Episode aus Kramers Lebensgeschichte im 2. Teil der WF, in der ein armer Medizinstudent aus Not den Leichnam seiner eigenen Mutter an die Anatomie verkauft (WF II: 225–227).
Die Vorgänge um Obadias’ Tod beeindrucken Lademann so tief, dass er an einem heftigen Fieber erkrankt und ins Delirium gerät. Die Mittel des Arztes bessern seinen Zustand kaum. Was ärztliche Kunst nicht vermag, gelingt jedoch seiner eigenen: Er komponiert eine Seelenmesse für Obadias, spielt sie auf der Orgel der nahen Kirche und ist geheilt.
Während Eberhard den Freunden seine Reflexionen zur erdgebundenen Baukunst, der körperlosen, immer entschwindenden Musik und der Dichtkunst als Bindeglied zwischen beiden vorträgt, gelangen sie nach Saardam, wo sie Peter dem Grossen begegnen, der dort als Schiffszimmermann arbeitet; mit ihm werden die Kunstgespräche fortgeführt, teilweise auch in der Form von Umsetzungen zu konkreten Bühnenwerken. Sie reisen weiter nach Amsterdam, der vermeintlich letzten Station ihrer gemeinsamen Reise. Eberhard trifft dort, wie vereinbart, Kapitän Wolfgang, und erhält von ihm einen Brief, in dem Albert Julius seinen jungen Verwandten in Gedichtform zu sich, dem „hundertjähr’ge[n] Greis/Am hohen Felsenstrande“ einlädt (IS I: 334). Das erste Zeichen Alberts im Roman ist also wie bei Schnabel ein Brief an den Urgrossneffen, doch verleiht die Versform dem Schriftstück ein künstlerisches Gepräge und erhebt so Alberts ersten „Auftritt“ auf die Ebene der Kunst.
Die nun folgende Schiffsreise, zu der sich auch Litzberg und Lademann sowie der ebenfalls aus den WF bekannte Pfarrer Schmelzer einfinden, beschreibt Eberhard in seinem Tagebuch; sein „Ich“ tritt damit an die Stelle des auktorialen Erzählers. Das Tagebuch enthält eine Vielfalt von Gattungen: eine Hymne ans Meer, verfasst in freien Rhythmen, allgemeine Betrachtungen über die Seefahrt sowie die Erzählung diverser Episoden der gegenwärtigen Schifffahrt, zu denen auch die Schilderung eines Sturmes auf hoher See gehört, der die Passagiere zu Tode ängstigt; nur Lademann zeigt keinerlei Furcht, im Gegenteil: er nimmt den Sturm als „Concert sonder Gleichen“ wahr (IS I: 368), hört ihn als grosses musikalisches Kunstwerk und bedauert nur, dass er die ganze Komposition kaum werde zu Papier bringen können. Für ihn überwindet die Kunst den Tod oder zumindest die Todesangst, ähnlich, wie sie sein Delirium nach Obadias’ Hinrichtung heilte.
Eine längere Episode spielt auf Teneriffa, wo die Schiffsreisenden nach dem Sturm Halt machen. Auch in den WF landet die Reisegesellschaft nach überstandenem Sturm auf Teneriffa, und wie bei Schnabel will Eberhard den Pic nicht besteigen. Während in den IS Lademann und Litzberg den Pic erklettern, spaziert Eberhard zusammen mit seinem Hund Suchverloren durch die Wälder der Insel; dabei entdeckt der Hund eine Höhle, in die auch Eberhard eintritt und auf eine grosse Zahl mumifizierter Guanchen stösst. Ganz ähnlich wie in der Episode im Kölner Dom, die der Text explizit in Erinnerung ruft (IS I: 379), läuft Eberhard wieder Gefahr, lebendig begraben zu werden, diesmal in der Gesellschaft von Toten, denn er findet den Weg aus der Höhle nicht mehr. Der Pudel Suchverloren, der seinen Namen nicht umsonst trägt, weist ihm schliesslich den Ausweg und rettet ihm so das Leben.
Bis zur Rückkehr seiner Freunde liest Eberhard in alten Reisebeschreibungen Berichte über die Besteigung des Pic. Als die Gefährten erschöpft zurückkehren, gibt Eberhard in einer detaillierten Erzählung seine Lektüre als eigene Gipfelbesteigung aus. Lademann, der Eberhards Schilderung für bare Münze nimmt, kann nicht verstehen, wie jener alles so genau im Gedächtnis behalten konnte, während er, Lademann, der tatsächlich auf dem Pic war, das meiste schon wieder vergessen habe. Die Lektüre vermag also das Erlebnis zu ersetzen; dessen Wirkung ist in der literarischen Gestaltung tiefer als das reale Erleben.
Ganz zum Schluss, als letztes Kapitel des ersten Teils, wird mit Kapitän Wolfgangs Erzählung seiner Lebensgeschichte erstmals ein zentrales Strukturelement der WF aufgegriffen, die Wiedergabe einer Vielzahl autobiographischer Erzählungen. Bevor Wolfgang beginnt, erörtert er eingehend seine Erzählstrategie und entwirft damit eine auf die Rezipienten zielende Poetik des Erzählens: Es gehe ihm darum, seine Zuhörer zu unterhalten, und er wolle sich „so viel möglich vor dem Langweiligen hüten;“ (IS I: 391). Er stammt aus einer einfachen Handwerkerfamilie und verliert früh seinen Vater, der Leinenweber war. Bemerkenswert ist, dass Wolfgang sich nicht an seinen Vater und dessen Handwerk erinnert, sondern an das Lied, das der Vater über sein Handwerk zu singen pflegte, ja, die Erinnerung an den Vater ist einzig in diesem Lied aufgehoben (IS I: 393–394), und obwohl es sich dabei um ein recht derbes Spottliedchen7 handelt, wird doch auch hier Leben zu Kunst transformiert und damit vor dem Vergessen bewahrt. Wolfgang erlebt als Kind den Einfall der Türken in Wien, den unter anderem auch ein „tapferer dänischer Capitain“ (!) vergeblich aufzuhalten versucht (IS I: 398). Wolfgang muss fliehen, er wird von dem berühmten Bruder Herz gerettet und erhält vom polnischen König, der Wien befreit, eine goldene Kette, die ihm und seiner Mutter aus aller materiellen Not hilft. Nach dem Tod der Mutter geht er als Student nach Tübingen, gerät dort in schlechte Gesellschaft, verspielt die goldene Kette und tötet einen Falschspieler, der ihn betrogen und dann zum Duell gefordert hat. Wolfgang muss wieder fliehen. Mitten in der Erzählung bricht er ab, da er nicht erleben wolle, wie seine Freunde aus Höflichkeit ihre Schläfrigkeit unterdrücken müssten. Diese Zäsur schliesst zugleich den ersten Teil des Romans.
Nach dieser Unterbrechung, die wie ein „Cliffhanger“ wirkt, wird der zweite Teil mit der Fortsetzung von Wolfgangs Biographie eröffnet. Der Protagonist fährt nun zur See, bringt es vom Matrosen bis zum Kapitän und wird Opfer einer Meuterei auf seinem eigenen Schiff; die Mannschaft setzt ihn mitten im Ozean auf einem kleinen Boot aus. Er strandet an einem ungeheuren Felsen und ist gerettet. An diesem Punkt seiner Erzählung hat auch die gegenwärtige Reisegesellschaft die Insel Felsenburg erreicht, weshalb Wolfgang endgültig abbricht, um so dem aktuellen Geschehen gewissermassen das Wort zu überlassen. Explizit meldet sich nun der auktoriale Erzähler, der die Landung nicht beschreiben mag, da er, wie bereits im ersten Teil der IS ausführlich dargelegt, keine „Wortgemälde“ verfassen will (IS I: 123–124). Stattdessen bringt er ein Fragment aus Eberhards Tagebuch, das die Landung auf der Felsenburg und die erste Begegnung mit Albert Julius in Hexametern besingt. Auf Eberhards poetische Schilderung folgt im Stil einer nüchternen Chronik ein Bericht über das Leben auf der Insel Felsenburg, über die verschiedenen Ämter, welche die Neuankömmlinge übernehmen, und über den geplanten Kirchenbau. Dann beginnt Albert Julius mit der Erzählung seiner Lebensgeschichte; diese füllt, abgesehen von den ersten beiden Kapiteln, den zweiten und dritten Teil der IS, sowie über ein Drittel des vierten Teils. Sie nimmt also noch weitaus mehr Raum ein als in den WF; allerdings umfasst sie einige weitere Biographien, so z.B. jene von Lemelie, aber auch Cyrillos ausgedehnte Lebensgeschichte, die, anders als bei Schnabel, nicht im Anhang steht, sondern in den Erzählzusammenhang integriert ist. Wie aus der Erzählsituation implizit hervorgeht, ist der Kreis der Zuhörer grösser als in den WF, und das Lesepublikum (samt dem auktorialen Erzähler) wird in die Zuhörerschaft einbezogen (IS II: 49).
Zu Beginn seiner Erzählung macht Albert den Zuhörern bewusst, was für ein Abstand ihn, den fast hundertjährigen Greis, von den Ereignissen seiner Kindheit und Jugendzeit trennt, indem er darauf hinweist, dass er „wohl jetzt nur die Erinnerung der Erinnerungen“ erzähle (IS II: 50).8Moritz, Karl Philipp Er beginnt nicht mit der eigenen Geburt, sondern mit dem gewaltsamen Tod seines calvinistischen Vaters, der im Dreissigjährigen Krieg von den Katholiken an seinem Geburtstag Frau und Kindern entrissen, ins Gefängnis geworfen und hingerichtet wird. Im Unterschied zu Schnabel werden die Umstände dieses Todes, besonders die Trauer der kleinen Familie, mit deutlichen Zügen der religiösen Empfindsamkeit in aller Breite ausgemalt.9Arnim, Achim von Nach dem Tod ihres Mannes zieht die mittellos gewordene Witwe mit Albert und dessen älterem Bruder Rudolf nach Eisenach zu ihrer Schwester Ursula; diese ist als komische Figur gezeichnet, die fast nur in Bibelzitaten spricht und beim Kochen und Essen immer einschläft, so dass Albert sich nach der Trauer um den Vater in einer possenhaften Szenerie wieder findet. Mit Rudolf besucht er oft die Wartburg, besonders die Stube, in der LutherLuther, Martin das Neue Testament übersetzte; Albert glaubt, „einige Anlage zur Dichtkunst“ in sich zu entdecken, wie Eberhard, an den er sich nun in der Inselgegenwart wendet: „Ich höre, du, mein Eberhard, seyst auch ein Dichter. Das haben wir beide von unserem Luther, dem Verfasser der herrlichen Kirchenlieder, geerbt“ (IS II: 89–90). Zwischen Albert und seinem Bruder entspinnt sich ein längeres Gespräch über den Sängerwettstreit auf der Wartburg, über die Minnesänger und ihre Lieder, die Rudolf als formelhaft und monoton verspottet; er findet, es sei „eine französische Mode, den Frauen gar zu viele geschnörkelte Artigkeiten zu sagen“ (IS II: 98) – ein Seitenhieb auf französisches à la mode-Wesen –, während Albert an den Minneliedern auch Schönes entdecken kann, aber die Volkslieder bei weitem mehr schätzt (IS II: 106), – eine Vorliebe, die sein Urgrossneffe Eberhard teilt (IS I: 140–141).
Bei der Hochzeit seiner Tante Ursula, einem mit allen Ingredienzen des Schwanks ausgestatteten Ereignis, trifft Albert auf einen alten Meistersinger, von dem er sich Erkenntnisse über das Wesen der Dichtkunst erhofft. Doch als dieser ihm erklärt, Dichtkunst sei nichts anderes als „gute Gedanken in guten Reimen vorzutragen“ (IS II: 132), und ihm die normativen Grundbegriffe des Meistergesangs beibringen will, flieht Albert entsetzt vor diesem „langweiligen Wortkrame“ (IS II: 135).
Nachdem Mutter und Tante gestorben sind und der Bruder Rudolf sich vom protestantischen Herzog für den Kriegsdienst hat anwerben lassen, verlässt Albert Eisenach und gesellt sich zu Seifert und seinen Freunden, einer Gruppe herumziehender Jenaer Studenten (IS II: 157–158). Seifert wird in einem ausführlichen Porträt dargestellt, das gleich zu Beginn auf seine Beziehung zur Dichtkunst eingeht: „Obschon er selten Gedichte las, und eigentlich die Poesie wenig liebte […], war doch sein ganzes Wesen sehr poetisch“ (IS II: 193). In diesem poetischen Geist gründet er mit seinen Kameraden eine wandernde Schauspieltruppe. Nachdem sie dieses Leben eine Zeitlang ausgekostet haben, tritt Seifert mit seinen Getreuen in Gustav Adolfs Dienste, während Albert sich von einem Dorfpfarrer als Vertreter des Küsters anstellen lässt.
Im dritten Band lernt Albert dank Seiferts Vermittlung Gustav Adolf persönlich kennen; der König ist von einem Gedicht Alberts angetan und ermöglicht ihm ein Studium in Wittenberg, als Gefährte seines Sohnes. Bald darauf fällt Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen, sein Sohn kehrt nach Stockholm zurück, und auch Albert möchte nach Norden reisen. Er schifft sich nach Kalmar ein, wird jedoch von einem Sturm zu einem Zwischenhalt auf der Insel Öland gezwungen, wo er durch Krankheit längere Zeit festgehalten wird. Ein zweiter Sturm lässt das Schiff der Holsteinisch-Gottorpschen Gesandtschaft, die im Auftrag des Herzogs von Schleswig-Holstein nach Russland und Persien unterwegs ist, an der Insel scheitern. Zur Gesandtschaft, die in dem Wirtshaus unterkommt, wo auch Albert wohnt, gehört neben ihrem Sekretär Adam OleariusOlearius, Adam auch der Dichter und Arzt Paul Fleming,Fleming, Paul der Albert kuriert und mit ihm Gespräche über Arzt- und Dichtkunst führt (vgl. Kap. 7.1.2). Nach dem Hochzeitsfest eines armen Mädchens, dem Albert und Fleming zu einer Mitgift und zur gewünschten Heirat verholfen haben, reist die Gesandtschaft weiter. Albert dagegen tritt in die Dienste van Leuvens, eines holländischen Adligen, der in den IS in Kalmar stationiert ist und sich nach Ostindien einschiffen will. Sie reisen zunächst nach Kopenhagen, wo sie den Ankerschmied Mats Hansen kennenlernen, der am Hof Christians IV. in einem Trinkduell auftritt (vgl. Kap. 8.2) und den Anker für van Leuvens Schiff schmiedet. Albert soll sich aus Gründen, die er erst später erfährt, als Frau verkleiden, was zur Begegnung mit Carl van Mandern, einem holländischen Porträt-Maler führt, der gerade daran ist, Christian IV. zu malen, und der für Albert eine holländische Frauentracht besorgt hat. In seinem Atelier hängen Genre-Bilder von flämischen Meistern, an deren Betrachtung sich ein ausgedehntes Gespräch über Malerei knüpft, das teilweise an die Reflexionen über die holländischen Gemälde erinnert, die der auktoriale Erzähler dem Leser während Eberhards Reise durch Holland anstelle des realen Naturerlebnisses empfiehlt. Van Mandern vergleicht die Genre-Bilder der flämischen Maler mit den Heiligen- und Märtyrerdarstellungen der zeitgenössischen Italiener und kommt zum Schluss, nicht der Gegenstand eines Bildes sei das Wesentliche, sondern die Kunst der Darstellung, weshalb die Gemälde der Flamen trotz der einfachen Sujets den neueren Italienern weit überlegen seien, welche „das Grosse und Erhabene auf eine conventionelle kleinliche Art“ behandelten. Ihre Bilder seien bloss „mittelmässige Nachahmungen der Kunst“ statt „schöner Nachahmungen der Natur“ (IS III: 165). Das Kunstgespräch dehnt sich auch auf die Verdienste König Christians IV. aus, der die Malerei liebe und sie richtig zu beurteilen vermöge.
Albert spielt in seiner Verkleidung als junge Holländerin van Leuvens Frau, in einer Intrige, die den WF entstammt, jedoch von London auf ein Landgut bei Kopenhagen transferiert und zu einer detailreichen Szene ausgemalt wird. Dabei verliert van Leuven beinahe seine heimliche Braut Concordia, die sich von ihm hintergangen glaubt, weil sie Alberts Rollenspiel nicht durchschaut und ihn für die Frau ihres Geliebten hält. Doch alles wird aufgeklärt, die Entführung gelingt und das frisch getraute Ehepaar schifft sich zusammen mit Albert und Minga, Concordias schwarzer Dienerin, und dem Hündchen Beautiful nach Ostindien ein. Die Seereise endet wie in den WF mit Sturm, Schiffbruch und Rettung auf der Insel Felsenburg.10
Die nun folgende Erzählung des Lebens der Schiffbrüchigen auf der Insel gestaltet sich in den wesentlichen Grundzügen wie in den WF, wobei viele der in diesem Kontext von Schnabel geschilderten Ereignisse in charakteristischer Weise ausgemalt und erweitert werden: die Veränderungen machen nämlich fast durchwegs Bezüge zu anderen Texten sichtbar. Als Beispiel sei Robinson Crusoe genannt, auf den mehrmals ironisierend angespielt wird; so erinnert z.B. die Beschreibung, die Albert von sich selber und seiner Kleidung gibt (IS III: 295), an eine ähnliche Selbstdarstellung Robinsons (DefoeDefoe, Daniel 1719: 176–177). Ebenso spielt Alberts Angst vor Kannibalen, die ihn „greifen, schlachten, braten und verzehren“ könnten (IS III: 301), auf Robinsons Ängste an, wobei die Ironie nicht nur in der Häufung der Schreckensverben liegt, sondern auch in der Umkehrung der Chronologie, da zu der Zeit, als Albert auf die Insel gelangte, Robinson Crusoe noch gar nicht existierte.
Ein anderer Bezugstext könnte, wie schon für Schnabels WF, auch wieder NevillesNeville, Henry Isle of Pines sein, worauf die Anwesenheit Mingas unter den Schiffbrüchigen und Lemelies Thematisierung des Sexualverkehrs mit ihr hinzuweisen scheinen, denn beim Schiffbruch in The Isle of Pines wird ebenfalls eine Schwarze gerettet; aber im Gegensatz zu Lemelie, für den eine Vereinigung mit Minga undenkbar ist (IS III: 313), schläft Joris Pines, der einzige gerettete Mann, auch mit der Schwarzen, wie mit den drei überlebenden weissen Frauen (Neville 1999: 197–198).
Trotz solcher Anspielungen folgt der Verlauf der Erzählung in dieser Phase der Vorgabe Schnabels, wobei öfters nur leicht umgearbeitete Sätze oder wörtlich belassene Satzfragmente aus den WF übernommen wurden. Einige Passagen weisen ein so dichtes Netz wörtlicher Übernahmen auf, dass der Text stellenweise wie ein Mosaik aus Zitaten11Kristeva, Julia der WF und Oehlenschlägers eigenen Formulierungen erscheint.12Arnim, Achim von
Auch die Geschehnisse um die Entdeckung der Höhle von Cyrillo de Valaro, dem spanischen Erstbesiedler der Insel, stimmen in den wesentlichen Zügen mit den entsprechenden Vorgängen in den WF überein.13 Das Manuskript mit Cyrillos Lebensbeschreibung ist dabei der wertvollste Fund, den die Höhle birgt; Albert übersetzt es aus dem Lateinischen und liest es dann seinen Gefährten vor. In der Inselgegenwart übergibt er Eberhard die wohlverwahrten Papiere, mit der Bitte, sie den Zuhörern vorzulesen (IS III: 360). Damit erweist sich Cyrillos Manuskript als Schnittpunkt polyphoner Phänomene: Dem Publikum wird ein Bericht vorgetragen, dessen lateinische „Originalstimme“ von einer deutschen Version überlagert wurde, wobei Eberhards Stimme jene des eigentlichen Erzählers Albert ablöst. Abgesehen von den Geschehnissen rund um den Manuskriptfund unterscheidet sich Cyrillos Biographie in vieler Hinsicht sehr deutlich von Schnabels entsprechender Erzählung. Ein besonders signifikantes Ereignis ist dabei die Begegnung des Spaniers mit AriostAriosto, Ludovico, die durch Verschiebungen in der Schnabelschen Chronologie ermöglicht wird und zu weitgespannten Diskussionen über Poetik und Dichtkunst führt.14Ariosto, Ludovico Mit der Lesung von Cyrillos Manuskript schliesst der dritte Band.
Im vierten Teil berichtet Albert über die einschneidendsten Ereignisse auf der Insel: Wie in den WF ermordet Lemelie van Leuven, um Concordia zu besitzen; dann aber weicht der Text von Schnabels Vorlage ab, denn Minga, die bei Schnabel nicht vorkommt, hat den Mord beobachtet und wird deswegen von Lemelie beinahe erwürgt, worauf sie ihn einige Tage später tödlich verwundet. Während er in den WF sterbend eine Beichte seines lasterhaften Verbrecherdaseins ablegt, hat er in den IS sein Leben niedergeschrieben: „Ich bin auch Schriftsteller geworden“, und fordert die andern auf, seine Geschichte zu lesen (IS IV: 53). Diese ist im Vergleich zu Schnabels Pendant sehr stark ausgeweitet und vor allem in einem realen geschichtlichen Kontext verortet, denn Lemelie wird in Paris zur Zeit der blutigen Hugenottenkriege geboren. Die Grausamkeit dieser Religionswirren dient ihm als Apologie seiner Freveltaten: „[…] wie ich es getrieben, haben es Viele getrieben, und die meisten meiner Zeitgenossen waren ärger als ich“ (IS IV: 53). Laut seiner Erzählung war er an der Ermordung Heinrichs IV. beteiligt, denn er stiftete Franz Ravaillac zum Königsmord an. Nach der detailliert geschilderten, äusserst brutalen Hinrichtung des Königsmörders verlässt Lemelie Paris, begeht in Florenz einen bestialischen Mord an seinem eigenen neugeborenen Kind und unterschreibt mit dessen Blut einen Pakt mit dem Teufel. Er bereichert sich durch Geldspiele, geht als Freibeuter zur See, wird bei einer Meuterei gehängt, kommt dennoch mit dem Leben davon, was er dem Teufelspakt zuschreibt, und gelangt schliesslich nach Kopenhagen, wo er das Schiff ausrüstet, mit dem van Leuven und die Seinen nach Ostindien reisen wollen. Hier endet sein Manuskript; den Rest seiner Verbrechen, die Ermordung van Leuvens und den Mordversuch an Minga, beichtet er mündlich; dabei sieht er immer den Teufel im Spiel, von dem er nun auch geholt wird, wie er glaubt, und sich eine Todesszene ausmalt, wie man sie in Anklängen aus dem Faustbuch kennt: „Dann greift er [der Teufel] uns beim Genick, zerschmettert den Gehirnkasten gegen den Fensterpfosten, verschwindet mit der verdammten Seele […]“ (IS IV: 110), und wie Faust schreit auch er um Hilfe, ehe er den Geist aufgibt (IS IV: 110).15
Albert und Concordia trauern um van Leuven, und wagen längere Zeit nicht, einander ihre Liebe zu gestehen. Albert sucht nach einem Zeichen, dass Concordia ihn liebt, und erinnert sich dabei an ein Gedicht, das sie einst geschrieben hatte, als sie ihn tot glaubte, weil er von seinen Inselerkundungen lange nicht zurückkehrte. Sie hatte es damals zerrissen, ohne es ihm zu zeigen. Die Gedichtfetzen sind durch einen „tiefe[n], schmale[n] Riss“ gefallen, aus dem er sie jetzt herausholt, indem er seinen „Stab“ in die Ritze steckt: „Ich klebte ein wenig Wachs an meinen Stab, und so langte ich gemächlich alle Papierfragmente herauf“ (IS IV: 132). Die sexuell konnotierte Aktion fördert schliesslich eine Liebeserklärung an Albert zutage, die Concordia – noch zu Lebzeiten van Leuvens – in Gedichtform verfasst hatte, womit sie sich, nebenbei gesagt, auch als Dichterin erweist. Wie die genussvolle Verzögerung eines Sexualaktes wirkt es, wenn Albert sich „nicht übereilen, sondern den schönen Spaziergang durch den Garten zu Paphos Schritt vor Schritt machen [will], wohl wissend, dass eben die Umwege […] am schönsten zum Ziele führen“ (IS IV: 134). Dieser „Garten zu Paphos“16 wird mit Paradiesvorstellungen assoziiert, denn Concordias „dänische Handschuhe“17 schmiegen sich „wie feine Häute um die schönsten Schlangen“ (IS IV: 137). Ihre Unterrichtsstunde im Lautenspiel erscheint mit der Erwähnung des „Fingersatzes“, den sie Albert lehren will, indem sie ihm „gerade auf den Leib [geht]“, und seine Finger „zurecht auf die Saiten“ setzt, als maskiertes Sexualspiel (IS IV: 138–139).
Sie feiern Hochzeit, aber nicht nach dem strengen Ritual aus der biblischen Tobiasgeschichte wie in den WF,18Neville, Henry sondern mit einem Lied, das Albert für den Anlass dichtete19Neville, Henry und das er Eberhard nun zu lesen gibt; es bildet den Schlusspunkt von Alberts Erzählung.
Der auktoriale Erzähler ergreift wieder das Wort und schildert die Ereignisse nach der Ankunft Eberhards und seiner Gefährten auf der Insel Felsenburg. Dazu gehören der Bau einer Kirche und die Lebensgeschichten von Litzberg und Lademann, Eberhards Liebe zu Cordula, der Urenkelin van Leuvens und Concordias, die Ankunft von Eberhards Vater auf der Insel Felsenburg, und schliesslich Alberts Tod, der ein allmähliches Erlöschen ist, währenddessen Albert sein ganzes Leben mit allen wichtigen Personen in einer Traumvision an sich vorbeiziehen sieht. Nach seinem Tod verändert sich das Zusammenleben auf der Insel: Es bilden sich Parteien, und Streitigkeiten entstehen, da Cordulas Vater, Robert Hulter, auf seine Adelsabstammung als Nachfahre van Leuvens pocht. Der Zwist wird kurzfristig unterbrochen, als sie von portugiesischen Schiffen aus bombardiert werden (IS IV: 267). Die Felsenburger vermögen sich zu wehren, wissen aber, dass ihre Unabhängigkeit bedroht ist, umso mehr, als ein Erdbeben den schützenden Felsgürtel der Insel teilweise zerstört hat, so dass sie nicht mehr uneinnehmbar ist. Weiteres Ungemach kündigt sich an, als Eberhard einen Nebenbuhler erhält, der ebenfalls Cordula heiraten will und von ihrem Vater favorisiert wird. Der Rivale entführt Cordula nach Europa, und Eberhard reist ihnen nach. Er findet nach verschiedenen Wirren und märchenhaft anmutenden Begebenheiten Cordula, die Shakespeare-Shakespeare, WilliamNachfahrin, in Stratford wieder und kehrt mit ihr zurück; statt der Insel Felsenburg erreichen sie Klein-Felsenburg, wohin ihre engsten Freunde, samt Hanna Hellkraft, sich zurückgezogen haben, und wo verschiedene Spuren von Wikingern entdeckt werden, welche einst Klein-Felsenburg bewohnt und im Untergrund einer Felsengrotte einen Tempel mit nordischen Götterstatuen errichtet hatten; ausserdem werden Silberplatten gefunden, auf denen die Wikinger ihre eigene Geschichte in isländischen Versen eingraviert hatten. Die verschiedenen Zeitebenen des Textes werden so um eine in Raum und Zeit tiefer liegende Dimension erweitert, was dazu führt, dass das ganze Romangeschehen auf einem nordischen Fundament fusst. Mit einem im Wortsinn vielschichtigen Schlussbild endet der Roman.
Wie aus der Inhaltsangabe hervorgeht, ist die augenfälligste Neuerung in Oehlenschlägers Roman die Ausrichtung des gesamten Textes auf eine zentrale Positionierung der Kunst hin. Diese Fokussierung wird in erster Linie dadurch erreicht, dass der Autor die im Prätext angelegte Polyphonie zu einem Geflecht von Stimmen aus verschiedenen Literatur- und Kunstepochen umgeschaffen hat, die mit den Hauptfiguren in einen vielfältigen, alle Kunstgattungen einbeziehenden Dialog treten. Mit dieser von Schnabel gänzlich unabhängigen Thematik überschreitet Oehlenschlägers Roman trotz Einbezug von Strukturen und Figuren des Prätextes den Rahmen einer blossen Bearbeitung. Bedeutungsvolle Neuerungen sind ausserdem bestimmte geographische Verschiebungen, die, wie in der Inhaltszusammenfassung erwähnt, das Geschehen an prominenten Stellen nach Norden verlegen oder Elemente aus der nordischen Geschichte auf eine der Felsenburger Inseln bringen. Den verschiedenen Aspekten von Oehlenschlägers Neuausrichtung widmen sich die Einzelanalysen dieser Arbeit, die zudem, wie gerade im folgenden Kapitel, auch die bilinguale Sprachgestalt des Textes in den Blick nimmt.