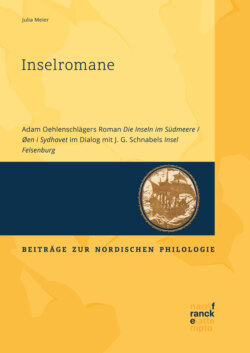Читать книгу Inselromane - Julia Meier - Страница 7
1.2 Methodisch-theoretische Zugänge und Aufbau der Arbeit 1.2.1 Polyphonie, Dialogizität und Intertextualität
ОглавлениеWie erwähnt, sind die beiden Begriffe Polyphonie und Dialogizität in der Literatur- und Kulturwissenschaft eng mit dem Namen Michail M. BachtinsBachtin, Michail M. verknüpft. Bekanntlich hat Bachtin sie im Zuge seiner Analyse von Dostoevskijs Romanen zu Konzepten entwickelt und bezieht sie – jedenfalls, was die Polyphonie betrifft – auch mit einer gewissen Ausschliesslichkeit auf dessen Werk: „Unserer Meinung nach kann nur Dostoevskij als Schöpfer echter Polyphonie gelten“ (Bachtin 1971: 42).1Bachtin, Michail M. Zu diesem Schluss gelangt er im Wesentlichen durch die Erkenntnis, dass Dostoevskij seine Welt „vor allem im Raum und nicht in der Zeit“ gesehen habe, da die Hauptkategorie seiner künstlerischen Sehweise „nicht das Werden, sondern Koexistenz und Wechselwirkung“ gewesen sei (Bachtin 1971: 34; kursiv im Original). Es geht also nicht um Entwicklung, um ein zeitliches Nacheinander oder ein kausales Folgeprinzip von Phänomenen, sondern um deren Gleichzeitigkeit, um ein räumlich gesehenes Nebeneinander und Koexistieren aller möglichen, auch divergierenden Themen: „Sich in der Welt zurechtzufinden, bedeutete für ihn [Dostoevskij], alle ihre Inhalte als gleichzeitige zu denken und ihre Beziehungen zueinander in einem einzigen Augenblick zu erraten“ (Bachtin 1971: 35; kursiv im Original). Im Weiteren stellt Bachtin zur genaueren Definition seines Polyphoniebegriffs die Unterschiede zwischen dem aus seiner Sicht monologischen und dem polyphonen Roman dar, wobei er als zentrales Element der Polyphonie die Gleichberechtigung der Bewusstseine des Autors und seiner Figuren betont:
[D]as Bewusstsein des Autors macht fremde Bewusstseine (d.h. die der Helden) nicht zu Objekten und legt sie nicht in ihrer Abwesenheit endgültig fest. Es fühlt neben und vor sich gleichberechtigte, fremde Bewusstseine, die genauso unendlich und unabschliessbar sind wie es selbst. […] Vom Autor des polyphonen Romans wird nicht der Verzicht auf sich selbst und sein eigenes Bewusstsein verlangt, sondern eine ungewöhnliche Erweiterung, Vertiefung und Umstrukturierung dieses Bewusstseins, […] damit es vollberechtigte fremde Bewusstseine aufnehmen kann. (BachtinBachtin, Michail M. 1971: 77)2Bachtin, Michail M.
Der polyphone Roman erscheint in der Fortführung der Argumentation als Textraum, in dem verschiedene Bewusstseine gleichrangig bestehen, eine Stimme erhalten und – ganz wesentlich für BachtinBachtin, Michail M. – miteinander in eine dialogische Beziehung treten (Bachtin 1971: 98).3Bachtin, Michail M. Der gleichberechtigten Vielfalt von Bewusstseinen entspricht die Koexistenz verschiedenster Schattierungen der sie als Medium tragenden Sprache, die
in jedem Augenblick ihrer historischen Existenz durchgängig in der Rede differenziert [ist]. Es ist dies die personifizierte Koexistenz sozioideologischer Widersprüche zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, zwischen verschiedenen Epochen der Vergangenheit, zwischen verschiedenen sozioideologischen Gruppen der Gegenwart, zwischen Richtungen, Schulen, Zirkeln usw. Diese „Sprachen“ der Redevielfalt kreuzen sich auf vielfältige Weise miteinander und bilden dadurch neue sozialtypische „Sprachen“. […] Als solche können sie sehr wohl einander gegenübergestellt werden, können sie sich wechselseitig ergänzen, können sie einander widersprechen, können sie dialogisch aufeinander bezogen sein. (BachtinBachtin, Michail M. 1979: 182–183)
Es wird nicht nur durch die Anführungszeichen klar, dass der Terminus „Sprachen“ im Verlauf der Textpassage einen vom herkömmlichen Gebrauch abweichenden, viel umfassenderen Sinn annimmt; wie BachtinBachtin, Michail M. ausführt, meint er damit so viel wie „spezifische Sichten der Welt, eigentümliche Formen der verbalen Sinngebung, besondere Horizonte der Sachbedeutung und Wertung“ (Bachtin 1979: 183), ein Konglomerat, das man vielleicht – im Sinn einer den einzelnen Gruppierungen gemeinsamen Denk- und Argumentationsform – als „Diskurs“ bezeichnen könnte. Diese sich überlagernden oder überschneidenden, miteinander dialogisierenden Diskurse münden insgesamt in eine Dynamisierung des Textbegriffs, der folgerichtig auch keine stabilen Grenzen mehr kennt, woraus sich schliesslich ein Dialog zwischen Texten entwickelt:
Jedes Wort (jedes Zeichen) eines Textes führt über seine Grenzen hinaus. Es ist unzulässig, die Analyse (von Erkenntnis und Verständnis) allein auf den jeweiligen Text zu beschränken. Jedes Verstehen ist das In-Beziehung-Setzen des jeweiligen Textes mit anderen Texten und die Umdeutung im neuen Kontext (in meinem, im gegenwärtigen, im künftigen). […] Der Text lebt nur, indem er sich mit einem andern Text (dem Kontext) berührt. Nur im Punkt dieses Kontaktes von Texten erstrahlt jenes Licht, das nach vorn und nach hinten leuchtet, das den jeweiligen Text am Dialog teilnehmen lässt. (BachtinBachtin, Michail M. 1979: 352–353)
Trotz der metaphorischen Überhöhung, die den Schluss der zitierten Stelle kennzeichnet, tritt doch das Wesentliche, BachtinsBachtin, Michail M. dynamisches Textverständnis, klar zutage. Dieses stand auch für Kristeva im Vordergrund, als sie bei ihrer Beschreibung und Analyse zweier Werke Bachtins, dem bereits zitierten Buch über Dostoevskij sowie seiner Untersuchung zu Rabelais’ Werk, den Begriff der Intertextualität prägte (Kristeva 1972: 348) – ein Terminus, der in der Folge selber polyphonen Charakter annehmen sollte, da er sehr unterschiedliche „Stimmen“, Deutungen und Definitionen umfasst. Das Spektrum reicht bekanntlich von der sogenannten „weiten“ Anschauung Kristevas,Kristeva, Julia die, wie erwähnt, jeden Text als „Mosaik von Zitaten“, als „Absorption und Transformation eines andern Textes“ versteht (Kristeva 1972: 348), bis zu „engen“ Auslegungen, die Intertextualität nur bei „markierter“, d.h. expliziter Aufnahme von andern Texten in den jeweiligen Grund- oder Haupttext erkennen (vgl. Broich 1985a: 31–47). Kristevas Lesart wird von der modernen Bachtinforschung oft als „produktives Missverständnis“ bezeichnet, da sie Bachtins Positionen (vor allem in Bezug auf Autorschaft und Autorintention) unzutreffend auf postmoderne Theoreme hin zuspitze (Grübel 2008: 317, Fussnote 3, und 342). Eine Umakzentuierung von Bachtins Konzeption der Dialogizität durch Kristeva stellte auch schon Manfred Pfister in seinem Aufsatz „Konzepte der Intertextualität“ fest (Pfister 1985a: 6–11). Sylvia Sasse hingegen ist der Ansicht, dass Kristeva mit ihrer Auffassung des „Dialogismus […] auf der Ebene des bachtinschen denotativen Wortes als Prinzip jeglichen Aussagens“ (Kristeva 1972: 357) Bachtins Ansatz nicht eigentlich erweitere, sondern bestätige, wobei Kristeva allerdings durch ihren Befund, die poetische Sprache sei als solche dialogisiert, Bachtins Differenzierung „zwischen monologischer und dialogischer Schreibweise gerade im Poetischen“ aufhebe (Sasse 2010: 91). Damit weist Sylvia Sasse auf einen wichtigen Punkt, in dem Kristeva Bachtins Konzept tatsächlich weiterentwickelt: Die von ihr postulierte, der poetischen Sprache als solche inhärente Dialogizität nähert sich postmodernen Betrachtungsweisen an, in denen es z.B. um eine Entgrenzung des Werkbegriffs geht, oder anders gesagt, um die Erweiterung der scheinbar klar feststehenden Werkgrenzen. Nicht diese Abgrenzungen im Sinne von deutlichen Konturen eines Werkes stehen im Vordergrund, sondern dessen Einflechtung in das Netz existierender Texte, die Kristeva zufolge allein schon durch das Medium Sprache gegeben ist. Die Vorstellung des Werkes als herausragender Skulptur wird abgelöst von dem Gedanken an ein Gebilde aus verschiedensten Textfäden, die es vielseitig verknüpfen – was im Übrigen ja schon der Wortsinn des lateinischen textus besagt. Dass dieses Gewebe als dynamische Textur zu verstehen ist, hat Roland BarthesBarthes, Roland deutlich gemacht, indem er den Text nicht mehr als fertiggestelltes Produkt begreift, sondern die Betonung legt auf „l’idée générative que le texte se fait, se travaille à travers un entrelacs perpétuel; […]“ [die generative Idee, dass der Text sich selbst herstellt, sich erarbeitet durch ein kontinuierliches Flechten; […] (Barthes 1973: 101).
In ähnlicher Weise sind für FoucaultFoucault, Michel die Ränder des Buches unscharf abgegrenzt, da er es in einem System von Verweisen auf andere Bücher, Texte, Sätze sieht:
C’est que les marges d’un livre ne sont jamais nettes ni rigoureusement tranchées: par-delà le titre, les premières lignes et le point final, par-delà sa configuration interne et la forme qui l’autonomise, il est pris dans un système de renvois à d’autres livres, d’autres textes, d’autres phrases: nœud dans un réseau. (FoucaultFoucault, Michel 1969: 34)
Die Ränder eines Buches sind weder sauber noch scharf geschnitten: Über den Titel, die ersten Linien und den Schlusspunkt hinaus, über seine innere Gestaltung und die Form, die es als Buch konstituieren, hinaus, ist es verhaftet in einem System von Verweisen auf andere Bücher, andere Texte, andere Sätze: ein Knoten in einem Netzgewebe.
Diese Betrachtungsweisen bringen in unterschiedlichen Bildern den dynamischen Charakter eines Textes, Werkes oder Buches zum Ausdruck; sie betonen die Verknüpfungen oder Verflechtungen zwischen verschiedenen Texten, stellen scheinbar etablierte Werkgrenzen ebenso wie klar definierte Textränder zur Diskussion. Damit teilen sie die von KristevaKristeva, Julia im Rückgriff auf BachtinBachtin, Michail M. entwickelten Perspektiven und positionieren sich im Bereich der ontologischen Intertextualitätstheorien. Da diese jedoch dafür kritisiert wurden, kein konkretes, zur Textanalyse taugliches Instrumentarium aufzuweisen, bildeten sich im Gegenzug deskriptive Intertextualitätskonzepte heraus, die einerseits zwar in vielen Punkten an die alte Einfluss- und Quellenforschung erinnern,4Kristeva, Julia andrerseits aber doch für die Untersuchung von Texten hilfreiche Anwendungskategorien bieten und sich von den vor-postmodernen Theorien durch die Beobachtung und Beschreibung der Relationen und Interaktionen zwischen Texten unterscheiden.
So entfaltet z.B. Gérard GenetteGenette, Gérard in Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe5Genette, Gérard ein breit gefächertes System für die Beschreibung von Textbeziehungen. Er beruft sich dabei explizit auf KristevasKristeva, Julia Bezeichnung „Intertextualität“, definiert den Begriff aber „wahrscheinlich restriktiver“ (Genette 1993: 10), nämlich für die „effektive Präsenz eines Textes in einem andern Text“ (Genette 1993: 10), die er eingrenzt auf die drei Kategorien Zitat, Plagiat oder Anspielung. „Intertextualität“ in diesem engen Sinn ist für ihn nur einer von fünf verschiedenen, aber vielfach miteinander verbundenen Typen seiner Klassifizierung transtextueller Beziehungen. Neben der Intertextualität sind dies die „Paratextualität“, die er später unter dem Titel Seuils in einem eigenen Buch behandeln wird,6Genette, Gérard die „Metatextualität“ als stillschweigende oder explizite Kommentierung eines anderen Textes, die „Architextualität“, womit die auf Gattungszugehörigkeit beruhende Verbindung mit anderen Texten gemeint ist, sowie die „Hypertextualität“, jener Typus, mit dem sich Genette in Palimpseste fast ausschliesslich beschäftigt. Er versteht darunter sämtliche Beziehungen zwischen einem Prätext und einem darauf basierenden Folgetext (Genette 1993: 14–15). Seine Bezeichnungen für die entsprechende Textsituation, „Hypotext“ und „Hypertext“, weisen dabei auf die grundlegende Art dieser Beziehung zwischen zwei Texten: Es handelt sich um die „Überlagerung“ des Folgetextes über einen bereits existierenden Text, der dem neuen Werk gewissermassen „unterlagert“ ist, wie das die Vorsilben „hypo-“ und „hyper-“ zum Ausdruck bringen; daraus erklärt sich natürlich auch der Titel Palimpseste, der wiederverwendete Manuskriptseiten bezeichnet, die nach Abschaben oder Abwaschen der Erstbeschriftung neu beschrieben worden waren. Bei diesen schon aus der Antike bekannten und im Mittelalter weitergeführten Praktiken schimmerte manchmal die Erstbeschreibung noch durch, blieb also unter dem überschriebenen Text sichtbar. Auch Genettes Untertitel Die Literatur auf zweiter Stufe bezeichnet die Art der von ihm untersuchten Textbeziehung, die er gesamthaft unterteilt in „Transformation“ und „Nachahmung“; beide Begriffe erfahren zusätzliche Differenzierungen und Gliederungen, je nach Beschaffenheit des Verhältnisses zwischen Hypo- und Hypertext, z.B. aus stilistischer, funktionaler oder gattungsbezogener Perspektive.
Einen weiteren wichtigen Beitrag zu einer deskriptiven Intertextualitätstheorie leistet die bereits kurz erwähnte, von Ulrich Broich und Manfred Pfister 1985 herausgegebene Aufsatzsammlung Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, die sich zum Teil als Reaktion auf GenettesGenette, Gérard Palimpseste versteht, dessen Gesichtspunkte in verschiedener Hinsicht präzisiert, ergänzt und durch konkrete Analysen von Texten der englischen Literatur, die Genette trotz seiner weitgespannten Untersuchung „nur relativ selten“ berücksichtige, erweitert werden sollen (Broich/Pfister 1985: IX). In den theoretischen Prämissen etablieren die Herausgeber die Unterscheidung zwischen der Einzeltextreferenz, also dem Bezug eines Textes auf einen Prätext, und der Systemreferenz, d.h. der Beschreibung eines Textes im Verhältnis zu Gattungsnormen oder anderen strukturbildenden Textsystemen. Es wird erwähnt, dass diese Unterscheidung sich in anderer Terminologie schon bei Genette finde (Broich 1985b: 49, Fussnote 3), während gewisse Aspekte der Systemreferenz mit Elementen von BachtinsBachtin, Michail M. und KristevasKristeva, Julia Intertextualitätskonzeption übereinstimmten (Pfister 1985b: 54). So gesehen, schaffen die beiden Autoren also auch Verbindungen zwischen dem ontologischen und dem deskriptiven Intertextualitätsbegriff, wobei aber die präzisen Beschreibungen und Definitionen der verschiedenen Formen von Intertextualität für ihre Publikation bestimmend sind.
In meiner Arbeit stütze ich mich, wie erwähnt, vor allem auf die Konzepte der Polyphonie und der Dialogizität, wie sie von BachtinBachtin, Michail M. entwickelt wurden; ich möchte untersuchen, inwieweit die Präsenz anderer Texte in Oehlenschlägers Roman sich als gleichrangige „Stimmen“ im Sinne Bachtins manifestieren. Auch betrachte ich die verschiedenen, jeweils in zwei Sprachen erschienenen Fassungen dieses Romans als Phänomene, welche die Werkgrenzen durchlässig machen und das Prozesshafte, Dynamische des Textes ins Blickfeld rücken. Dennoch werde ich für die Beschreibung bestimmter formaler Aspekte von intertextuellen Beziehungen auf die Arbeiten von GenetteGenette, Gérard und Broich/Pfister zurückgreifen und überdies andere Erkenntnisse und Beiträge zur Intertextualitätsforschung, wie z.B. von Harold BloomBloom, Harold oder Renate Lachmann, einbeziehen.
Auch BachtinsBachtin, Michail M. Theorien zur Karnevals- und Lachkultur, wie er sie in seiner umfassenden Untersuchung zu Rabelais und zur Volkskultur von Mittelalter und Renaissance darstellt (Bachtin 1995), haben sich als hilfreich für die Beschreibung bestimmter Phänomene in Oehlenschlägers Roman erwiesen und sollen darum zur Stützung einzelner Analysen meiner Arbeit ebenfalls berücksichtigt werden.