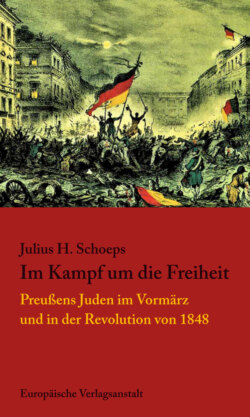Читать книгу Im Kampf um die Freiheit - Julius H. Schoeps - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Licht der Aufklärung: Die „Gesellschaft der Freunde“
ОглавлениеDie Krise des jüdischen Traditionalismus Ende des 18. Jahrhunderts spiegelte sich auch in der wachsenden Zahl jüdischer Aufklärer, welche begannen, auch den Glauben ihrer Väter radikal in Frage zu stellen, und die die Ansicht vertraten, eine Reform der Ritualgesetze müsse schon aus Gründen der Vernunft erfolgen. Der Naturforscher Mordechai Schnaber (Georg Levisohn) etwa legte in seinem Buch „Ma’amar ha-torah we ha-chochmah“ („Über die Verbindung von Thora und Vernunft“, 1770/1771) dar, dass viele Gesetze des Judentums ohne Kenntnisse in den Wissenschaften nicht zu verstehen seien. Zwischen dem Vernunftdenken und der Religion könne und solle kein Gegensatz konstruiert werden. Auch religiöse Gesetze, so Schnaber, müssten rational begründet werden.
Saul Berlin, Rabbiner in Frankfurt an der Oder und Sohn des Berliner Oberrabbiners Hirschel Lewin, ging noch etwas weiter, indem er in seinem Buch „Ketav Joscher“ („Schrift der Aufrichtigkeit“, 1794) nicht nur das Unzeitgemäße des damaligen jüdischen Erziehungs- und Bildungssystems in satirischer Form attackierte, sondern seinen Zeitgenossen auch vorwarf, sie verhielten sich „wie Esel“, wenn sie sich den Ritualgesetzen freiwillig unterwerfen würden. Diese Kritik ging weit über Moses Mendelssohns Modernisierungsprogramm hinaus, der die Ritualgesetze nur vorsichtig kritisiert, aber nicht die Beseitigung vernunftwidriger Vorschriften und Gebote gefordert hatte.
Widerstand gegen überkommene traditionelle Strukturen regte sich in Vereinigungen wie der 1792 gegründeten „Gesellschaft der Freunde“.12 Ihre Gründer, zu denen Isaac Euchel, Aaron Wolfsohn, Aron Neo, Nathan Oppenheimer und Joseph Mendelssohn, der älteste Sohn des Philosophen, gehörten, wollten jüngeren unverheirateten Juden, denen der Zutritt zu öffentlichen Vergnügungsstätten häufig verwehrt wurde, die Möglichkeit eines geselligen Zusammentreffens ermöglichen. So sollten sie im Rahmen der „Gesellschaft“ eine alternative Gelegenheit erhalten, die Sorgen des Lebens zeitweilig zu vergessen und sich in Wohlwollen und Freundschaft zu begegnen.
Bei der Gründungsversammlung der „Gesellschaft der Freunde“ am 29. Januar 1792 waren rund einhundert Personen anwesend. „Das Licht der Aufklärung“, so erklärte bei diesem Anlass Joseph Mendelssohn, „[…] zeigt seine wohlthätige Wirkung seit mehr als 30 Jahren auch auf unsre Nation. Auch unter uns nimmt die Menge derer täglich zu, die in ihrer väterlichen Religion das Unkraut von dem Waitzen unterscheiden, und besonders in dem Staate, in dem wir leben […].“13 Das Motto, das sich die „Freunde“ wählten, war der berühmte Stammbucheintrag Moses Mendelssohns: „Bestimmung des Menschen: Nach Wahrheit forschen, / Schönheit lieben, / Gutes wollen, / das Beste thun“14.
Zunächst war die neugegründete Gesellschaft auf das Wohlwollen der Berliner Gemeindeverantwortlichen gestoßen. Das änderte sich, als der seit längerem schwelende Streit um den Bestattungsritus offen ausbrach. Die Aufklärer um Isaak Euchel und Joseph Mendelssohn wollten verstorbene Mitglieder der Bruderschaft nicht mehr sofort beerdigen lassen, wie das der jüdische Brauch forderte. Sie argumentierten dabei ähnlich, wie das Moses Mendelssohn bereits 1772 getan hatte, als er zu einer Änderung des Brauches der sofortigen Bestattung aufgerufen hatte. Anlass war damals das Verbot des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin gewesen, das den Juden untersagte, ihre Toten vor dem dritten Tag nach dem Ableben zu bestatten.
Der Streit um den Zeitpunkt der jüdischen Bestattung drehte sich vordergründig um die Frage des Scheintodes und die Gefahr, dass jemand womöglich lebendig begraben werden könnte. Gleichwohl war es nicht nur ein Streit in der Sache, sondern ein Streit zwischen Traditionalisten und Aufklärern, wobei die Ersteren aus nicht nachvollziehbaren Gründen zäh an dem Brauch der Frühbeerdigung festhielten. Salomon Seligmann Pappenheimer etwa, Rabbiner in Breslau, zog sich Kritik und Spott der aufgeklärten Kreise insbesondere dadurch zu, dass er in einer Anzahl von Schriften vehement dafür plädierte, den Brauch der Frühbestattung nicht aufzugeben.
Im Verlauf der Jahre entwickelte sich die „Gesellschaft der Freunde“ zunehmend zu einer karitativen Vereinigung. Vereinzelt wurden auch christliche Mitglieder aufgenommen, allerdings blieb ihr Anteil an der Gesamtmitgliederzahl verschwindend gering. In den Augen traditionell eingestellter Juden blieb diese Vereinigung jedoch eine Gesellschaft von Neuerern. Das Misstrauen war groß und insofern durchaus zutreffend, als die „Gesellschaft“ sich zunächst als ein Bund junger Juden konstituiert hatte, dessen Mitglieder zwar an ihren Familientraditionen und an ihrem Glauben festhielten, aber gleichzeitig auch die „Fesseln nationaler Absonderung […] von ihrem eigenen Denken und Thun“15 abschütteln wollten.
Die „Gesellschaft der Freunde“ entwickelte sich nun zu einer Art Kulturzentrum, in der Gleichgesinnte verkehrten, um sich zu treffen und um in vertrauter Runde sich miteinander auszutauschen. Anfänglich war es der jüdische Charakter, der die „Gesellschaft“ prägte. Das war ein Sachverhalt, der sich im Verlauf der Zeit jedoch allmählich änderte. Je mehr ihre Mitglieder in die nichtjüdische Welt „eintauchten“, je mehr sie sich mit Berlin, Preußen und Deutschland identifizierten, desto mehr begann man in der „Gesellschaft“, die religiöse Zugehörigkeit als Privatangelegenheit zu betrachten.
Sieht man sich die Mitgliederlisten der „Gesellschaft“ an, so zeigt sich, dass in diesen die Namen bekannter Familien wie die Mendelssohns, die Veits, die Liebermanns, die Friedländers, die Bleichröders, aber auch die Rathenaus prominent verzeichnet sind – Familien, die die Berliner Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik im 19. und frühen 20. Jahrhundert in starkem Maße geprägt haben. Der Historiker Sebastian Panwitz hat ermittelt, dass mehr als 2.300 Personen Mitglieder der „Gesellschaft“ waren. Die in der von Panwitz zusammengestellten Liste aufgeführten Namen lesen sich geradezu wie ein „Who is who“ der Berliner „besseren“ jüdischen Gesellschaft jener Jahre.
Die „Gesellschaft der Freunde“ hat bis in die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts existiert, bevor sie von den Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Sie galt als „jüdische Gesellschaft“, obgleich das Judentum und die konfessionelle Zugehörigkeit in der Spätzeit bei den Mitgliedern kaum noch eine Rolle spielten. Man bekannte sich zwar zur einstigen jüdischen Herkunft der „Gesellschaft“, sah das aber nicht als Makel, sondern eher als eine Auszeichnung an.