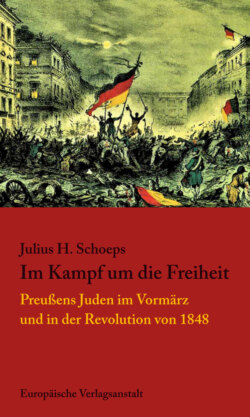Читать книгу Im Kampf um die Freiheit - Julius H. Schoeps - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Wiener Kongress, der Sieg der Restauration und die wiedereinsetzende Diskriminierung der Juden
ОглавлениеNach dem Sieg der Koalitionsmächte über das napoleonische Frankreich und nach der Auflösung des Rheinbundes gerieten in Preußen die Reformen wieder ins Stocken. Auch die Bemühungen um die Judenemanzipation kamen mehr oder weniger zum Stillstand. Unabhängig vom Wiener Kongress und dem 1815 entstandenen Deutschen Bund, dem fast 40 Staaten und freie Städte angehörten, hielt man in einigen Herrschaftsgebieten an dem zuvor geschaffenen Stand der Emanzipationsgesetzgebung fest. Doch in anderen war man bemüht, das Rad wieder zurückzudrehen und die den Juden gewährten Staatsbürgerrechte erneut einzuschränken.
Insgesamt gab es 21 oder 22 verschiedene Reglements bzw. Gesetzesverordnungen für die Juden. Es können sogar 31 Judenordnungen gewesen sein, wenn man kleine und kleinste Gebiete berücksichtigt, die Preußen zugeschlagen worden waren und die ebenfalls spezifische Regelungen für die jüdischen Untertanen verabschiedet hatten. Bestand hatte das Edikt von 1812 in seiner ursprünglichen Fassung nur für die Provinzen Brandenburg, Pommern, Ostpreußen und Schlesien.
Am kompliziertesten, weil am widersprüchlichsten, war die Entwicklung in Preußen, das sich durch die Neuordnung des Kontinents ab 1815/16 um rund vierzig Prozent auf 278.000 Quadratkilometer vergrößert hatte. Statt 4,5 Millionen zählte Preußens Bevölkerung jetzt über 10,3 Millionen Menschen. Diese Entwicklung führte dazu, dass ein ganzes Konglomerat von Landesteilen mit unterschiedlichen Verfassungs– und Verwaltungsvorschriften existierte. Für die jüdische Bevölkerung war die Gesetzeslage kaum noch zu überblicken.
In den neu hinzugekommenen westfälischen, rheinischen und polnischen Gebieten kam das Edikt von 1812 nicht zur Anwendung. In den Landesteilen, die unter französischem Einfluss gestanden hatten, kam es zur Wiederherstellung der vor der Franzosenzeit geltende Rechtslage, was besagte, dass in den verschiedenen Landesteilen Preußens ab 1815/16 unterschiedlichste Vorschriften und Gesetze für die Juden Geltung besaßen.
Bald wurde vielerorts eine im Zuge der einsetzenden Reaktion um sich greifende Reformmüdigkeit und Emanzipationsunwilligkeit spürbar. Unklar formulierte Passagen des Emanzipationsediktes führten im Übrigen dazu, dass die Fachministerien und Verwaltungsbehörden diese geschickt nutzten, um die angekündigte und versprochene Gleichstellung zu hintertreiben.
Die zugestandene Übernahme bzw. das „Verwalten“, wie es damals genannt wurde, von staatlichen und kommunalen Ämtern wurde beispielsweise als unverbindlicher Auftrag ausgelegt. Besonders das Versprechen des Königs, Juden, die in den Befreiungskriegen als Soldaten gedient hatten, im Staatsdienst einzustellen, wurde nicht eingehalten. Juden, so argumentierte man erneut, seien für den Staatsdienst nicht geeignet.
Das Edikt von 1812 wurde zwar nicht widerrufen, aber die Gegner sahen es als einen unliebsamen Akt an, entstanden in einer Zeit der politischen Not. Man ließ keinen Zweifel daran, dass man nicht gewillt sei, die im Edikt gemachten Zusicherungen zu akzeptieren, sondern daran arbeite, diese zu revidieren. Das zeigte sich unter anderem alsbald an den Universitäten des Landes, wo Juden die bittere Erfahrung machten, dass man ihnen, trotz der im Edikt zugesagten Garantie der Gleichstellung, bei einer möglichen Karriere zahlreiche Steine in den Weg legte.
Als beispielsweise der junge Jurist Eduard Gans (1797–1839) im Mai 1821 ein Habilitationsgesuch einreichte, um sich für eine Professorenlaufbahn zu qualifizieren, wurde ihm bedeutet, dass er als Jude („Lex Gans“) für eine Anstellung an der Berliner Universität nicht in Frage komme. Einer seiner schärfsten Widersacher war der Rechtswissenschaftler Friedrich Carl von Savigny, der Begründer der historischen Rechtsschule. Der konservativ eingestellte Savigny, der aus seiner antijüdischen Einstellung auch bei öffentlichen Anlässen keinen Hehl machte, vertrat die Ansicht, Juden seien „Fremdlinge“, die keinesfalls an einer christlichen Universität lehren dürften.
Dabei hatte sich Eduard Gans als Begründer der „Vergleichenden Rechtswissenschaft“ einen Namen gemacht, insbesondere dadurch, dass er Hegel in die Jurisprudenz einführte und sich um die Sammlung und Herausgabe der Hegelschen Werke verdient machte. Gegenüber Hegel wirkte er allerdings epigonal. Er war aber im Gegensatz zu Hegel kein schöpferischer Geist, wohl aber ein guter Verwerter und Verbreiter von Bildungsgut – mit großen oratorischen Gaben und einer Neigung, immer en vogue zu sein.
Eduard Gans, der heute zu den Vergessenen gehört und erst allmählich wiederentdeckt wird, hat nie abgestritten, dass er schließlich aus Karrieregründen seinerzeit zum Christentum übergetreten ist. Verlange man von ihm ein Lippenbekenntnis, so sei er bereit, ein solches abzugeben, soll er sich gegenüber einem Verwandten, dem aus der Berliner jüdischen Familie Ephraim stammenden Juristen, Schriftsteller und Amateurastronomen Felix Eberty, geäußert haben. „[…] wenn der Staat“, so Gans, „so bornirt ist, daß er mir nicht gestattet ihm in der Art zu nützen, wie es meinen Fähigkeiten angemessen ist, es sei denn, daß ich ein Bekenntniß ausspreche, an das ich nicht glaube […] so soll er seinen Willen haben!“42 Ein zynischer Unterton in dieser Bemerkung ist unverkennbar.
Heinrich Heine, der nicht anders gehandelt hatte als Gans, aber durch den Schritt seines Freundes doch erschüttert war, dichtete damals den Vers an „einen Abtrünnigen“:
Und du bist zu Kreuz gekrochen
Zu dem Kreuz das Du verachtest
Das Du noch vor wenig Wochen
In den Staub zu treten dachtest! 43
Der Eduard Gans-Biograph Hanns Günther Reissner hat wohl richtig gesehen, dass Heine, der zu dem Zeitpunkt bereits ebenfalls die Taufe genommen hatte, mit diesem Gedicht „nicht nur Gans verurteilte, sondern gleichzeitig sich selbst“.44 Die Konvertiten-Problematik hat Heine sicherlich stärker belastet als Gans. Später hat Heine, der den Akt der Taufe bekanntlich für sich nicht allzu ernst genommen hat, Gans sogar einen „Opportunisten“ genannt, weil dieser den Schritt nur unternahm, um dadurch auf eine Professur zu gelangen. Das hat Heine Gans, auch wenn das mit Blick auf sein eigenes Verhalten widersinnig erscheint, übelgenommen.
Doch zurück zu Savigny und seinem antijüdischen Verhalten. Ein anderer Fall, bei dem er die Zulassung eines Juden an der Berliner Universität zur Privatdozentur blockierte, war derjenige des Juristen Heinrich Bernhard Oppenheim (1819–1880). Auch seine Habilitation wurde 1840 von Savigny hintertrieben. Die Schriftstellerin Bettina von Arnim setzte sich zwar für Oppenheim ein, jedoch ohne Erfolg. Oppenheim, der über eine Fülle von Geist und Wissen verfügte, war schließlich gezwungen, Preußen den Rücken zu kehren und nach Heidelberg auszuweichen, wo er ab 1841 an der dortigen Universität als Privatdozent für Staatswissenschaft und Völkerrecht lehren durfte und eine Zeitlang eine akademische Heimat fand.
Bemerkenswert ist, dass Oppenheim nicht bereit war, sich taufen zu lassen, um eine Professur zu erhalten. Gegenüber Arnold Ruge bemerkte er: „Und insofern ist das Judenthum meine Religion, als es mir eine angeborne politische Stellung gewährt, eine Art Märtyrerthum, die ich nicht, wie ein elender Überläufer verlaßen mag“. Er wolle, so erklärte er, als guter Deutscher gelten „und mich nicht zur Nation hinausschmeißen laßen“.45
„Die Wissenschaftlichen [Wissenschaftler]“, kommentierte bereits 1822 der Historiker Isaak Markus Jost die Sachlage, womit er insbesondere die Situation der akademisch gebildeten Juden in Preußen beschrieb, „finden glatterdings keine Laufbahn, und nur die Taufe rettet sie für die Menschheit.“46 Jost wies damit auf die Tragik der jüdischen Bevölkerung hin, die sich zwar um Anpassung bemühe, der aber die Zugehörigkeit zur Umgebungsgesellschaft auf diesem Feld weiterhin offen verwehrt bleibe. Ohne den Taufakt könnten die Juden, das war die vermittelte Botschaft, die Rechte des Vollbürgers nicht in Anspruch nehmen.
Es ist einigermaßen aufschlussreich, dass zwischen 1812 und 1846 in Preußen insgesamt 3.770 Juden zum Protestantismus übergetreten sind, davon etwa ein Drittel in Berlin. Die Zahl sollte jedoch nicht überschätzt werden und fällt prozentual nicht sonderlich ins Gewicht. Anzunehmen ist, dass die meisten die Taufe nicht aus innerer Überzeugung annahmen, sondern um Karriere zu machen, sei es als Bankier, Kaufmann, Textilunternehmer – oder an der Universität als Hochschullehrer.47
Zwischen 1815 und 1847 gelang es nur einem einzigen Juden, eine Anstellung an einer preußischen Universität zu erhalten, ohne dass er gezwungen worden war, zuvor zum Christentum überzutreten. Der Ausnahmefall, um den es sich hierbei handelt, war David Ferdinand Koreff (1783–1851), ein heute weitgehend unbekannter Schriftsteller und Arzt. Wegen seiner Verdienste, die er sich als Leibarzt Hardenbergs erworben hatte, wurde er auf Betreiben Wilhelm von Humboldts zum Professor an der Berliner Universität ernannt. Aber auch er war letztlich, als seine Kollegen gegen ihn Stellung bezogen und ihm mit scheelen Blicken begegneten, gezwungen 1817 zum Christentum überzutreten.
Nach seiner Taufe nannte sich Koreff mit Vornamen nicht mehr David, sondern Johann[es]. Befreundet mit Rahel Varnhagen und E.T.A. Hoffmann, rechnet man ihn in Deutschland zum Kreis der Frühromantiker. Die erhoffte Anerkennung fand er jedoch nicht in Berlin, sondern in Paris, wo er seine späten Jahre verlebte.
David Ferdinand Koreff, so wissen wir, verkehrte dort in den Salons, machte die Bekanntschaft von Heinrich Heine und war ein gern gesehener Gast in den Abendgesellschaften um Stendhal, Mérimée, Musset und Delacroix. Man erblickte in ihm eine für die damalige Zeit seltene „Spezies“ – einen Juden, der unter dem Druck der Umgebungsgesellschaft zum Christentum übergetreten war und sich in der deutschen und in der französischen Kultur gleichermaßen zu Hause fühlte.
Auch Leopold Zunz, der als bedeutender Gelehrter über die Grenzen Berlins hinaus anerkannt war, gelang es nicht, eine Professur zu erhalten. Als er im Revolutionsjahr 1848 den Antrag stellte, an der Berliner Universität ein Ordinariat für die Wissenschaft des Judentums einzurichten, wurde das von Gutachtern der Philosophischen Fakultät (u.a. war auch der Historiker Leopold von Ranke mit im Gremium) abgelehnt.
Es bestünde, so argumentierte man, kein Anlass zur Einrichtung eines speziellen jüdischen Lehrstuhls. Leopold Zunz blieb weiterhin ein Privatgelehrter, verdiente sich seinen Unterhalt als Direktor des von ihm 1840 mitbegründeten Seminars für Jüdische Lehrer und war bemüht, sich im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten politisch zu betätigen.