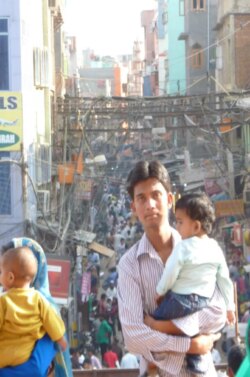Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 86
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Antinatalistische Zumutung und Antinatalisten-Abwehr
ОглавлениеWie jede Moraltheorie, gründet auch der Antinatalismus auf dem Prinzip der Universalisierbarkeit. Das heißt, wer den Antinatalismus vertritt, ist nicht bloß gehalten, zu sagen, es wäre besser gewesen, wenn andere niemals zu existieren begonnen hätten und sich nicht fortgepflanzt hätten. Sondern er muss unterschreiben: Es wäre besser gewesen, wenn auch ich selbst nie gelebt und mich fortgepflanzt hätte. Diesen Satz aber fasst so mancher als Bedrohung des eigenen Lebens und des Lebens der eigenen Nachkommen, Verwandten und Bekannten auf. Die antinatalistische Universalisierung verlangt von uns, über den Schatten der eigenen Existenz zu springen. Über den Schatten der eigenen Existenz zu springen, wird erleichtert, wenn wir uns anders ausdrücken: Statt zu sagen: (A) „Laut Antinatalismus wäre es besser, wenn X nie gelebt hätte“, können wir sagen: (B) „Laut Antinatalismus wäre es besser, wenn X niemals zu existieren begonnen hätte.“ In (A) scheint der Antinatalismus nach einem Lebensentzug (Tötung!) zu trachten; in (B) hingegen wird nur ein Ausbleiben des Existenzbeginns formuliert, von dem niemand direkt betroffen ist.
Da wir alle im „Licht der Welt“ angekommen sind, kann es uns dennoch schwerfallen, diesen Schatten der Existenz gedanklich zu überspringen. Sagt der Antinatalist dem Nicht-Antinatalisten: „Leid ist nur mit der Aufhebung menschlichen Daseins aufzuheben“, so mag der Nicht-Antinatalist dies als mannigfache Bedrohung verstehen:
1. „ICH, meine Nachkommen, Verwandten und Bekannten sollen nicht weiterexistieren, der Antinatalist trachtet uns nach dem Leben und verurteilt unser Fortleben.“
2. „Der Antinatalist befürwortet, dass wir nie das Licht der Welt erblickt hätten und für immer im Schatten des Nichtseins verblieben wären.“
3. „Indem der Antinatalist mein Niegewesensein befürwortet, plädiert er für mein Totgebliebensein – eine schreckliche Vorstellung, da mir all das entgangen wäre, was ich inzwischen erlebt habe.“
4. „Indem der Antinatalist mein Nichtsein gutheißt, plädiert er für meinen Tod.“
In Zuspitzung einer sonderbar missverstandenen antinatalistischen Zumutung kann es also dahin kommen, dass ein Tötungswunsch auf den Antinatalisten projiziert wird: Er wünsche, dass jeder Einzelne nie ins Dasein getreten wäre und damit dessen Nichtsein, das aber nunmehr gar nicht anders zu verwirklichen wäre, als vermittels der Tötung des Lebenden. In letzter Instanz müsse der Antinatalist die Tötung aller Lebenden wollen, weshalb ihm denn auch öfters leichthin ein Wille zur Vernichtung der Menschheit oder Menschenhass unterstellt wird. Eine heftige Form der Gegenwehr besteht dann darin, den Antinatalisten selbst als einzigen besser nie Geborenen zu brandmarken und ihm den Suizid als doch logische Konsequenz zu empfehlen. Damit wäre die vermeintlich vom Antinatalisten ausgehende Existenzbedrohung gebannt.
Der antinatalistischen Ethik zuzustimmen setzt voraus, in einem Rücklauf vor den Existenzbeginn von der eigenen Existenz ebenso Abstand nehmen zu können, wie von der Existenz Angehöriger und Bekannter. Eine der prononciertesten Abstandsnahmen von sich selbst findet sich vielleicht bei der österreichischen Dichterin Ilse Aichinger, die in einem Gespräch mit der Journalistin Julia Kospach bekanntgab, dass sie ihre „Existenz für vollkommen unnötig“ hält. (Aichinger, Es muss gar nichts bleiben, S. 202)