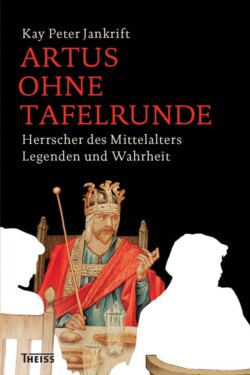Читать книгу Artus ohne Tafelrunde - Kay Peter Jankrift - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVORWORT
Gespenstisch ragen die Externsteine bei Horn aus dem Boden. Die unheimliche Faszination des Ortes hat die Menschen seit jeher in ihren Bann gezogen. Reich sind entsprechend die Mythen und Legenden, die sich um die bizarren Sandsteine ranken. Eine der bekanntesten Sagen verbindet sie mit Karl dem Großen und der Taufe des Sachsenherzogs Wittekind. Dieser zufolge leisteten einzig Wittekind und seine Getreuen den Franken noch Widerstand, als ihm eines Nachts der Teufel erschien. Er versprach Wittekind, ihm einen heidnischen Tempel zu bauen, „der so gewaltig sein solle, dass ihn der starke Karl wohl müsste stehen lassen.“1 Die Anhänger der alten Götter sollten sich an diesem Heiligtum versammeln. Auch viele, die sich unlängst zum christlichen Glauben bekehrt hatten, würden angesichts dieses Zeichens dem Christengott abschwören, versicherte der Höllenfürst. Für seinen Dienst müsse sich Wittekind lediglich verpflichten, dem heidnischen Glauben seiner Vorväter niemals zu entsagen. Erfreut nahm der Sachsenherzog das Angebot an, und der Teufel machte sich daran, sein Versprechen bis zur nächsten Vollmondnacht in die Tat umzusetzen. Durch den Teufelspakt wendete sich alsbald Wittekinds Waffenglück. Tag für Tag vermehrte sich zudem seine Anhängerschaft, so wie der Teufel es verheißen hatte. Derweil hatte sich der Höllenfürst an den Bau des Heiligtums gemacht. Aus allen Teilen der Welt schleppte er riesige Steinbrocken zusammen, die er zu himmelhohen Hallen auftürmte. Doch nicht nur der Teufel, auch Gott wirkte auf Wittekind ein. Nun erkannte der Sachsenherzog seinen Irrtum. „Eiligst ging er hin in des starken Karls Lager und ließ sich reumütig taufen.“ Als der Teufel davon erfuhr, riss er sein fast vollendetes Bauwerk wütend auseinander. Mit aller Gewalt schleuderte er die Felsen umher. Die Externsteine zeugen bis heute von dieser Begebenheit.
Gespannt habe ich als Viertklässler diese und andere Sagen um Karl den Großen und den Sachsenherzog Wittekind im Unterricht aufgesogen, von denen viele mit meinem heimatlichen Osnabrücker Land verbunden sind. Gleichsam greifbar werden dort die materiellen Überreste, die im Volksmund mit dem Wirken der beiden Herrscher in Verbindung gebracht werden. Etwa die sogenannten Karlssteine, ein Großsteingrab im Hone auf dem Weg nach Bramsche. Die mittleren Decksteine sind geborsten. Hier knüpft eine andere sagenhafte Version von der Bekehrung des Sachsenherzogs an. Nach dieser in mehreren Varianten überlieferten Sage schlug der fränkische Herrscher mit einer Pappelgerte auf die Opfersteine und sprach: „Gleich unmöglich ist es, diesen Stein und die harten Nacken der Sachsen zu brechen!“2 Der Stein zerbarst, Wittekind ließ sich taufen. Die Erzählungen machten mich neugierig, die Stätten aufzusuchen. An einem trüben Herbstsonntag besuchten meine Eltern mit ihrem wissbegierigen Sprössling die sogenannte „Wittekindsburg“ im Wald bei Rulle. Der Besuch war eine Enttäuschung. Ich hatte mir, wie wohl jeder Junge in diesem Alter, eine „richtige“ Burg mit Türmen und zinnenbewährten Mauern oder zumindest deren sichtbare Ruinen vorgestellt. Aber die Wittekindsburg reduzierte sich leider auf Erdwälle und Erhebungen im Boden, die für Laien als bauliche Überreste nur schwer erkennbar sind. Das war meine erste Begegnung mit der mittelalterlichen Geschichte. Ich war um eine Illusion ärmer und zugleich um eine Erfahrung reicher. Kurze Zeit später stieß ich auf Hal Fosters „Prinz Eisenherz“-Comics, in denen der junge Held mit der Pagenfrisur als Ritter der Tafelrunde des legendären Königs Artus atemberaubende Abenteuer erlebt. Mich faszinierte der Mut der einzelnen Streiter sowie der Zusammenhalt und die Ideale, die sie miteinander teilten. Dass Artus zu Beginn seines Auftretens in der Geschichte noch ganz ohne diese Runde dastand und erst im Verlauf des Mittelalters zu seinen Gefährten kam, ahnte ich zu dieser Zeit noch nicht. Doch die Legenden und besonders ihr historischer Kern begeistern mich seit dieser Zeit noch immer.
Dankbar war ich deswegen über die Anregung Stefan Brückners, für den Theiss Verlag ein Buch über legendäre Herrscher zu verfassen. Es bietet mir Gelegenheit, neben den Legenden um andere Herrscher auch den Karl meiner Kindheit noch einmal mit den Augen des erwachsenen Historikers zu betrachten. Mein Dank gebührt zudem Ricarda Berthold und Eva Hagen für ihr umsichtiges Lektorat sowie ihre Geduld mit dem Autor. Kein Buch kann wohl ohne den Zuspruch, die stete Ermunterung und das Verständnis der Familie entstehen, die den Autor für eine gewisse Zeit der Klausur vor seinem Computer überlassen muss. In diesem Sinne danke ich einmal mehr meiner Frau Isabelle sowie meinen Kindern Neele und Raphael. Gewidmet ist dieses Buch meinen Eltern Egon und Christa Jankrift – in Erinnerung an einen trüben Herbsttag in Rulle und eine unbeschwerte Kindheit.
Kay Peter Jankrift
Augsburg im Oktober 2007