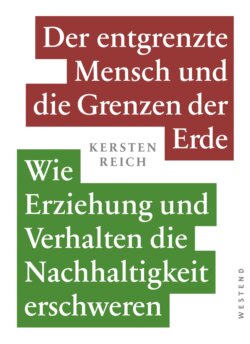Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kennzeichen der Moderne
ОглавлениеAngetrieben wird die Moderne vor allem durch den Kapitalismus, der sich in ihr in einer Industriegesellschaft durchsetzt, aber auch durch eine weitreichende Säkularisierung der Gesellschaft und eine begleitende Aufklärung in der Beobachtung und Konstruktion dieser Veränderung durch die Wissenschaften, die Künste und veränderte Lebenseinstellungen. Sehr einfach gesprochen bezeichnet der Begriff Moderne das eher Neuzeitliche, das auf eine Zukunft gerichtete Neue gegenüber einem Antiken oder Antiquierten, Traditionellen oder Konservativen, das aus feudalen und monarchischen Verhältnissen stammt, aber auch gegenüber einer religiösen Dogmatik und Enge. Der Begriff ist sehr vage, denn er umfasst eher eine Richtungszuschreibung oder Perspektive, weniger ein konkretes und schon gar kein vollständiges oder abgeschlossenes Ereignis. Dieses Vage und die Offenheit sehr unterschiedlicher Verwirklichungen entsprechen den Bedürfnissen des neuen Zeitalters und des Kapitalismus nach Ausweitung, um in alle Poren der Gesellschaft einzudringen und nach außen die ganze Welt zu erobern. Wie dies konkreter ökonomisch und politisch geschieht und welche Auswirkungen es auf die Nachhaltigkeit hat, das beschreibe ich näher im zweiten Band.
Die Moderne steht für eine Epoche und all ihre Ereignisse, auch für bestimmte Stilrichtungen etwa in der Kunst, Musik, Architektur oder im Film. Ich benutze den Begriff als ein Konzept der Philosophie und der Sozialwissenschaften, das aus einer Metaperspektive einen Blick auf große Veränderungen in den Lebensverhältnissen der neueren Zeit erlaubt. Dabei sind einige einschränkende Bemerkungen zu machen:
Die Bezeichnung Moderne drückt Veränderungen aus, die zunächst in den kapitalistischen Ursprungsländern in Europa stattgefunden haben und dann durch die globale Kapitalisierung immer mehr auch auf andere Kulturen mit ihren Perspektiven und Ansprüchen übertragen wurden. Seit dem späten 18. und mittleren 19. Jahrhundert – mit Bezügen zu vorausgegangen Prozessen – wird hierbei von einer Moderne gesprochen, die auch als ein Übergang von einem feudalen zu einem bürgerlichen Gesellschaftsmodell charakterisiert wird. Dies ist ein Übergang, der gleich exemplarisch mit Hobbes, Locke und Rousseau diskutiert werden soll.
Mit der Moderne entstehen neue Denkweisen, neue Begriffe und Herausforderungen eines Wandels. Dazu gehört auch die Nachhaltigkeit. Mit der Moderne setzt ein Zeitalter ein, das durch die Beschleunigung aller Produktions- und Lebensprozesse auch erhöhte Gefährdungen der Ökosysteme bedingt. Die theoretische Konstruktion der Moderne war solchen Veränderungen gegenüber jedoch zunächst durchgehend ignorant, sie entwickelte sich selbstbezüglich als reines Fortschrittsmodell und relativ selbstvergessen gegenüber den Auswirkungen auf die Umwelt und die Gefährdung von Menschen. Wenn der Wohlstand wächst, dann treten Fragen nach Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit für alle Menschen schnell in den Hintergrund.
Der Begriff der Moderne verweist zwar auf einen historischen Zeitraum, aber mehr noch versucht er, einen neuen Denkansatz in der Beschreibung von den Veränderungen, die stattgefunden haben, zu bieten. In der soziologischen Reflexion auf diese Veränderung drückt der Begriff der Modernisierung einen Wandel hin zu einer Industriegesellschaft, zur Kolonialisierung, Urbanisierung, Bürokratisierung, sozialen Differenzierung nach Arbeitsteilung und zunehmender Individualisierung aus, der auch eine Demokratisierung bedeuten kann und zunehmend globale Ausmaße annimmt. Insbesondere in der Kolonialisierung, der Unterwerfung anderer als unterentwickelt charakterisierter Kulturen, wurde in der Moderne ein Kriegszug gegen alle Völker und Ethnien durchgeführt, die nicht in das Bild des kapitalistischen Aufschwungs passten oder ihm bloß Arbeitskräfte zuliefern sollten.
Die Begriffe des Völkermordes, des Genozids oder des Ethnozids sind erst ab dem 19. Jahrhundert entwickelt worden, aber überliefert sind solche Taten seit der Antike. Was sich früher in Eroberungskriegen und einer rigiden Überlebensstrategie der Menschheit in zahlreichen Kriegen ausdrückte, zeigt sich mit dem Beginn der Moderne vor allem in der Kolonialisierung. Die Kolonialisierung durch europäische Mächte, etwa während der »Indianerkriege« oder der Eroberung Afrikas und weiter Teile Asiens, war durch Unterwerfung, Eroberung, rücksichtlose Auslöschung bestehender Kulturen und ihre umfassende Ausbeutung mittels Landaneignung und Versklavung geprägt. Besonders dramatisch in der Folge solcher Eroberungen war es, dass sich nach der späteren Entkolonialisierung im entstandenen Machtvakuum viele Ethnien aufgrund der zuvor künstlich errichteten Grenzen der Kolonialmächte ihrerseits bekämpften und Völkermorde untereinander anrichteten.
Nach Loo & Reijen (1997) ist die Moderne vor allem durch vier Prozesse gekennzeichnet, die sowohl den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt als auch die Nachhaltigkeit betreffen:
(1) Die Moderne domestiziert die innere und äußere Natur, indem moderne Gesellschaften durch Innovationen ständig neue natürliche Ressourcen erschließen, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt vorantreiben und, so will ich ergänzen, an die Grenzen der Ausbeutung des Planeten bringen. Zugleich differenziert sich die menschliche Arbeit, indem Qualifizierung, Spezialisierung und Disziplinierung der menschlichen Tätigkeiten zunehmen. Dies schließt eine widersprüchliche Bewegung ein: Einerseits entfaltet sich die menschliche Produktivkraft durch mehr und bessere Produkte, und die freie Entfaltung der Menschen nimmt zu, andererseits steigen die Anforderungen an Selbstdisziplin, Selbstkontrolle und die Disziplinierung der eigenen Selbstwirksamkeit an.
(2) Moderne Gesellschaften differenzieren die gesellschaftliche Struktur. In der Verwaltung der Kooperation und Kommunikation wachsen bürokratische Systeme. Sowohl die Arbeitsteilung innerhalb der Nationen als auch das Zusammenwirken unterschiedlicher nationaler Gesellschaften nehmen zu, was einerseits über Märkte und andererseits über internationale Beziehungen geregelt wird. Hierbei entstehen wachsende Widersprüche in der Ungleichverteilung zwischen Ländern und innerhalb der Länder zwischen Armen und Reichen.
(3) Prägend für moderne Gesellschaften ist eine Rationalisierung des Handelns, ein Kalkül nach Nutzen und Wirkung, das als vernünftig und antreibend erscheint. Nicht mehr vorwiegend Autorität nach Tradition oder Herrschaft, sondern nach wissenschaftlicher Einsicht und Vernunft scheint bestimmend zu sein. Aber auch dies ist widersprüchlich, denn der kapitalistische Markt bildet einen Referenzrahmen für alle Rationalisierungen und lässt keine Unabhängigkeit der Menschen, auch nicht der Wissenschaften in neutraler Position, zu.
(4) Schließlich steigt mit der Moderne die Individualisierung an, indem das Individuum aus den Traditionen und engen Verhältnissen persönlicher Abhängigkeiten und Zugehörigkeiten entlassen wird. Die Vergrößerung der Mobilität geht mit einer Erweiterung der Handlungsspielräume einher; Arbeitsmigration und Bildungsexpansion sind zwei wesentliche Erscheinungsformen hiervon, die allerdings ebenfalls die Risiken des Erfolgs oder des Scheiterns ins Individuum verlegen.
Die Vormoderne war sehr stark durch kollektive Bindungen und Handlungen geprägt. Allein auf sich gestellt war der Überlebenskampf zu gefährlich und konnte nicht hinreichend das Überleben sichern. In der Moderne konnte der Mensch eine Sorge um sich entwickeln, weil die Arbeitsteilung und die Verteilung des erarbeiten Überflusses dies ermöglichte. Diese Sorge hat sich in Denk- und Ordnungsvorstellungen niedergeschlagen, von denen ich nachfolgend diejenigen nennen werde, die mir für die Diskussion um Nachhaltigkeit zentral erscheinen. War es bis in die neuere Zeit vor allem die Religion, die hier Maßstäbe und Grenzen setzte, ist es seit der Aufklärung und dem Wirtschaftsliberalismus vor allem das politische und ökonomische Verständnis für das Verhalten und die Gewohnheiten von Menschen, das bis heute die Ideen und Konzepte über gelingende oder fehlende Nachhaltigkeit bestimmt. Mit Hobbes, Locke und Rousseau will ich nach einer kurzen Überlegung zum Verhältnis von Religion und Nachhaltigkeit diese Denk- und Vorstellungsräume diskutieren, von denen wir bis heute sehr viel stärker beeinflusst sind, als es den meisten Menschen bewusst ist.