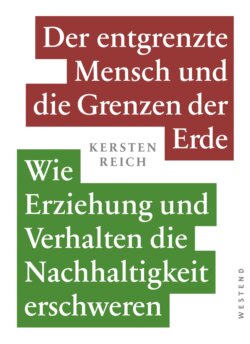Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.1Die Vergangenheit: Wege in die Nachhaltigkeitsfallen II.1.1Der Grundkonflikt der Sorge von Platon bis heute: Begierde & Begrenzung
ОглавлениеDie Menschen lebten von Anbeginn in einem Spannungsfeld, das sich zwischen eigenen Begierden und einer Begrenzung durch äußere Umstände aufspannte. Dieses Spannungsfeld will ich historisch in zwei exemplarischen Schritten auf das Thema Nachhaltigkeit beziehen, die jeweils wichtigen Etappen in der Theoriegeschichte der Sorgenbearbeitung entsprechen. Ich will die dabei gegangenen Schritte einleitend in Form von Fragen formulieren:
Wenn sich die menschliche Begierde durch dessen grenzenlose Eroberung und Ausbeutung von allem und jedem schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte zeigt, was hat der Mensch dann getan oder kann er tun, um seine Gier und Übertreibungen, die einen Großteil seiner Sorgen erzeugen, zu begrenzen?
Wenn der Mensch danach strebt, seinen Wohlstand stets zu vermehren, bedeutet dies dann zugleich, dass seine Bereitschaft steigt, sich für Nachhaltigkeit als Sicherung seiner Zukunft einzusetzen?
Bereits in der griechischen Antike vor über 2 300 Jahren oder im Konfuzianismus in China vor 2 500 Jahren finden wir eine erste sehr klare Antwort darauf, warum Menschen gern eigene Vorteile in den Vordergrund stellen und so einen Sinn für deren Folgen in der Gesellschaft und Umwelt schnell aus den Augen verlieren. Nicht nur, weil diese Vorstellungen sehr alt sind, sondern vor allem auch, weil sie immer wieder in der menschlichen Geschichte wiederkehren, will ich zunächst näher auf die Antike eingehen. Dieser Widerspruch hat an Brisanz bis heute nichts eingebüßt, konnte er doch bisher nicht befriedigend aufgelöst werden – trotz wiederkehrender gegenteiliger Bekenntnisse und Hoffnungen in der Theorie. Hier setzen bereits wichtige Diagnosen und Reflexionen zu diesem überdauernden Widerspruch ein, die bis heute lehrreich sind und uns nachdenklich machen können.
Der Wille zur Macht, das machtvolle Durchsetzen eigener Interessen in der Natur und Umwelt, die kriegerische Verteidigung des eigenen Lebens und die Eroberung neuer Lebensräume, dies prägte die Geschichte der Menschheit bisher. Die griechische Antike war hierbei eine der frühen Blütezeiten der menschlichen Kultur, in der, ähnlich wie im Konfuzianismus in China (zu den konfuzianischen Weltvorstellungen vgl. etwa Reich & Wei 1997), der Mensch sein Verhalten und die Nachhaltigkeit seiner Handlungen bereits umfassend beurteilte und bewertete.
Wegen der immensen wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen denken viele Menschen heute, große Fortschritte in den letzten zweieinhalb tausend Jahren gemacht zu haben. Der materielle Fortschritt bestätigt dies. Aber gilt dies auch für das menschliche Verhalten? Die nachfolgenden Überlegungen zur Antike sollen dies erörtern.
In Platons Dialogen, insbesondere in der Politeia, entwirft der platonische Sokrates ein Bild der menschlichen Seele, aus deren Formung und Erziehung so etwas wie ein gerechter Staat, Weisheit, Künste und Wissenschaften erwachsen könnten (vgl. ausführlich Jaeger 1934, Bd. 2, 270 ff.). Dazu bedarf der Mensch einer umfassenden Erziehung. Diese Paideia, von der Jaeger spricht, lohnt es immer wieder zu studieren, wenn das Verhältnis von Individualität und Nachhaltigkeit als Schlüsselkonzept der Menschheit begriffen werden soll. Rousseau, auf den ich später noch zu sprechen komme, schrieb in der Einleitung zu seinem Erziehungsroman Emile deshalb zutreffend, dass die Politeia die schönste Abhandlung über Erziehung und die Bestimmung des Menschen sei, die jemals geschrieben worden ist. Werfen wir einen kurzen Blick hinein.
Die Politeia stellt und beantwortet grundsätzliche Fragen zur Erziehung des Menschen, was notwendig für eine gute Erziehung wäre und wann diese grundsätzlich scheitern muss. Dabei wirft sie im Dialog unterschiedlicher Positionen der Athener Eliten immer wieder die Frage auf, wozu erzogen werden soll. Ist es der materielle Vorteil der Individuen oder gibt es einen höheren Sinn in den Zugehörigkeiten und Verpflichtungen auf ein menschliches Leben, das nachhaltig Wohlstand und Zufriedenheit für alle sichern soll?
Ganz ähnlich ist es bei Konfuzius. Seine Schüler entwerfen dabei sogar die Auffassungen, dass der Mensch als von Natur aus gut oder böse dargestellt werden kann und es in beiden Fällen gelingen mag, dass Fortschritte und Wohlstand ermöglicht werden, wenn der Mensch in eine Balance gegenüber seinen Antrieben und Wünschen und den Sitten und Notwendigkeiten der Ordnung des Staates gebracht werden kann.
Es sind seither wiederkehrende Vorstellungen von einem Streben nach Wohlstand, Glückseligkeit und Zufriedenheit der Menschen auf der einen Seite und einer Suche nach gerechten, den Egoismus überwindenden, Elend und Hunger vermeidenden menschlichen Handlungen und Staatsformen auf der anderen, die Platon in den Aussagen Sokrates’ und Konfuzius’ in ein über Jahrhunderte wirksames Beamtentum im Kaiserreich theoretisch niederlegten. Ich bitte Sie im Folgenden zu beurteilen, ob diese Ideen sich von jenen unterscheiden, die wir uns heute machen. Insbesondere das Spannungsverhältnis von gerechtem Handeln und Individualität, das bis heute aktuell geblieben ist, stand im Mittelpunkt des Interesses der antiken Ideengeber. Wie entstand diese Frage nach Gerechtigkeit?
In den früher Hochkulturen hatte bereits eine Individualisierung der menschlichen Tätigkeiten stattgefunden, die das gesamte Leben veränderte und mehr Teilhabe der Menschen jenseits bloßer Überlebenskämpfe bei einer noch relativ geringen Arbeitsteilung, aber auch einem ersten Überfluss an Produkten zum Leben ermöglichte. Dies war in der Antike auch die Geburtsstunde demokratischer Ideen und bei den Sophisten zugleich diejenige einer Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, die seither in der Menschheitsgeschichte immer wieder eine große Rolle spielt. Die natürlich scheinende Macht des Stärkeren steht im Gegensatz zu dem rationalen Gesetz einer kulturellen Herrschaft, das Menschen sich gegenseitig im Zusammenleben versichern. Die Menschen wollten, als ihr eigener materieller Wohlstand anwuchs, gerecht behandelt werden. So sollte die Autorität der staatlichen und sozialen Führung, die für Kriege, Kolonialisierungen, Versklavungen als Reichtum der Gesellschaft verantwortlich war, auch stärker auf die wachsenden individuellen Bedürfnisse der Menschen Rücksicht nehmen. Zwar finden sich neben der Unterscheidung von Natur und Kultur (vgl. weiterführend auch Descola 2013) die Begriffe Autorität und Individualität in der heute bekannten Form hier noch nicht, aber es gibt Beschreibungen, die ihnen ähnlich sind; dies gilt auch für die Nachhaltigkeit des Handelns.
Schauen wir uns einige solcher Beschreibungen an. Wenn es um Fragen der Autorität und möglicher Individualität, dabei auch der Nachhaltigkeit des Handelns für die Zukunft geht, dann entstehen immer Fragen der Verantwortung. Wer ist für ein nachhaltiges Streben verantwortlich?
In Platons Politeia findet sich ein Dialog des Sokrates mit Glaukon und Adeimantos, zwei Vertretern der jungen Elite Athens, der die uralte Herkunft des Spannungsverhältnisses von Autorität und Individualität beschreiben helfen kann. Wenn die Individuen stets nur nach ihrem eigenen Vorteil streben, wer soll dann für Nachhaltigkeit einstehen? Die Antwort heißt: Es muss eine Autorität sein. Aber welche?
Autorität meint in der Antike sowohl die väterliche wie die staatliche Autorität, die hier als Überlieferung, als Tradition und Festhalten am Bewährten für einen guten Weg, vor allem aber für einen gerechten Weg steht.