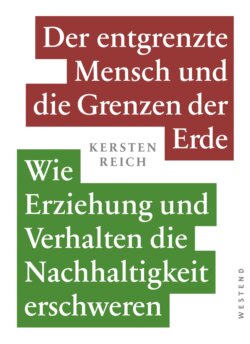Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ressourcen und Böden
ОглавлениеIn der Biosphäre gibt es viele erneuerbare Ressourcen, und so ist es ein oberstes Ziel nachhaltigen Wirtschaftens, diese zu nutzen und gleichzeitig in ihrer Potenz zu schützen. Dieses Ziel erzeugt höhere Kosten als eine Nutzung, der es nicht auf den Erhalt der Qualität der Ressourcen ankommt, sondern nur um kurzfristige Gewinne geht. Auch die Konsumenten sind Teil dieses Kampfes, der heute insbesondere zwischen Bio-Lebensmitteln und Billigware ausgefochten wird. Auch wenn die natürliche Reproduktion und die Evolution ein schier unendliches Reservoir an biologischer Erneuerung bietet, so können auch erneuerbare Ressourcen degradieren, an Qualität verlieren, überdüngt werden und den Phosphorkreislauf negativ bestimmen, sie können mit Schadstoffen angereichert werden, ausgelaugte Böden oder abgeholzte Wälder hinterlassen.
Schlecht steht es um die nicht-erneuerbaren Ressourcen. Sie werden derzeit von Menschen ohne Rücksicht auf kommende Generationen massenhaft verbraucht. Bekannt sind aus den organischen Rohstoffen die fossilen Brennstoffe wie Kohle, Erdöl oder Gas, die seit der Industrialisierung verbraucht werden und zum Treibhauseffekt führen. Aber es gibt mittlerweile lange Listen von Mineralien und Stoffen aller Art, die nur in sehr langen Zeiträumen, wenn überhaupt, regenerieren. Was hier verbraucht wird, das steht später nicht mehr zur Verfügung.
Die weltweite Ernährung von Milliarden Menschen wird derzeit mit einer Agrarindustrie bewältigt, die ihrerseits nicht unproblematisch für die Nachhaltigkeit ist. Ein Grundparadox der kapitalistischen Produktion ist hierbei, dass 70 Prozent der weltweit hungernden Menschen dort leben, wo Nahrungsmittel produziert werden. Trotz Überproduktion ist es bisher nicht gelungen, diese Menschen vom Hunger zu befreien. Sie dienen vielmehr überwiegend als billige Arbeitskräfte, um den Profit weniger Menschen zu erhöhen. Dabei sollen eine zunehmende Mechanisierung, der Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln, auch von genetisch manipuliertem Saatgut, helfen, die Erträge weiter zu steigern. Eine langanhaltende Bodenfruchtbarkeit, die Reinheit des Wassers und ein Erhalt der Artenvielfalt bleiben so auf der Strecke. Sehen wir auf die Getreideproduktion der Welt, so wird mehr als die Hälfte verfüttert, verheizt und immer mehr zu Treibstoff verarbeitet, wobei stets die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Mit Saatgut werden zwar Gewinne gemacht, allerdings oft auf Kosten der regional geeigneten Produkte, da die angebotenen Produkte für die heimischen Bedingungen (Böden, Schädlinge) nicht ausgelegt sind und so weitere Kosten für Dünger und Schutzmaßnahmen erzwingen. Daraus entstehen Abhängigkeiten, die von der Agrarindustrie als Gewinnstrategie umfassend bedient werden.
In den Industrieländern wird pro Kopf deutlich mehr als in den ärmeren Ländern verbraucht. Während die reicheren Länder vor allem an der Wertschöpfung aus den weltweiten Rohstoffen beteiligt sind, müssen die weniger entwickelten Länder überproportional die ökologischen und sozialen Wirkungen der Rohstoffgewinnung, regionaler Verknappung und teurer Preise ertragen.
Die Überproduktion der reichen Länder fließt in großen Teilen in die armen Weltregionen zurück, um dort zu Niedrigpreisen vermarktet zu werden. Dies vernichtet die lokalen Märkte, die damit nicht konkurrieren können. Die Scheinheiligkeit der reichen Länder ist offensichtlich. Wenn die Bauern in der EU etwa Überproduktion durch eine sehr intensive Agrarwirtschaft erzeugen, weil sie mehr Waren als benötigt produzieren und dabei auch noch subventioniert werden, dann exportiert die EU ihre Überschüsse in arme Länder. Dort zerstören diese Waren die lokalen Märkte. Aus dem Überfluss der einen entsteht der Hunger der anderen. Dies ist die kapitalistische Logik: Du musst etwas verkaufen, um selbst etwas kaufen zu können. Tritt ein Anbieter von außen ein, der billiger als du produzierst, dann mag dies kurzfristig vielen Käufern dienen, aber es untergräbt auf der anderen Seite die eigene Wirtschaftsweise und die regionale Nachhaltigkeit.
Die Agrarproduktion ist immer unmittelbar mit der Natur vernetzt und hat Folgen für die Biodiversität, das Klima, den Erhalt oder die Vernichtung natürlicher Ressourcen. Zugleich existiert ein neoliberal geprägter Markt im Kapitalismus, der nicht nach Vernunft-, sondern nach Gewinnprinzipien reguliert wird. Für die reichen Länder ist deutlich geworden, dass sie nicht nur die Produktionsmengen senken müssten, die Bezahlung in der Landwirtschaft gerechter gestalten sollten, insgesamt eine Regulierung für mehr Nachhaltigkeit zu leisten hätten. Dies wird die Preise erhöhen. Zugleich müssten die Konsumenten sich auf einen nachhaltigen Konsum stärker regionaler Nahrung, ökologischer Bewirtschaftung und weniger Fleischkonsum einstellen, um eine solche Entwicklung von der Nachfrageseite her zu unterstützen. Der neoliberale Weg der ständigen Wachstumsförderung führt die Agrarwirtschaft zwangsläufig in die Überproduktion und dann in Subventionen und eine Weltmarktorientierung, die der globalen Welt mehr schadet als nutzt. Gleichzeitig erzeugt sie eine hohe Nitratbelastung und andere Schädigungen, insbesondere durch Pflanzenschutzmittel und ein damit zusätzlich beschleunigtes Artensterben, sie gefährdet zudem die Gesundheit von Menschen.
Mit der Bevölkerungsdichte gehen bei steigendem Konsum ein enormer Ressourcenverbrauch und eine Verkleinerung verfügbarer Flächen einher. In der Agrarproduktion gilt das Ideal der natürlich nachwachsenden Ressourcen, bei den Rohstoffen wie Öl, Metallen, seltenen Erden und vielen anderen mehr muss eher von Ressourcenverbrauch und -vernichtung gesprochen werden. Natürliche Ressourcen sind sowohl materielle als auch energetische und räumliche Ressourcen des menschlichen Lebensstandards. Eine Inanspruchnahme solcher Ressourcen hat immer Folgen für die Umwelt und belastet diese. Insbesondere der Verbrauch nicht-regenerativer Ressourcen ist mit schädlichen Eingriffen in den Natur- und Wasserhaushalt verbunden, erfolgt meistens energieintensiv, führt zu Schadstoffen in Luft, Wasser und Böden.
Jede Produktion hat eine Ökobilanz, auch regenerative Energien oder die sogenannte E-Mobilität sind davon nicht frei. Dabei machen kleine und große Produktionsmengen einen wesentlichen Unterschied aus. Wird beispielsweise vom Diesel- oder Benziner-Motor auf das Elektroauto massenhaft umgestellt, dann könnten die Folgen des Ressourcenverbrauchs für Batterien und deren Entsorgung zu in der Größe heute kaum berechenbaren neuen Risikofaktoren für Böden, Energiegewinnung, Wasserverunreinigungen und Ressourcenvernichtung bestimmter seltener Rohstoffe werden. Die Autoindustrie will nur verkaufen, sie macht sich keine Gedanken um Nachhaltigkeit. So wie sie schon mit Schummelsoftware den Diesel schönrechnete, so wird dies mit dem Elektroauto fortgesetzt werden. Denn die Ökobilanz des E-Autos mag zwar für die Luft günstiger sein, aber für den Ressourcenverbrauch und den erzeugten Müll gibt es noch keine hinreichend nachhaltigen Lösungen.
Die Verschmutzung des Wassers und die Abnutzung der Böden sind graduelle Prozesse, die über einen längeren Zeitraum entstehen. Sowohl Industrie- als auch Agrarproduktion tragen hierzu ebenso bei wie die privaten Haushalte. Es ist die Summe aller menschlichen Handlungen, die das Schmelzen des Eises, das Auftauen des Permafrostes, die Zunahme der Treibhausgase und andere Ereignisse bewirken, die fast nie sofort spürbar sind, aber in der Langzeitwirkung Kipp-Punkte erzeugen oder schon erzeugt haben, die irreversibel die Zukunft verändern werden.
Besonders wichtig ist als Mittel einer Gegensteuerung der Erhalt der vielfältigen Natur. Der Amazonas-Regenwald steht hierfür als ein Symbol, an dem studiert werden kann, wie menschliche Gier, globalisierte Märkte und die Machtlosigkeit der UN zusammenwirken, die zwar das Waldsterben beklagen, aber kaum etwas dagegen unternehmen zu können scheinen. Wir reden hier auch nur von einer Abwehr des Sterbens. Um positive Effekte zu erzielen, müsste die Menschheit ein riesiges Aufforstungsprogramm starten, weil allein so eine Regeneration mit wirksamem CO2-Abbau erreicht werden könnte.
Die menschliche Lebensweise hat nicht nur die Natur in Landwirtschaften verwandelt und dadurch Flächen versiegelt, auch die Bebauung zum Wohnen, zur Produktion und für den Konsum und Verkehr hat eine steigende Bodenversiegelung hervorgebracht. Weltweit schrumpfen kontinuierlich die Flächen, die noch nicht versiegelt sind. In Deutschland sind die Böden der Siedlungs- und Verkehrsflächen circa zu 50 Prozent versiegelt. Bezogen auf die Gesamtfläche von berechneten 15 Bundesländern beträgt der Anteil dieser Siedlungs- und Verkehrsfläche bereits 13,6 Prozent (Umweltbundesamt 2020). Weltweit sind insbesondere die Megacitys durch Versiegelung betroffen; vor allem Verkehrsflächen nehmen einen hohen Anteil versiegelter Fläche ein. Es werden also nicht nur die Ressourcen an Rohstoffen knapp, auch die vorhandenen Flächen schrumpfen. Ohnehin sind viele Flächen in Privatbesitz, die Erde ist bereits umfassend verteilt.
Als politische Gegenmaßnahme sollen in Deutschland Ökopunkte in einer Art modernen Ablasshandel die Geschwindigkeit, mit der diese Versiegelung zunimmt – zurzeit liegt sie bei 60 Hektar pro Tag – drosseln (zur Öko-Punkte-Lüge vgl. Report Mainz 2019). Ziel sind 30 Hektar bis 2030. Die Zunahme an Bebauungen in städtischen Bereichen kann durch Ökopunkte ausgeglichen werden. Wenn etwa ein Acker in eine Wiese umgewandelt wird, dann gibt es dafür Punkte. Diese Punkte können weiterverkauft werden, so an eine Kommune oder eine Baufirma. Wenn es für ein Vorhaben keine gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsflächen mehr gibt, dann können auch entfernte Flächen gekauft und in Punkte umgewandelt werden. Bei den Ökopunkten schlägt die Qualität der Umwandlung in etwas ökologische Sinnvolles sich in der Höhe der Punkte nieder. Eine Fischtreppe etwa gilt als wesentlich besser als eine Wiese, deshalb gibt es mehr Punkte. Mit nur einer Treppe, so kritisieren Umweltschützer, lassen sich mehrere Baugebiete ausgleichen. Die Wunschvorstellung eines Ausgleichs durch Formalisierung versucht hier eine Art Gleichheit im Wettbewerb herzustellen, der in der Bepreisung eher willkürlich als durchdacht ist. Die Regulierung im kleinen Maßstab führt in immer weitere unübersichtliche Teilmaßnahmen, die wie ein Flickenteppich der Nachhaltigkeit aussehen, ohne dass ein wirksames Gesamtbild erscheint und für die Menschen transparent wird.