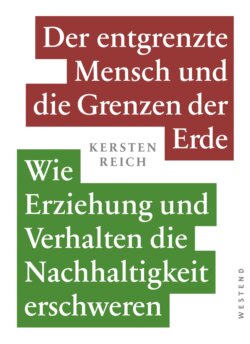Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frischwasser und Meeresspiegel
ОглавлениеDer Meeresspiegel ist in den letzten 100 Jahren bereits um 19 Zentimeter gestiegen. Ursache sind schmelzende Gebirgsgletscher und die thermische Ausdehnung des sich erwärmenden Meerwassers. Zwischen 1993 und 2017 erfolgte ein mittlerer Anstieg um 0,85 Zentimeter, allerdings ist zu beachten, dass regionale Unterschiede sehr groß ausfallen. Levermann et al. (2020) warnen, dass dieser Anstieg sich vervielfachen könnte. Als entscheidende Faktoren werden in verschiedenen Studien dabei die großen gebundenen Eisflächen in der Arktis und besonders der Antarktis angesehen. Je länger die Klimaerwärmung voranschreitet, umso dramatischer werden die Effekte. Die Forschungsgruppe vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat eine große Schwankungsbreite in Abhängigkeit vom Treibhausgasausstoß berechnet. Bis Ende des Jahrhunderts kann wahrscheinlich mit einem Anstieg zwischen 6 und 58 Zentimetern gerechnet werden. Könnten Emissionen rasch vermindert werden, dann liegt die Spanne immer noch zwischen 4 und 37 Zentimetern. Der Zuwachs wäre verglichen mit den letzten 100 Jahren erheblich und für Küstenregionen bedrohlich. Werden alle Faktoren zusammenfassend berücksichtigt, also die Ausdehnung der Meere durch Erwärmung, das Abschmelzen des Grönlandeises und der Hochgebirgsgletscher und des antarktischen Eisschildes, dann ist nach Berechnungen der Forschungsgruppe durchaus auch bei unverminderten Treibhauseffekten mit einem Anstieg von 1,5 Metern bis zum Ende des Jahrhunderts zu rechnen.
Insbesondere die kaum abzuschätzenden Wirkungen der Antarktisschmelze machen genaue Prognosen schwierig. Zudem sind alle Berechnungen noch mit weiteren Unbekannten versehen, denn das Abschmelzen der Tundra und das Freisetzen von Gasen können den Treibhauseffekt noch weiter beschleunigen.
Im ökologischen Fußabdruck wird der Frischwasserverbrauch nicht betrachtet. Das Wasser wird als eine biologisch neutrale Umlaufgröße betrachtet, da es scheinbar weder erzeugt noch verbraucht wird. Dies gilt auch für das Artensterben, das gleich noch charakterisiert werden soll. Aber Wasser ist ein Lebenselement, das alle bisherigen und die noch folgenden Gesichtspunkte durchdringt, mit ihnen verbunden ist und auch zu den planetarischen Grenzen gerechnet werden muss. Zunächst ist das Meereswasser und sind die vielen Seen auf der Erde, die 70 Prozent der Erdoberfläche bedecken, ein gigantischer CO2-Speicher. Etwa 38 000 Gigatonnen CO2 sind in den Meeren gespeichert. Bei steigenden Temperaturen – das ist eine der zusätzlichen Fallen der Erderwärmung – lässt diese Speicherkraft allerdings nach. Um das Wasser als Lebenselement nachhaltig zu schützen, gelten zunächst die Klimaziele auch hier, weil die Erwärmung des Wassers insbesondere für das Leben im Wasser eine Bedrohung ist. Der Überschuss an CO2 in der Atmosphäre führt dazu, dass der PH-Wert des Wassers zunehmend sinkt. Durch die Aufnahme von CO2 tritt neben dem Treibhauseffekt, der die Temperaturen weltweit steigen lässt, ein zweiter Effekt auf, der äußerst nachteilig ist. Die Meere versauern (siehe OA-ICC 2020). Dies erschwert kalkskelettbildenden Lebewesen die Produktion ihrer Skelette, und weil diese Lebewesen die Basis für weitere Nahrungsketten bilden, entstehen Ketteneffekte, die bis hin zur menschlichen Nahrungsgewinnung reichen. Wenn der PH-Wert sinkt, dann ist dies alarmierend. »Wie der Richterwert der Erdbebenskala ist der PH-Wert logarithmisch, so dass bereits eine sehr schmal erscheinende Differenz eine sehr große Veränderung in der realen Welt bedeutet.« (Kolbert 2015, 114) Die Korallenbleiche und das Aussterben vieler Arten sind hierfür ein Beleg.
Dramatisch ist insbesondere die Potenz der Veränderung, die eigene Kipp-Punkte in der Qualität des Wassers und im Artensterben entfalten wird. In bestimmten Meeresregionen ist dies schon offensichtlich und messbar geworden.
Die zunehmende Verschmutzung des Wassers ist ohnehin eine globale Herausforderung. Der Plastikmüll, der vom Land ins Meer dringt, hat ungeheure Ausmaße angenommen. Für 2025 wird geschätzt, dass pro drei Tonnen Fischen im Ozean bereits eine Tonne Müll existiert, 2050 gäbe es dann mehr Plastik als Fische (vgl. Ellen Macarthur 2016). Vor allem durch Überdüngung nimmt die Nährstoffbelastung der Gewässer und Meere weltweit zu. Dies führt nicht nur zu unangenehmen Effekten wie riesigen Algenteppichen, sondern auch zu einem Absinken der Biodiversität. Die Übersauerung des Wassers steht mit den hohen CO2-Werten im Zusammenhang; sie schädigt die Qualität des Wassers und damit des Lebens im Wasser wie der Ernährung durch Wasser. Zudem ist sauberes Trinkwasser auf der Welt nicht nur ungleich verteilt, es ist auch zunehmend schwerer herstellbar und wird dadurch teurer. Industrielle Produktion wie Agrarproduktion verschlingen Unmengen an Wasser, die anderen Kreisläufen entzogen werden. Besonders in wasserarmen Ländern gibt es eine Unterversorgung mit Trinkwasser.
Wasser und Müll bilden eine Einheit, da lösliche wie nicht lösliche Stoffe, insbesondere Plastik, im Wasserkreislauf landen. Deshalb ist der Schutz von möglichst reinem Wasser ein hohes Ziel, mit dem die Menschheit bisher sehr sorglos umgeht. Allein für das Trinkwasser wird in der Regel bezahlt, dessen Verschmutzung hingegen kostet bisher im Grunde nichts.