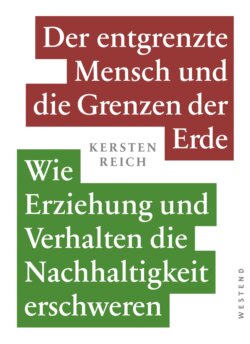Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Klimawandel
ОглавлениеErst 1972 hat der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten aus damals mehr als 30 Ländern, die Studie Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Die Schlussfolgerung der Studie lautete: »Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.« (Meadows u. a. 1972, 23) Das Buch wurde von rechts wie links in der Kritik zerrissen, weil es die Dimensionen des positiven Wachstums für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse nicht hinreichend aufgenommen hätte und von einem vermeintlich dubiosen elitären Kreis erstellt worden wäre. Auch die Entwicklungsländer beklagten, dass der »ökologische Knappheitsdiskurs« verhindere, dass sie am Reichtum der Welt in Zukunft hinreichend partizipieren können. Damit sind die wichtigsten Abwehrhaltungen bis heute bereits früh benannt worden. Ganz gleich welche wissenschaftlichen Standards erfüllt werden, um den Klimawandel genauer zu beschreiben, die Gegner halten an ihren Wunschbildern einer Welt im Wachstum und ihrem Traum, auf nichts verzichten zu wollen, fest. Inwieweit die Sorge um sich, die Ökonomie, die Politik, Wissenschaften und Erziehung zu solchen Wunschbildern beitragen, das werde ich in späteren Kapiteln dieses Buches genauer analysieren.
Immerhin setzte sich der Begriff der »Grenzen des Wachstums« durch, auch wenn die größeren Ressourcenverschwendungen und Umweltsünden seither zu- und nicht abgenommen haben. Zumindest ist durch die starke Medienverbreitung und die Übersetzung in viele Sprachen aber bewusst geworden, dass es ein Problem fehlender Nachhaltigkeit gibt. Problem bemerkt, aber wie dringend ist es denn wirklich?
In dem berühmt gewordenen Beispiel des Lilienteiches wird in dem Bericht des Club of Rome auch schon die Problematik von Kipp-Punkten benannt, die heute immer wieder für die Klimaveränderungen angeführt wird. »Angenommen, du besitzt einen Teich, auf dem eine Seerose wächst. Die Lilienpflanze verdoppelt ihre Größe täglich. Wenn die Lilie ungehindert wachsen könnte, würde sie den Teich in 30 Tagen vollständig bedecken und die anderen Formen des Lebens im Wasser ersticken. Lange Zeit wirkt die Lilienpflanze klein, und bis sie die Hälfte des Teiches bedeckt, entscheidest du dich, dir keine Sorgen zu machen, und schneidest sie nicht zurück. An welchem Tag wird sie den halben Teich bedecken? Am neunundzwanzigsten Tag, natürlich. Du hast einen Tag Zeit, um deinen Teich zu retten.« (Ebd., 29)
Worum geht es? Was Menschen immer leicht fällt, ist, die positiven Effekte des Wachstums nachzuvollziehen. Dies gilt dann, wenn der Konsum steigt, sich der Lebensstandard verbessert, das Auto größer und besser wird, die Reisen in immer fernere Länder möglich sind, die eigene Immobilie ihren Wert immer weiter steigert. Bei den negativen fällt uns dies nicht so leicht. Hier neigen Menschen dazu, immer noch Bedingungen und Veränderungen anzuführen, die einen negativen Trend stoppen oder in letzter Minute umkehren können, und es kann so leicht geschehen, dass genau der Tag verpasst wird, der noch für eine Umkehr nötig gewesen wäre. Offensichtlich ist dies für die Klimakrise, die wir mit Zielen von 1,5 oder 2 Grad zulässiger Temperaturerhöhung gegenüber der vorindustriellen Zeit im Augenblick lösen wollen, obwohl die Lösung derzeit so aussieht, dass nur die Verfehlung des Zieles gewiss zu sein scheint. 2019 hat Deutschland bereits die 1,5 Grad erreicht, der Weltdurchschnitt liegt bei 1 Grad (vgl. Monitoringbericht 2019). Ein Projektionsbericht zeigt, an wie vielen Stellen Ziele bereits verfehlt werden (vgl. Projektionsbericht 2019). Aber was bedeuten diese Zahlen? 2 oder 3 oder 4 Grad scheinen nach herkömmlichen Temperaturerfahrungen, subjektiv betrachtet, keinen großen Unterschied zu machen. Aber es geht um kein konkret im Einzelfall messbares Ereignis, sondern um Durchschnittstemperaturen einer langen und stetigen Kette von Messungen, die auf lange Sicht einen gewaltigen Unterschied machen. Das schmelzende Eis ist dafür ein sehr klarer Beleg. Und es ist ein Kipp-Punkt, denn was einmal geschmolzen ist, kommt bei steigenden Durchschnittstemperaturen nicht zurück. Und vertrocknete Böden, die nach und nach zu Wüsten werden, lassen sich nicht einfach in sattes Grün zurückverwandeln. Es dauert Jahre, im Bild des Lilienteiches die Tage 1 bis 29, bevor dramatische Klimaereignisse einsetzen, die ein jeder Mensch deutlich für sich zu spüren bekommen wird. Für viele ist deshalb der 30. Tag offenbar noch in weiter Ferne.
Auch wenn einzelne Ergebnisse der Studie von 1972 heute präziser beschrieben werden können, auch wenn viele neue Bereiche hinzugekommen sind, so hat sich die Tendenz der Aussage bestätigt und verschärft. Wenn wir weitermachen wie bisher, wenn aufstrebende Länder in den gleichen Konsum wie die reicheren eintreten, dann ist der 30. Tag sehr lange vor 2100 erreicht, was vor einigen Jahren noch die Annahme war. Zwar behaupten insbesondere Industrie und Politik, indem sie an den alten ungebremsten Wachstumsvorstellungen festhalten, dass vor allem die wissenschaftlich-technologische Entwicklung und die Abnahme des Bevölkerungswachstums – zwar noch nicht in absoluten Zahlen, aber immerhin in einer geringeren Wachstumsrate – den letzten Tag umfassender Handlungsfähigkeit noch nach hinten verschieben lassen, aber im Grunde wissen alle, die sich wissenschaftlich informieren, dass die Menschheit schon heute nachhaltiger mit der Erde und sich selbst umgehen muss. Allerdings trösten sich sehr viele damit, dass ja gar nicht ganz exakt zu bestimmen scheint, was denn umfassende Handlungsfähigkeit am letzten Tag überhaupt bedeutet. Nach der Krise scheint vor der Krise zu sein. Und wenn es auch Kipp-Punkte geben mag, es wird schon nicht alles untergehen. Aber reicht unser Wissen dafür aus, um dies zu behaupten?
Der menschengemachte Klimawandel wird von etlichen Menschen sogar grundsätzlich bestritten. Das Hauptargument lautet dann meistens, dass es Klimaschwankungen schon immer gegeben habe. Das stimmt. Aber die daraus gefolgerte Ableitung, dass es um rein natürliche Schwankungen gehe, ist schlichtweg falsch. Raphael Neukom und andere (2019) schreiben in Nature, dass es wissenschaftlich gesehen einen wesentlichen Unterschied zwischen früheren Kalt- und Warmzeiten und der gegenwärtigen Erwärmung gibt. Früher waren die Veränderungen eher regional, und sie traten zu unterschiedlichen Zeiten auf. Heute sind sie global, und sie treten zeitgleich auf. In ihrer Studie, die das Land und das Meer abdeckt, wurden die Klimadaten der internationalen Forschungsgruppe Past Global Changes ausgewertet. Quellen dieser Studien sind neben vorhandenen Messdaten auch Jahresringe von Bäumen, Eisbohrkerne und See-Sedimente, Veränderungen an Korallen und anderes mehr. Alle Studien sind sich einig. Als entscheidend für die Erderwärmung wurde vor allem das Treibhausgas CO2 ausgemacht. Es kann aus der Atmosphäre von der Vegetation aufgenommen werden, es gibt mehrere Kreisläufe, wie es entstehen und verarbeitet werden kann, ohne exponentiell zuzunehmen. Aber die gegenwärtige Erwärmung zeigt, dass der regenerative Kreislauf vom Menschen durch die Zunahme von Treibhausgasen unterbrochen wurde. Der Treibhauseffekt hat längst eingesetzt und wirkt sich von Tag zu Tag stärker aus. Seit Beginn der industriellen Revolution haben wir es mit einer durchgehenden und immer kräftiger werdenden Erwärmung zu tun, die immer schneller und kontinuierlich steigend abläuft.
Das wichtigste Treibhausgas ist Kohlendioxid (CO2). Das menschengemachte CO2 entsteht hauptsächlich durch das Verbrennen fossiler Energien. Der Fleischverzehr trägt aufgrund seiner massenhaften Produktionsweise ebenfalls erheblich zu den Treibhausgasen bei (vgl. Dhiman 2018 b). Der ökologische Fußabdruck rechnet gegen diese Produktion, wie viel Wald notwendig wäre, um CO2 auszugleichen, und stellt dies in Flächen dar. Der vorhandene und mehr noch ein anzubauender Wald könnte dann als Biomasse, als lebende Pflanze oder als Humus, das CO2 binden, um den Treibhauseffekt zu verhindern. Dabei wird auch diese Berechnung eher geschönt als kritisch komplex durchgeführt. Denn auch die Meere werden als Speicher für CO2 angesetzt, obwohl die Versauerung der Meere durch CO2 eine eigene planetare Grenze darstellt. Die Kohlendioxid-Konzentration lag im Jahr 2017 um 41 Prozent über dem vorindustriellen Niveau. Die Versauerung der Meere zeigt sich im PH-Wert der Meeresoberfläche, der durch die Bindung von CO2 sinkt. Er ist so schlecht geworden, dass viele Meereslebewesen dadurch bedroht sind, insbesondere weil Kalk sich bei niedrigeren PH-Werten nicht mehr gut anlagern kann.
Seit der Mensch durch die Industrialisierung die Erde kolossal verändert hat, haben die Treibhausgase durch sein Wirken stetig steigende Höchstwerte erreicht. Die Konzentration ist nach Angaben der UN so hoch wie seit drei bis fünf Millionen Jahren nicht. Messungen ergeben ständig neue Rekordwerte nicht nur für CO2, sondern auch für Methan und andere schädliche Gase. Jedes Jahr werden trotz der seit Jahrzehnten stattfindenden Klimakonferenzen mit gegenteiligen Bekenntnissen neue Steigerungsraten erreicht. Zwar gibt es durchaus Erfolge durch vermeintlich »saubere« Atomenergie, die andere Schädigungen hervorruft, und vor allem durch erneuerbare Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserenergie, aber diese positiven Zugewinne werden durch den wachsenden Bedarf an fossiler Energie weltweit konterkariert. Es laufen zwei Wachstumsraten nebeneinander: die grüne und nachhaltige Energiegewinnung auf der einen Seite und der schmutzige und wachsende Energiebedarf auf der anderen.
Die Klimaziele, die in noch »erlaubten« Graden und Zielen angegeben werden, gehen zwar auf wissenschaftliche Analysen zurück, aber sie sind politisch willkürlich gesetzt. Niemand kann sagen, ob 1 Grad, 1,5 oder 2 Grad hinreichende Grenzen darstellen, um den Klimawandel tatsächlich »verträglich« (für wen, für welche Orte, in welcher Reichweite) in langer Zeitperspektive umzusetzen. Um die komplizierte wissenschaftliche Durchdringung zu vereinfachen, hat sich aktuell das 2-Grad-Ziel mehr oder minder politisch durchgesetzt. Dabei geht man von der Wahrscheinlichkeit aus, dass die dann eintretenden Klimaveränderungen zwar bereits schwerwiegend sein werden, aber die Menschheit nicht als Ganzes gefährden.
Wie stark der ständig steigende Ausstoß von CO2 (gemessen in Gigatonnen) gebremst werden müsste, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, veranschaulichen viele Modellberechnungen. Sollte der gegenwärtige Anstieg weiter anhalten, dann müssen katastrophale Szenarien mit 3 Grad und höher ins Auge gefasst werden. Bereits 2 Grad sind ein sehr optimistisches Ziel, und auch bei diesem weltweit anerkannten Ziel auf den Klimakonferenzen ist schon klar, dass es erhebliche Folgen zunächst für einzelne Regionen und auf Dauer für alle geben wird. Bereits heute, bei einer Erhöhung über 1 Grad im Durchschnitt, zeigen sich Klimaveränderungen wie die Eisschmelze, der langsam steigende Meeresspiegel, die Versauerung der Meere und eine Zunahme an Wetterextremen. Jedes Grad mehr wird die Ökosysteme mit ungeahnten Folgen belasten.
Die wissenschaftlichen Modelle arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, sie können nicht absolut voraussagen, welche einzelnen Ereignisse wann genau auftreten werden. Und die durch den Klimawandel erzeugten Gefahren können, bis sie alle Menschen in allen Regionen spüren werden, zunächst sehr unterschiedlich ausfallen. Manche Länder sind mehr als andere vom steigenden Meeresspiegel, von Überflutungen oder langanhaltender Dürre und großen Flächenbränden betroffen. Besonders gefährdet sind viele Länder im globalen Süden durch Überschwemmungen, Stürme und Dürren. Der steigende Meeresspiegel bedroht nach dem Weltrisiko-Index (https://weltrisikobericht.de/) insbesondere Küsten und Inseln in den Tropen. Staaten wie Vanuatu, Tonga, Dominica, die Salomonen und Fidschi werden als Erste betroffen sein. Die Temperaturen in dicht besiedelten Gebieten werden stärker als über den Meeren steigen, derzeit sind die Veränderungen in der Arktis am deutlichsten. Was das Auftauen des Permafrostes bedeuten wird, das ist selbst in der Wissenschaft noch umstritten. Extreme Wettereignisse, das zeigt schon die Gegenwart, werden stark zunehmen. Starkniederschläge mit Überschwemmungen auf der einen, Dürreperioden mit steigender Brandgefahr auf der anderen Seite sind zwei Ausdrucksformen eines sich wandelnden Klimas. Der Meeresspiegel steigt bereits bei 1,5 Grad auf fast bis zu 0,85 Meter an, bei 2 Grad sind es dann schon 0,9 Meter – so könnte er bis 2100 um 1 Meter oder 2 Meter ansteigen (Incropera 2016, 89 f.). Schwierig an solchen Berechnungen ist die Einschätzung des Abschmelzens der Eisschilde, was eine sehr viel größere Erhöhung bewirken könnte.
Steigende Risiken entstehen bei der Erwärmung für die menschliche Ernährung und die Wasserversorgung, was für das Überleben und die Gesundheit vieler Menschen von Bedeutung ist. Mais, Weizen und Reis werden in den Erträgen insbesondere in Afrika, Südostasien und Lateinamerika gefährdet sein. Auch die Wasserversorgung, so sagen es Modellberechnungen, kann bereits ab 1,5 Grad nicht mehr sicher gewährleistet werden, doppelt so kritisch schon bei 2 Grad. Selbst bei einer von der Politik für mäßig gehaltenen Klimaerwärmung werden heute schon vorhandene Gesundheitsrisiken bestimmter Länder vor allem im globalen Süden zunehmen.
Was vielfach vergessen wird, sind die Folgen des Klimawandels für die Bausubstanz auf der Erde. Straßen, Brücken, Gebäude und alle anderen Konstrukte unterliegen einem starken Verfall insbesondere durch Extremwettereignisse (Incropera 2016, 94 ff.). Die Haushaltskassen der Länder sind meist zu wenig auf solche Erneuerung ausgelegt und zeigen heute schon eine Tendenz, die bestehende Substanz vielfach verfallen zu lassen.
Optimisten unter Wissenschaftlern und mehr noch in Wirtschaft und Politik setzen gern auf Technologien, die Klimagase eindämmen und die sie aus der Atmosphäre durch Geoengineering verringern sollen. So könnte beispielsweise durch Impfung mit Schwefeldioxid die Stratosphäre durch die Entstehung von Schwefelsulfaten über Aerosole die Sonneneinstrahlung ins All zurückreflektieren, um den Treibhauseffekt zu reduzieren; auch Nanopartikel ließen sich hierfür nutzen. Kritiker an diesem Optimismus verweisen darauf, dass dadurch weitere unberechenbare Klimaeffekte erzeugt werden, die für weitere Katastrophenszenarien sorgen könnten. Ganz abgesehen davon fehlt auch einfach die Zeit, solche Technologien umfassend in hinreichender Menge zu entwickeln und schnell einzusetzen. Dies gilt auch für die Erzeugung negativer Emissionen durch das Einfangen und Speichern von CO2 aus der Atmosphäre. Einfacher wäre es, wenn CO2 konsumierende Wälder und Pflanzen (Biomasse) sofort massenhaft angebaut würden, um das CO2 zu reduzieren. Die Begrenzung liegt hier im Privateigentum an Land- und Agrarflächen, an knappen Nährstoffen und in der Verfügbarkeit von Wasser. Zudem ist der Zeiteffekt nicht zu vernachlässigen, den das Wachsen solcher Biomasse voraussetzt. Auch wenn die Planung solcher Maßnahmen mit Langzeiteffekten arbeitet, so wären sie wahrscheinlich die realistischsten Maßnahmen der CO2-Reduktion in näherer Zukunft. Aber gegenwärtig beschäftigt sich die Menschheit noch damit, weitere Brandrodungen bestehender Wälder einzudämmen und dies noch nicht einmal mit großem Erfolg. Das noch größere Problem aber besteht darin, dass selbst bei wirksamen Klimaschutzmaßnahmen mit Abbau von CO2 ein weiteres zunehmendes Wirtschaftswachstum solche Effekte schnell konterkariert (Incropera 2016, 134).
Es gibt mittlerweile sehr viele Zusammenstellungen zu weiteren Klimafakten. Eine Faktenliste, die ich hier zusammenfasse, findet sich in Climate G 20 (2017). Wichtige Eckpunkte sind:
Lufterwärmung: Die mittlere globale Lufttemperatur liegt gegenwärtig um fast ein Grad höher als das Mittel im 20. Jahrhundert. Es gibt immer neue Rekordjahre der Jahresdurchschnitts- und Höchsttemperaturen in den letzten zehn Jahren. Die Mitteltemperatur der Luft hat stetig zugenommen. Jede Dekade ist wärmer als die vorhergehende. Die Dekade 2011 bis 2020 bildet einen neuen Höchststand. Temperaturrekorde sind ein Ausdruck hiervon.
Wassererwärmung: Die Ozeane erwärmen sich ebenfalls. Allein von 1980 bis 2015 ist die Temperatur der oberen Wasserschichten um 0,5 Grad gestiegen. Klimaleugner führen gern an, dass in Teilen, wie etwa dem Nordatlantik, die Temperaturen auch gesunken sind, verschweigen aber dann den überproportionalen Anstieg in anderen Regionen. Schlimmer noch wiegt, dass das Abreißen des Golfstroms die sinkenden Temperaturen ausdrückt, was als Symptom einer großen Klimaverschiebung unvorhersehbare weitere Verschlechterungen bedingen könnte. Die Meere sind als globaler Wärmespeicher für 93 Prozent der Speicherung der Erderwärmung zuständig. Dagegen sind andere Speicher wie die Eisschmelze (3 %), die Erwärmung der Kontinente (3 %) oder der Atmosphäre (1 %) eher kleinere, aber durchaus wirksame Speicher.
Eisschmelze: Gletscher und Schnee werden weniger, insbesondere der grönländische Eisschild schmilzt jährlich um 250 bis 300 Milliarden Tonnen. Auch das Meereis rund um den Nord- und Südpol wird immer weniger. Vier Fünftel der Gebirgsgletscher verlieren aktuell große Eismassen. Das Tempo des Eisverlustes beschleunigt sich.
Hochwasser und schwere Wettereignisse: Großwetterlagen mit Hochwasserereignissen nehmen zu. In den letzten 30 Jahren haben sich solche Ereignisse um das Zwei- bis Dreifache erhöht. Die Versicherer solcher Schäden berichten ebenfalls von einer Verdreifachung der Schäden durch Gewitter. Wetterereignisse, ob große Hitze oder Starkregen, sind ein Ausdruck des Klimawandels, weil die Klimaereignisse länger andauern und die Wetterlagen nicht so schnell wie früher wechseln. Dies verstärkt die Wettereffekte.
Hitze und Dürre: Die menschliche Existenz hängt von einer Umgebungstemperatur ab, die kühler als die Körpertemperatur ist und so einen Kühleffekt auf den Körper ausübt. Auch wenn gelegentliches Schwitzen angenehm sein kann, so benötigt der Mensch dauerhaft eine kühlende Umgebung. Die Einzigartigkeit des Planeten Erde im uns bekannten Kosmos besteht in seinem lebensförderlichen Klima. 2, 3 oder 4 Grad Klimaerwärmung hätten zunächst keine vernichtende Wirkung auf den Menschen, da zwar die Temperaturspitzen steigen, aber es zu 10 oder 11 Grad Durchschnittserwärmungen mit den damit verbundenen drastischen Folgen kommen müsste, um den Menschen unmittelbar in allen Regionen der Welt durch fehlende natürliche Abkühlung zu gefährden. Dennoch reichen wenige Grad heute schon aus, um regional gefährliche Hitze zu erzeugen, Dürre in bestimmten Regionen anwachsen zu lassen und Buschbrände zu vermehren. Besonders tragisch ist hierbei, dass die menschliche Gier negativ zu den Effekten beiträgt. Das Abbrennen großer Teile des Amazonas-Regenwaldes steht hier an der Spitze eines Verhaltens, das nicht nur unmittelbar Treibhausgase freisetzt, sondern dazu auch noch große CO2-Speicher dauerhaft vernichtet. Die Weltpolitik hat hierzu keine hinreichenden Sanktionen geformt, obwohl das Handeln die Menschheit insgesamt bedroht. Und selbst Australiens Regierung, die 2019–20 die größten Buschbrände der Neuzeit hinnehmen musste, löst sich nur zögerlich vom Klimaleugnen hin zu einer Politik, die einen Zusammenhang der Katstrophe mit dem Klimawandel für möglich hält. Selbst katastrophale Ereignisse reichen nicht hin, um der fossilen Wirtschaftsweise die Absage zu erteilen.
Veränderungen in der Land- und Forstwirtschaft: Durch die Erwärmung verändern sich die Blüte- und Erntezeiten. Im Vergleich zu den 1970ern blühen Apfelbäume in Deutschland rund 20 Tage früher, obwohl es dann nachts leichter zu Frostschäden und späteren Ernteausfällen kommen kann. Zahlreiche Baumarten sind gefährdet, weil sie sich nur langsam an Klimaveränderungen anpassen können. Trockene Sommer mit erhöhter Waldbrandgefahr oder heftige Niederschläge mit Überschwemmungen bedrohen den Bestand. Zugleich wandern Insekten ein, die keine Fressfeinde haben, andererseits fehlen Insekten zur Bestäubung. Die Veränderungen überfordern die Land- und Forstwirtschaft, da die alten Modelle weder Risiken noch Chancen hinreichend abbilden können. Und auch eine ökologische Landwirtschaft wird durch den Klimawandel vor komplizierte Fragen der Wirtschaftlichkeit gestellt, weil die Konsumenten immer sparen wollen.
Die Lebensmittelproduktion und ein dadurch möglicher Bevölkerungszuwachs hat zahlreiche Folgewirkungen, die insbesondere zu einer Erweiterung der Produktionsflächen, einer Verminderung der Anbauarten mit einer Vernichtung von Arten- und Pflanzendiversität führen, um gezielt Massenbedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Mehr als 75 Prozent der Lebensmittel kommen heute von zwölf Pflanzen- und fünf Tierarten (Mauch 2019, 8 f.). Die Vernichtung der ökologisch bedeutsamen Regenwälder zeigen in dramatischer Weise, wie für Futtermittel ökologisch wertvolle und nicht wiederherstellbare Biotope zerstört werden. Für Kosten- und Nutzenmaximierung werden Herbizide, Pestizide und Antibiotika auf die Ökologie losgelassen, womit unwiederbringlich in die Kreisläufe der Natur eingegriffen wird. Dies geschieht, weil sich die menschliche Sorge im Laufe der Geschichte immer stärker auf die Maximierung der Gewinne und steigenden Wohlstand richtet, ohne die dabei erzeugten Nachhaltigkeitsfallen zu beachten. Wenn der wissenschaftliche Fortschritt etwa die Antibiotika als Segen für die Menschheit in der Bekämpfung von Krankheiten hervorgebracht hat, so riskiert der Mensch diesen Segen, indem er ihn für kurze Profitzwecke in massenhafter Tierhaltung in Resistenzbildungen treibt, die den Segen in einen Fluch verwandeln. Zwar gibt es viele Menschen, die sich hierüber Sorgen machen, es gibt Vegetarier und Veganer, aber in der Masse der Produktions- und Lebensweise reicht die Sorge bisher nicht aus, um den Fallen zu entkommen und diese effektiv zu beseitigen.
Jenseits dieser Klimaveränderungen, aber mit ihnen in einem unlösbaren Zusammenhang stehend, gibt es weitere Veränderungen, die ich kurz in Betracht ziehen will. Sie zeigen auch, wie wenig der Klimawandel im Zusammenhang mit weiteren Faktoren gesehen wird. Dies betrifft vor allem die Messgrößen und Vergleiche, die sich konventionell herausgebildet haben. So messen wir zwar den negativen Fußabdruck, ohne dass in ihn aber alle relevanten Faktoren eingehen.