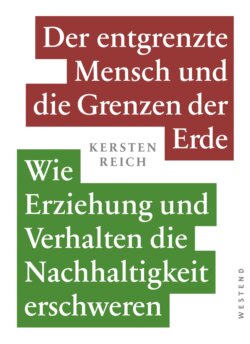Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Artensterben
ОглавлениеIm Anschluss an den Umweltgipfel von Rio haben Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Bericht Sustaining Life erstellt, der aufzeigt, wie sehr das menschliche Leben von anderen Arten abhängt (Chivian & Bernstein 2008). Diese Abhängigkeit und die Dienste, die durch die Evolution verschiedenster Lebensformen dem Menschen zum eigenen Überleben bereitstehen, die auch durch die weitere Umwelt wie selbstverständlich vorhanden zu sein scheinen, werden in menschlichen Handlungen ignoriert und übersehen, weil der Mensch sich angewöhnt hat, nur noch seine materiellen Vorteile und Wünsche zu fokussieren und vergisst, was dies für die planetaren Grenzen bedeutet. Der von IPBES (2019) vorgelegte Bericht zur Biodiversität und zum Ökosystem verdeutlicht die dramatische Lage für das Artensterben. Da Pflanzen und Tiere in ökologischen Nischen existieren, bedeutet die Erwärmung für sie entweder eine Existenzbedrohung oder die Chance, den Lebensraum erheblich zu erweitern. Dies bringt die bisherige Balance aus dem Gleichgewicht. Wo die einen massenhaft aussterben, da erweisen sich wenige andere als Gewinner ohne Fressfeinde, was wiederum zur Bedrohung evolutiv erreichter Gleichgewichte führt. In Deutschland etwa sind von 500 einheimischen Tierarten rund 63 unmittelbar vom Aussterben betroffen, darunter Schmetterlinge, Weichtiere, Käfer, Bienen. Auch die globale Entwicklung ist erschreckend: Rund eine Million Arten sind in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf dem Land und im Wasser vom Aussterben bedroht, wie der IPBES-Bericht ausführt. Allein die Erderwärmung würde rund 5 Prozent der Arten vernichten, wenn das Zwei-Grad-Ziel verfehlt wird. 99 Prozent der Korallenriffe wären nicht zu retten.
Laut IPBES-Bericht sind 85 Prozent der Feuchtgebiete bereits verschwunden, seit dem späten 19. Jahrhundert ist die Hälfte der Korallenriffe vernichtet worden. 9 Prozent der Nutztierrassen sind ausgestorben. Die Abholzung des tropischen Regenwaldes hat dramatisch zugenommen: Waren es zwischen 1980 und 2000 schon 100 Millionen Hektar, so sind allein zwischen 2010 und 2015 weitere 32 Millionen hinzugekommen. So hat sich seit 1950 die Fläche des tropischen Regenwaldes halbiert; er nimmt nur noch etwa 5 bis 7 Prozent der Erdoberfläche ein.
Besonders negative Auswirkungen hat die Agrarindustrie, die durch Monokulturen, Pestizide und Nitrate die Umweltbedingungen verschlechtert. Jeden Tag werden zu diesem Zweck etwa alle zwei Minuten 35 Fußballfelder gerodet; 2019 war durch die Abholzung im Amazonas ein besonders schwerwiegendes Jahr. Solcher Raubbau folgt immer kurzfristigen Gewinninteressen, unter anderem werden mit Gras und Soja riesige Rinderherden versorgt, die vor allen in den Industrieländern konsumiert werden. Der Anbau von Ölpalmen erzeugt Palmöl, das mittlerweile in fast jedem zweiten Produkt, das im Supermarkt gekauft wird, enthalten ist. Ein anderer Teil des Palmöls wird für die Herstellung von Biodiesel oder in der Aluminiumindustrie verwendet. Indirekt und meist unwissentlich sind so die Konsumwünsche der Menschen mit dem Waldsterben verbunden.
Der Bericht macht auch darauf aufmerksam, dass bereits 23 Prozent der Landfläche des Planeten ökologisch abgenutzt ist und nicht mehr zur weiteren ökologischen Nutzung zur Verfügung steht. Aber auch das Insektensterben stellt eine Gefahr dar, da die Bestäuberinsekten für die Nahrungsmittelproduktion unentbehrlich sind. Besonders hervorgehoben wird auch die Zerstörung von Küstengebieten und Mangrovenwäldern, was die Lebensgrundlage von bis zu 300 Millionen Menschen in naher Zukunft gefährden wird.
Eindringlich mahnt der Bericht, dass die bisherigen Versuche im Rahmen von UN-Abkommen, um die biologische Vielfalt zu schützen, überwiegend versagt haben. Vor allem umweltschädliche Praktiken in der Landwirtschaft, der Fischerei und der Forstwirtschaft haben ebenso wie eine zunehmende Umweltverschmutzung und die Ausbreitung gebietsfremder Arten dazu geführt, dass die Lage sich stetig verschlimmert und die Lippenbekenntnisse der Gegensteuerung in der Praxis kaum greifen. Die Menschheit, so folgert der Bericht, müsste sofort, überall und gleichzeitig auf allen Ebenen handeln, um den Niedergang der biologischen Vielfalt wenigstens zu verlangsamen oder in Teilen rückgängig zu machen, obwohl er wohl nicht mehr gänzlich zu stoppen ist.
Die Artenkrise hängt einerseits eng mit der Klimakrise zusammen, andererseits ist sie zugleich auch mit der Zunahme der Bevölkerungsdichte und den umweltzerstörerischen Interessen der Menschen verbunden. Sie ist wahrscheinlich noch schwieriger zu lösen als die Klimakrise, die immerhin in der Verringerung des CO2-Ausstoßes ein klares Ziel hat. Für das Artensterben gibt es sehr viele, unterschiedliche, oft regional spezifische Gründe. Das Abholzen des Regenwaldes erfordert andere Maßnahmen als die Umstellung der intensiven Landwirtschaft in den Industrieländern in Europa und den USA oder der Handel mit geschützten Tierarten in Asien. Das Hauptproblem aber liegt darin, dass sich mit Maßnahmen gegen das Artensterben kein Geld verdienen lässt, dass es keine einfachen und technischen Lösungen gibt, dass die Menschen nur mit Einsicht und Verzicht auf bisheriges Verhalten die Biodiversität stärken könnten.
Um die Biodiversität zu erhalten, die auch für das menschliche Leben und seine Qualität von hoher Bedeutung ist, müsste das kollektive Bewusstsein für die Notwendigkeit wachsen, saubere Luft zu erzeugen, das Wasser zu erhalten und zu schützen, die Böden fruchtbar und vielseitig anzubauen, Überfischungen ebenso zu vermeiden wie Massentierhaltungen; der Wald müsste nicht nur erhalten, sondern erweitert werden. Bei all dem müsste im Blick behalten werden, dass die Ökologie dabei nicht kostenfrei und beliebig zur Verfügung steht, sondern im Wertekanon der Menschheit einen primären Platz beansprucht.