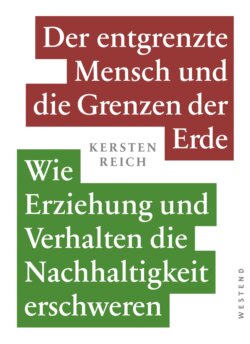Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1 - Kersten Reich - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.3Wahrscheinlichkeiten & Wahrheiten
ОглавлениеEs sind nun die gravierendsten Auswirkungen der Klimakrise und anderer Nachhaltigkeitsrisiken aufgezeigt; die meisten sind zumindest ansatzweise sehr vielen Menschen bekannt. Warum ist es nun so schwierig, all diesem Wissen Handlungen folgen zu lassen? Ein erster Versuch einer Erklärung wäre folgender: Menschen haben schon auf der Verständnisebene große Schwierigkeiten, drei Erklärungszusammenhänge zu begreifen:
(1) Exponentiell oder linear: Exponentielle Entwicklung ist deutlich unanschaulicher und schwerer zu begreifen als ein linearer Fortschritt oder eine lineare Kurve. Linear ist ein Zuwachs, der aus dem Alltag wohl vertraut und bekannt ist. Es geht um ein Anwachsen einer Linie, einer Kurve oder eine Aneinanderreihung von kausalen Ereignissen, die alle gedanklich gut nachvollzogen werden können. Menschen kennen es von der Zeit- und Geschwindigkeitsmessung, von der Verzinsung oder allen Ereignissen, die mit einem Lineal gezeichnet und leicht in Tabellen eingetragen werden können. Exponentiell hingegen sind Entwicklungen, die mittels eines mathematischen Modells einen Wachstumsprozess beschreiben, der weniger anschaulich ist. In einem jeweils gleichen Zeitraum vervielfachen sich die Werte immer um denselben Faktor, so steigen sie etwa oder nehmen dynamisch ab. Selbst bei anfangs nur kleinen Zuwächsen steigen diese anders als bei linearen Vorgängen ab einem gewissen Zeitpunkt so steil an, dass sie die Vorstellungskraft überfordern und deshalb leicht unterschätzt werden. Die Corona-Pandemie ist durch ein solch exponentielles Wachstum charakterisiert, sodass Menschen zunächst die Wirkung der Zunahme und die dadurch ausgelöste nicht hinreichende medizinische Versorgung unterschätzten. Auch der Klimawandel ist ein Ereignis, das exponentiellen und nicht bloß linearen Modellen folgt.
(2) Wahrscheinlich oder wahr: Wahrscheinlichkeiten unterscheiden sich vom alten Denkmodell der Wahrheit, die universell und für alle Zeiten gültig sein sollte und ganze Zeitalter überbrücken konnte. Das Wahrheitsmodell folgt den religiösen Vorstellungen des einen Gottes, der die absolute Wahrheit repräsentiert, oder einer Philosophie der letzten Worte und endgültiger Weisheiten stark autoritärer Herrschaftsregime. Auch naturwissenschaftliche Gesetze scheinen solchen Wahrheiten zu entsprechen. Dies zeigt sich in der Frage nach der gegenwärtigen Temperatur: 20 Grad Celsius sagt das Thermometer – was sollen wir da noch diskutieren oder zweifeln? Nur leider sind solche einfachen Fakten immer nur Teile von Wissenschaft, die eine begrenzte Aussagekraft haben und nur für einen Moment und eine bestimmte Situation taugen. Viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, um wie viel Grad die Durchschnittstemperatur noch ansteigen darf, um keine verheerenden Umweltkatastrophen auszulösen. Die Wissenschaften könnten ihre Forschungen nicht verbessern, wenn sie nicht immer kritisch neu überprüfen würden, wie sich die Wahrheiten in ihnen verändern, präzisieren und je nach Kontext variieren. Deshalb hat sich in allen Wissenschaften das Modell der Wahrscheinlichkeit durchgesetzt, das mindestens besagt, eine Wahrheitsaussage könne immer nur gerade so lange gelten, bis ein Gegenbeweis erfolgt. Es muss außerdem immer beachtet werden, dass sehr einfache Fragen einfache, schwierige und komplexe Fragen aber erst wirklich wissenschaftlich interessante Antworten erhalten. Einfach ist beispielsweise eine Temperaturmessung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort: Es wird gemessen, bestimmt, Daten werden archiviert. Schwierig sind Erklärungen über Einflussfaktoren und ihr Zusammenwirken auf Temperaturschwankungen im Klimawandel. Einflussfaktoren müssen identifiziert werden, für Zusammenhänge sind Modelle erforderlich, Daten müssen mit Modellen kompatibel sein, zwischen Theorie und Empirie entstehen Unschärfen.
(3) Kurz- und mittelfristig oder langfristig: Menschen haben viel Vernunft und Forschung, viel Energie und Intelligenz darauf verwandt, ihre kurz- und mittelfristigen Angelegenheiten zu regeln und zu überschauen. Meist dominiert dabei der Blick auf die eigene und vielleicht noch auf die nächste Generation, aber weitreichendere Überlegungen oder gar Maßnahmen sind ausgesprochen selten. Die Bedeutung des Klimawandels für lokale Angelegenheiten, die Land- und Wasserwirtschaft, für Maßnahmen gegen Überflutungen und in der Hitzeabwehr haben eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, aber schon Schwerwetterereignisse wie Hurrikans zeigen, wie schwer sich Menschen durch solche Ereignisse belehren lassen und wie gering der Sinn für Prävention ist (vgl. Meyer 2012). Noch weniger Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, was es bedeuten könnte, wenn eine Reihe von nah aufeinander folgenden kleineren Ereignissen eintreten, die eine Wirtschaft oder Lebensweise so schädigen, dass es Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Lebensweise gibt. Die Corona-Pandemie hat einen Eindruck darüber vermittelt, dabei war nur ein geringer Prozentsatz an Menschenleben direkt bedroht. Was geschieht, wenn dieser Prozentsatz noch deutlich höher liegt? Welche konfliktträchtigen, kriegerischen Überlebensmechanismen werden dann ausgelöst?
Vor dem Hintergrund der von mir zusammengefassten Grenzen der Erde lassen sich erwartbare Mega-Katastrophen, die Millionen Menschenleben gefährden und das Bild des Planeten erheblich verändern werden, in zweifacher Weise voraussagen:
Einerseits führt bereits der Klimawandel zu Kipp-Punkten, die durch die Erderwärmung und die dadurch ausgelöste Eisschmelze den Meeresspiegel ansteigen lassen, Schwerwetterereignisse auslösen, Hitze und Dürre hervorbringen wird. Dabei können zahlreiche beschleunigende Effekte eintreten, die durch das Abschmelzen der Tundra und das Freisetzen von gebundenen Gasen die Lage verschlimmern. Das Artensterben und andere Aspekte des oben herausgestellten negativen Fußabdrucks der Menschheit verschärfen die Situation. Die Krise ist nicht einseitig, sie betrifft viele Aspekte, die alle weitreichende Auswirkungen haben und nicht nur isoliert betrachtet werden können. Vielleicht unerwartet, aber vom Potential her vorsehbar, können auch die Massenvernichtungswaffen jederzeit eine große Rolle spielen und das Klima in den Hintergrund treten lassen.
Andererseits sind all die Aspekte, die in diesem Teil überblicksartig betrachtet wurden, Bestandteile der globalen Grenzen des Planeten. Jede Auswirkung kann eine andere hervorrufen, nationale Sorgen und Zustände können sich schnell in globale verwandeln, wie die Corona-Pandemie der gesamten Welt gezeigt hat. Aus kleineren Krisen werden durch Kaskaden-Effekte schnell größere. Ein eben noch lokales Phänomen verwandelt sich über Nacht in ein globales Unglück. Der größte angenommene Unfall eines Atomkraftwerks, eine Pandemie, ein sich ausweitender kriegerischer Konflikt, sie alle und viele Situationen mehr haben immer das Potential einer globalen Krise, die von einer Kaskade weiterer Einzelfolgen mit neuen Kettenreaktionen begleitet wird.
Wirtschaftlich stehen heute schon Dürren vor allem im globalen Süden vor Augen, die eine hohe politische Instabilität in vielen Regionen auslösen, Migrationswellen erzeugen, das Überleben so vieler Menschen gefährden, dass die Zivilgesellschaften darüber zusammenbrechen und reichere Länder eine Abschottungspolitik betreiben werden. »Die Folgen für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit, die auf andere Länder übergreifen, könnten katastrophal sein.« (Kousky et al. 2009, 7) Es ist wahrscheinlich, dass solche Kaskaden-Effekte in kurzer Zeit deutlich schneller einsetzen werden als bisher gedacht. Der globale Klimawandel oder andere Nachhaltigkeitsfaktoren wie der Ressourcen-Schwund haben sich beschleunigt, Menschen denken heute noch, dass diese Prozesse langsam ablaufen und erst in späterer Zeit ihre dann allerdings dramatischen Wirkungen entfalten werden (vergleiche das Beispiel des Lilienteiches). Es gehört zu den Ungewissheiten und Unsicherheiten des menschlichen wie des planetaren Lebens, dass nicht vorhersehbar ist, welche Ereignisse in der Zukunft an welchem Tag genau entscheidend sein werden. Immerhin hat die Menschheit hinreichend Intelligenz entwickelt, dass sich vernünftig entscheiden lässt, wo große Risiken liegen, die nicht zu leugnen sind. Es lässt sich auch sagen, was die Menschheit tun müsste, damit die Risiken bewältigt, zumindest beschränkt werden können. Aus meiner Sicht sind es genau vier Fragen, die darüber entscheiden – die uns hindern oder befähigen können – ob wir uns diesen Herausforderungen zu stellen bereit sind:
Erstens die Verhaltensfrage: Inwieweit sind wir durch das Erkennen einer Sorge bereits hinreichend motiviert und befähigt, unser Verhalten tatsächlich zu ändern? Zweitens die Wohlstandsfrage: Inwieweit kann unser ökonomisches System, das grundlegend nach Wachstum und nicht nach Verzicht strebt, überhaupt verändert, gebremst und neu ausgerichtet werden?
Drittens die Politikfrage: Inwieweit können demokratische Strukturen, wenn die Masse der Wählenden nicht nachhaltig handeln will, noch hinreichend Potential entwickeln, um das Überleben langfristig zu sichern?
Viertens die Erziehungsfrage: Inwieweit bereitet die private und öffentliche Erziehung Menschen hinreichend darauf vor, sich sachlich umfassend zu informieren, keine Verschwörungstheorien zu bevorzugen, sondern Argumente so auszutauschen und Handlungen zu vollziehen, dass Nachhaltigkeit de facto erreicht werden kann?
In beiden Bänden dieses Buches will ich allen vier Fragen umfassend nachgehen. In diesem Band geht es vorrangig um Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die vielen Menschen die Nachhaltigkeit erschweren. Im zweiten Band stehen Ökonomie und Politik auf dem Prüfstand, die diese bisher sogar überwiegend verhindern.