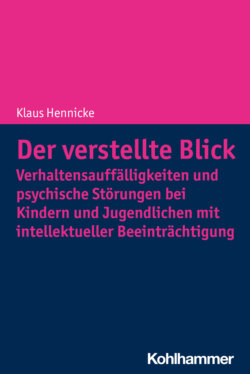Читать книгу Der verstellte Blick: Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung - Klaus Hennicke - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Meine Ausgangspunkte
ОглавлениеDer Versuch, Antworten zu finden auf die Frage, was uns den Blick auf eine eigentlich normale Wirklichkeit verstellt, konzentriert sich deswegen auf die seelischen Probleme von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung, weil sich in ihnen – nicht nur aus Sicht des Kinder- und Jugendpsychiaters5 – eine grundlegende menschliche Eigenschaft zeigt, nämlich mit sich selbst und seiner Welt in Konflikt geraten zu können und Anforderungen ausgesetzt zu sein, die ein Mensch so oder so bewältigen und an denen er auch scheitern kann. Leugnet man diese Eigenschaft, leugnet man ein Stück Menschsein.
Seelische Probleme sind ein häufiger und sehr dynamischer Teil der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ich werde dies mit vielen Fallbeispielen zeigen und hoffe, dass sie vermeintliche Gewissheiten verunsichern, Kontingenzen schaffen und uns auffordern, den Blick auf diese Kinder und Jugendlichen offener und breiter zu gestalten. Meine Ausgangspunkte sind:
»Menschen mit geistiger Behinderung dürfen nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden. Die Gesellschaft muss deshalb dafür sorgen, dass junge Menschen mit geistiger Behinderung ihre Talente und Ressourcen entfalten können – und dass sie bei schulischen, sozialen oder psychischen Problemen wirksam unterstützt werden.
Entwickeln Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung psychische Störungen, haben sie Anspruch auf angemessene Behandlung, unabhängig vom Grad ihrer Behinderung. Bestehende kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungsstrukturen müssen daher grundsätzlich auch Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung offen stehen und falls nötig deren besonderen Bedürfnissen angepasst werden; das Therapiesetting muss die Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung berücksichtigen. Reichen die bestehenden Angebote nicht für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung aus, müssen neue spezielle Versorgungsstrukturen geschaffen werden.« (Volksschulamt der Bildungsdirektion Kanton Zürich 2012, S. 5)
Dieses Zitat stammt aus einem Papier des Volksschulamtes der Bildungsdirektion Kanton Zürich aus dem Jahre 2012 unter dem Titel »Psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung«. So klar und selbstverständlich sind der psychiatrisch-psychotherapeutische und heilpädagogische Versorgungsanspruch von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung und zusätzlichen Lebensproblemen und die daraus folgenden Herausforderungen an die Gesellschaft selten formuliert worden. Gleichzeitig erschreckt, dass es heute immer noch notwendig ist, dies zu betonen. Ein halbes Jahrhundert nach der berühmten epidemiologischen Isle of Wigth-Studie (Rutter et al. 1976; 1977), in der bereits die hohe psychiatrische Morbidität intelligenzgeminderter Kinder festgestellt wurde, ist es immer noch notwendig darauf hinzuweisen, dass Kinder und Jugendliche mit intellektueller Beeinträchtigung seelische Probleme haben, die das Ausmaß einer psychiatrischen Erkrankung annehmen können, und dass das Risiko für diese Menschen weit höher ist, solche Probleme zu entwickeln als bei nicht kognitiv beeinträchtigten Kindern. Das Leiden und die konkreten Leidensformen dieser Kinder und Jugendlichen werden auch heute noch in den Praxisfeldern übersehen oder als etwas gänzlich anderes wahrgenommen. Mitarbeiter in der Behindertenhilfe und Lehrer in den Förderschulen geistige Entwicklung beklagen seit Jahren die Zunahme der Verhaltensauffälligkeiten und die Probleme, die das für die Betreuung und Beschulung mit sich bringt. Viele Tagungen, Initiativen und Fortbildungsveranstaltungen zu dieser Thematik verdeutlichen das, ebenso das Erscheinen relevanter Fachbücher in den letzten Jahren. Während so die praktischen und wissenschaftlichen Evidenzen (meistens) zur Kenntnis genommen werden, werden sie in ihren Konsequenzen in eigenartiger Weise verleugnet. Diesen Tendenzen auf die Spur zu kommen, ist eine Intention dieses Buches.
• Wie erklärt sich der Widerspruch, dass selbstverständlich die volle Verwirklichung der Menschenrechte auch für intellektuell beeinträchtigte Menschen gefordert wird, aber gleichzeitig deren seelisches Leiden (als eine grundlegende Möglichkeit menschlicher Existenz) und damit auch ihr Anrecht auf spezifische Unterstützung kaum wahrgenommen werden?
• Wie kommt es, dass viele Kinder – und Jugendpsychiater die »stille Überzeugung« (Simonoff 2005, S. 743; Übers. K. H.) hegen, die psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung dieser Kinder und Jugendlichen lohne sich kaum und insofern könne auch Diagnostik vernachlässigt werden?
• Warum behaupten pädagogische Fachleute unwidersprochen, dass Verhaltensauffälligkeiten nichts mit seelischem Leiden zu tun habe, und wer dies meint, »medizinisiert« oder »psychiatrisiert«?
• Und warum werden die Klagen der Mitarbeiter in der Behindertenhilfe und der Lehrer in den Förderschulen und der Eltern, die sich trauen, ihre Probleme öffentlich zu machen, nicht wahrgenommen?
Aus vielen Diskussionen mit Sonderpädagogen und kinder- und jugendpsychiatrischen Kollegen weiß ich, dass im Grunde die allermeisten der prekären Situation zustimmen. Gleichzeitig ist es meine Erfahrung, dass dieser vermeintliche Konsens nicht im Sinne verbesserter Versorgungsstrukturen umgesetzt wird. Gibt es tatsächlich heimliche Meinungen und stille Überzeugungen bei den Fachleuten, sind es politische, wirtschaftliche, ableistische oder gar rassistische Gründe, die den faktischen Ausschluss einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung bewirken? Ernüchternd ist die Einschätzung von E. Simonoff (2005) im obigen Leitzitat, die manche Vermutungen zu bestätigen scheint.
Mit der Veröffentlichung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihrer Ratifizierung in Deutschland 2009 wurden die diesbezüglichen Widersprüche sicher deutlicher. Auch gibt es regional in kleinen Zirkeln »best practice«-Versorgungsstrukturen, aber es gibt nicht den Mainstream in den Fachgemeinden, die die eigenen Verlautbarungen wirklich umsetzen wollen. Erst 2019 wurde gesetzlich festgeschrieben, dass Psychotherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung eine Kassenleistung ist.
Auch das neue Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG vom 23.12.2016) hat bisher und wohl auch zukünftig (es tritt erst am 2024 vollumfänglich in Kraft) die eklatante Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen nicht aufgehoben. Vor dem Gesetz sind nicht Alle gleich: Es gibt behinderte Kinder- und Jugendliche, für die das Eingliederungshilferecht zuständig ist, und nicht behinderte Kinder und Jugendliche, für die die Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist. Inhaltlich, leistungsrechtlich und strukturell bestehen gravierende Unterschiede und es steht zu befürchten, dass sich daran zukünftig nichts Grundlegendes ändern wird.
Im Oktober 2020 wurde der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) den Verbänden zur Anhörung vorgelegt. Eine Einarbeitung in dieses Buch war zeitlich nicht mehr möglich. Mit dem Gesetz soll endlich die o. g. Ungleichbehandlung aufgehoben werden, allerdings frühestens Ende der 2020er Dekade. Neben der einhelligen Begrüßung der Initiative von den Behindertenverbänden (»Meilenstein«, so die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.) werden bereits erhebliche Kritiken und Problemanzeigen laut, die hier nicht nachgezeichnet werden können (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 2020 und Fachverbände für Menschen mit Behinderung 2020).