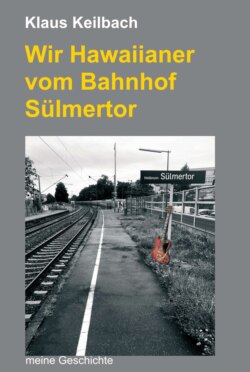Читать книгу Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor - Klaus Keilbach - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1968
WIEDERSEHEN IN DER WARTBERGSCHULE
Das Gymnasium hatte sich somit erledigt und ab dem September 1968 besuchte ich die Wartbergschule, keine zwei Kilometer vom Industriegebiet entfernt. Glücklicherweise war ich nicht der einzige, ausgestoßene Geächtete. Mit einer ganzen Handvoll meiner früheren Klassenkameraden gab es ein fröhliches Wiedersehen. Darunter auch Zapf, der in meiner Parallelklasse landete. Und ich traf einige meiner Kindergartenkumpels wieder und fand mich so im verwegensten Sauhaufen der ganzen Schule wieder. Mit Bernhard E (Elle)., Rolf N. (Nonne) und Rüdiger (Hankes) H. war Langeweile ausgeschlossen. Bernhard (Webse) W., der aus der Realschule geflogen war wurde mein Nebensitzer. Webse war schon im Kindergarten ein unverbesserlicher Spaßvogel gewesen, sodass es mir in dieser neuen Situation schwerfiel, die Lage so ernst zu nehmen wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Alles erinnerte eher an den Beginn einer fidelen Party. Unser Lehrer hieß Laichert und war noch aus altem Holz geschnitzt. Er war schon weit über fünfundsechzig Jahre alt und bei allen Schülern gefürchtet, die ihn schon kennengelernt hatten. Laichert hatte nur aus Gründen des damals herrschenden Lehrermangels noch einige Jahre drangehängt. Gleich am ersten Tag hielt er eine eindrucksvolle und furchterregende Antrittsrede und da der Anteil an „Hawaiianern“ in unserer Klasse ziemlich hoch war, versah er uns zur besseren Unterscheidung vom Rest der Klasse gleich mit dem Begriff: „fünfte Kolonne“. Da er genug Erfahrung mit Jugendlichen „rechts vom Sülmertor“ hatte, versicherte er uns, sich auf keine unnützen Diskussionen einzulassen und drohte uns, dass er auch notfalls vor Handgreiflichkeiten nicht zurückschrecken werde. Dabei klatschte er unaufhörlich mit einem fingerdicken achtzig Zentimeter langen Bambusstock gegen seine Wade, um seine Drohung zu unterstreichen. Er versicherte zudem, den Damen unserer gemischten Klasse dieselbe Behandlung zukommen zu lassen, falls sie Ärger machen sollten. Diese zogen bei diesem Versprechen reflexartig das Genick ein und starrten angsterfüllt auf den Schlagstock. Die meisten Schüler litten plötzlich an einem kollektiven schlechten Gewissen. Außer einigen meiner früheren Kindergarten Freunde, denen diese Hasspredigt wohl am ehesten galt. Elle hatte sogar ein höhnisches Grinsen im Gesicht, was mir signalisierte, dass wohl mächtig spannende Zeiten bevorstanden. Nach der frustrierend langweiligen Gymnasialzeit also genau die richtige Abwechslung.
Auch wenn sich meine neue Schule nicht unbedingt in einem Nobelviertel befand, ließ man uns Hawaiianer doch spüren, dass wir von „jenseits der Bahngleise“ stammten. Diese trennten das Wohngebiet unterhalb des Wartbergs vom Heilbronner Industriegebiet, das im Volksmund „Hawaii“ genannt wurde. Woher dieser Begriff kommt weiß niemand mehr so genau. Es kursieren eine Menge Gerüchte um diese Gegend. So sollte hier im Mittelalter der Pestfriedhof gewesen sein. Aber den Namen gab man dem Stadtviertel sicher erst nach dem Krieg, als sich hier am Stadtrand, in den noch einigermaßen heil gebliebenen Wohnblocks, die hier stationierten amerikanischen Soldaten mit den, an Männermangel leidenden Frauen vergnügten. Normale Bürger zogen es vor, um dieses Viertel einen großen Bogen zu machen. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. Die berüchtigste Straße lag direkt an der Bahnlinie zwischen Heilbronn und Neckarsulm. Hier in der „Christophstraße“ wohnten Zapf, Elle, Hankes, Webse und Rolf. Die Wohnungen in den kasernenartigen Blocks waren ohne Bad oder Dusche und hatten in der Regel zwei Zimmer. Geheizt wurde noch mit Holz und Kohle. In der Küche gab es über dem Herd eine Gasuhr, in die man bei Bedarf - wie in einen Zigarettenautomaten - eine Münze einwarf. Erst dann ließ sich der Herd in Betrieb nehmen. So versuchte man zu vermeiden, säumigen Kunden auf die Pelle rücken zu müssen.
Dagegen wohnte ich zwei Straßenzüge entfernt, geradezu in Saus und Braus. In drei Zimmern, mit Bad und einem Balkon, mit Blick auf die Gleise der hier verkehrenden Industriebahn, einer stark befahrenen Kreuzung auf der es regelmäßig krachte, einem Kiosk und einer stillgelegten Bunkeranlage aus dem zweiten Weltkrieg. Von unserem Balkon aus genoss ich eine grandiose Aussicht auf den Gehweg vor der Kneipe im Erdgeschoss unseres Hauses. Hier gab es immer wieder ein riesen Spektakel, wenn gegen Ende des Monats die frustrierten Fabrikarbeiter ihren Lohn auf den Kopf hauten und sich im Suff an die Gurgel gingen. Vor allem in den Sommermonaten, wenn sich das Leben meist im Freien abspielte, ging hier mächtig die Post ab.
ELKE
In dem Haus in der Salzstraße, wo ich geboren wurde und aufwuchs, wohnte auf derselben Etage, Tür an Tür, meine Freundin Elke. Ich war etwa fünf Jahre alt, als sie mit ihren Eltern und ihrer drei Jahre älteren Schwester Margit einzog. Zuerst war ich regelrecht empört über die Tatsache, dass ich ausgerechnet mit zwei Mädchen das Stockwerk teilen sollte, aber wir wurden schnell Freunde. Nur wenig später wurde Elke in meine Kindergartengruppe gesteckt. Da sie ein Jahr jünger war als ich verteidigte ich unseren „Neuling“ gegen sämtliche Angriffe – auch gegen solche, die ich mir nur einbildete, um ihr „Held“ sein zu dürfen. Wir hatten beide dieselben blauen Augen, die gleiche Haarfarbe und waren unzertrennlich, sodass man uns bald für Geschwister hielt. Als ich eingeschult wurde, ließ ich es mir nicht nehmen, Elke regelmäßig vom Kindergarten abzuholen. Schließlich war ich schon „erwachsen“ und hatte bei der gefährlichen Verkehrslage den besseren Überblick. Es war so gut wie sicher, dass wir später auch heiraten würden, was nur ihre Schwester Margit verhindern konnte, die ab und zu Besitzansprüche an mich stellte. Dann ergriff sie urplötzlich die Initiative, zerrte mich in eine Ecke und presste mich gegen die Wand, um mir einen Kuss zu verpassen, was Elke im Gegensatz zu mir, erstaunlich gelassen ertrug. Außerdem offenbarte mir Margit als erstes Mädchen ihre sprießenden Brüste, während wir auf einem Apfelbaum in ihrem Garten saßen. Mit fünfzehn verliebte sich Margit in den Commander Cliff Allister Mc Lane (Dietmar Schönherr) vom Raumschiff Orion. Um ihm aufzulauern, riss sie von zu Hause aus und verursachte so ein unglaubliches Theater, bis die Polizei sie wieder eingefangen hatte. Seitdem war ich aus dem Spiel und konnte mich mit Elke ungestört unseren kleinen harmlosen sexuellen „Mutproben“ widmen. Als Elke die Realschule besuchte ging ihre Liebe sogar soweit, dass sie mich mit ihren Klassenkameradinnen verkuppelte.
Die Rückfallquote von uns Hawaiianern von der höheren Schule zurück in die Hauptschule lag bei annähernd 100%. Schnell hatte uns das Establishment wieder auf die für uns vorgesehenen Plätze verwiesen. Mit Müh und Not hatten wir es geschafft uns zwei, drei Jahre lang im Haifischbecken über Wasser zu halten. Nun spielten solche Klassenunterschiede keine Rolle mehr. Immerhin genossen wir, dank Laicherts Titulierung, als „fünfte Kolonne“ eine Menge Respekt in unserer Schule. Das große Maul von Elle sorgte von vornherein für zusätzliche Unruhe, da er mit Drohungen und mit den Fäusten ausgetragenen Auseinandersetzungen nicht hinterm Berg hielt. Es dauerte nicht lange bis an unserer Schule die Polizei aufkreuzte, weil Elle unter Verdacht stand, einige Zigarettenautomaten geknackt zu haben. Der erste, der es schaffte sogar von dieser Schule zu fliegen, war Uli Scheler. Er hatte unsere jüngste Lehrerin Frau Kögel in der Pause auf dem Schulhof sexuell belästigt. Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch keine sechs Wochen auf dieser Schule und wir waren gerade mal zwölfjährige Siebtklässler.
1969
Obwohl ich Elle für einen elenden Aufschneider hielt, wurde er zu einem meiner engsten Freunde. Er prahlte damit, eine Gitarre zu besitzen und schon in einer „Beat Band“ gespielt zu haben. Ich bezweifelte seine Worte, trotzdem war ich neugierig geworden. Um selbst eine Band zu gründen brauchte ich jemanden der ein Instrument spielt. Mit Zapf hatte ich noch keinen Kontakt aufgenommen, da er die Parallelklasse besuchte. Ob er noch Gitarre spielte wusste ich nicht. Zu Weihnachten bekam ich von meinen Eltern einen Plattenspieler geschenkt. Ich kaufte mir ein Album von Esther und Abi Ofarim das mit „Morning Of My Live“ eines meiner Lieblingslieder enthielt. In einem heruntergekommenen Supermarkt in unserer Nachbarschaft kaufte ich mir einige verbilligte Singles für eine Mark pro Stück von „Petulla Clark“ und dem deutschen Schlagerstar „Alexandra“. Elle prahlte stattdessen von seiner eigenen Plattensammlung, die er sich angeblich im größten Heilbronner Kaufhaus zusammengeklaut hatte. Diese Behauptung glaubte ich ihm sofort. Tatsächlich brachte er am nächsten Tag, wie versprochen, eine ganze Ladung Singles mit in die Schule und verlangte pro Stück fünfzig Pfennig. Ein unschlagbarer Preis für „Dave Dee“, „Manfred Man“ und „Bee Gees“ Schallplatten. Einer meiner Lieblingssongs war „Yummy, Yummy, Yummy“ vom „Ohio Express“, den ich versuchte, mir selbst auf der Gitarre beizubringen. Nicht sofort erfolgreich, aber mit mehr Spaß als mir die Klimperei im Gitarrenunterricht bereitete. Mein Gitarrenlehrer war so alt wie die Pyramiden, und die Übungsstücke, die er mir von Woche zu Woche aufgab, hatten mindestens genauso viele Jahre auf dem Buckel. Immer öfter ließ ich den Unterricht ausfallen, bis meine Eltern von der Musikschule über meine Fehlzeiten informiert wurden. Um weitere unnötige Überweisungen zu vermeiden, kündigten sie zu meiner Freude den Unterricht. Mein neuer Lehrer war der Plattenspieler.
THE SKYSCRAPERS
Durch die gestohlenen Schallplatten waren sich Elle und ich schnell nähergekommen. Auf meinen zaghaften Vorschlag, ob er sich vorstellen könne eine Band zu gründen, reagierte er mit seiner typischen Hochnäsigkeit. Er bot mir „großzügig“ an, ihn zu Hause zu besuchen, wo er mir bei dieser Gelegenheit gleich einige Tricks beibringen werde. Ich ging auf sein Angebot ein und wenige Tage später stand ich nervös, mit meiner Gitarre unterm Arm bei Elle, im Zentrum vom Hawaii, nahe des Christophplatzes. Zu meiner Überraschung saß das ganze Wohnzimmer voll, mit einigen unserer Klassenkameraden und anderen Nachbarjungs. Webse war da, Zapf und Hankes. Die ganze Bude war total verqualmt und ich fragte mich, ob hier gerade die Beute von Elles Automaten-Raubzügen verpafft wird. Elle besaß ebenfalls eine Sunburst Wandergitarre, die er einfachheitshalber auf einen offenen E-Dur Akkord gestimmt hatte. Um gleich mal ordentlich Eindruck zu schinden, zeigte er mir und den anderen Neugierigen siegessicher, mit einer lässig im Mundwinkel hängenden Zigarette und daher tränenden Augen seinen einzigen Trick, den er auf Lager hatte. Dazu legte er seinen Zeigefinger über alle sechs Saiten und rutschte damit, je nach vermuteter Tonhöhe, auf dem Gitarrenhals rauf und runter. Das Lied, das er uns vorspielte hieß „Meine Puppe“ von Michel Polnareff, einem französischen Popsänger. Mit dem Original hatte die „Einfinger-Version“ von Elle wenig zu tun. Dies hörte ich sofort als er mir die Single vorspielte. Jetzt schlug meine große Stunde. Ich hatte den riesigen Dusel, dass dieser Song aus lediglich drei Akkorden bestand, die ich ziemlich schnell gefunden hatte. Ohne ihn vor der ganzen Mannschaft bloßzustellen, schlug ich ihm meine Spielweise vor und registrierte zufrieden die erstaunten Gesichter der paffenden Meute. Selbst Elle musste anerkennen, dass ich auf Anhieb die richtige Version des Liedes gefunden hatte. Erstaunlich kleinlaut gab er sich geschlagen. Auf dem Heimweg wurde mir bewusst, dass es mir, als schüchternem Ex-Oberschüler, in der Höhle des Löwen, ohne große Anstrengung gelungen war, Elle den Rang abzulaufen. In der Hierarchie, in der er sicher der Leitwolf war, hatte ich mit ihm gleichgezogen. An diesem Nachmittag gründete ich mit Elle meine erste Band. Als zusätzlichen Sänger engagierten wir Webse, weil er uns versicherte, selbst bald eine Gitarre zu kaufen.
Wir trafen uns jetzt so oft wir konnten im Wohnzimmer von Elle. Auch Zapf tauchte immer wieder auf, da er gerade mal um die Ecke wohnte. Ich befürchtete, dass es sicher irgendwann Ärger mit der Mutter von Elle geben würde, die regelmäßig am frühen Nachmittag von der Frühschicht in einer Briefhüllen-Fabrik nach Hause kam. Doch statt uns wegen der verrauchten Bude die Hölle heiß zu machen, schien sie eher froh zu sein, ab und zu eine Zigarette bei uns abstauben zu können. Meist verzog sie sich dann in die Küche, bis wir wieder verschwanden. Bei unseren Proben stellten wir uns im Wohnzimmer auf, als wären wir auf einer Bühne bei einem Auftritt, genauso wie wir es im Beat-Club schon unzählige Male beobachtet hatten. Webse bearbeitete mit Kochlöffeln die Sofakissen und schlug den Takt zu „Gloryland" von den Lords oder „Yummy, Yummy“. Elle schmetterte dazu skrupellos und mit größter Selbstverständlichkeit absolut sinnfreie englisch klingende Textbrocken, die höchstens im Refrain eine gewisse Ähnlichkeit mit den originalen Versen hatten.
Wochenlang ging alles gut und wir hatten schon eine ganze Handvoll Songs beieinander, bis eines nachmittags überraschend der Vater von Elle auftauchte. Laut Elle arbeitete sein Vater als „Scheißhausleerer“ und hatte wohl an diesem Tag ein wenig zu früh den Wasserschlauch beiseitegelegt. Er drohte uns damit, uns auf der Stelle den Kragen umzudrehen, falls wir nicht sofort aus seiner Wohnung verschwinden würden. Es war ihm anzusehen, dass er seine Drohung wahrmachen würde. Wir machten, dass wir Land gewannen. Elle kassierte eine ordentliche Tracht Prügel und sah am nächsten Tag aus, als hätte er einen Zahnarztbesuch mit einem ernsthaften Eingriff hinter sich. Er kommentierte diese offensichtliche Schmach mit der grimmigen Bemerkung, „es seinem Alten diesmal ordentlich besorgt zu haben!“
KONFIRMATION
Webse schlug vor, in der Gartenhütte seiner Eltern in einer Kleingartenanlage im Hawaii weiter zu üben. Vermutlich auch, um sich seinen Platz in der Band zu sichern. Nach zwei Proben gab es Ärger mit dem Garten-Nachbarn, der steif und fest behauptete seine Hühner würden wegen unserem „Gejaule“ keine Eier mehr legen. Nach einer Übergangszeit als „Schlagzeuger“ war Webse dann tatsächlich Besitzer einer Framus-Schlaggitarre geworden. Solange hatte er auf Waschmittel-Trommeln aus Pappe - die wir mit Bravo-Postern beklebt hatten - den Rhythmus geschlagen. Erstaunlich schnell hatte er sich auf der Gitarre die wichtigsten Griffe beigebracht und ersetzte Elle immer wieder dann, wenn dieser während der Probe mit seiner „Flamme“ herumknutschte, die er vor kurzem im Konfirmanden-Unterricht kennen gelernt hatte. Durch diesen Unterricht, der einmal wöchentlich mittwochs stattfand, hatten wir schließlich eine neue Probemöglichkeit gefunden. Die Gemeindehelferin Fräulein Minke gestattete uns, jeweils nach dem Konfirmanden-Unterricht den Gemeindesaal für unsere musikalischen Aktivitäten zu nutzen. Dies garantierte uns regelmäßig ein gutes Dutzend an Zuhörern und somit auch die ersten weiblichen Verehrerinnen. Ich hatte das unverschämte Glück, dass sich die mit Abstand Hübscheste der Mädels für mich interessierte und bald war Claudia „meine Freundin“. Elle wechselte von Ulrike zu Angela und Webse machte sich ausgerechnet an das körperlich reifste und größte der Mädchen heran. Brigitte war fast einen Kopf größer als ich, während Webse, der Kleinste von uns, ihr gerade mal bis zur stattlichen Brust reichte. Sein Erfolg war daher eher bescheiden. Jetzt hatte ich meinen Traum verwirklicht – ich hatte mit meinen Freunden eine Band gegründet und hatte ein wirklich bezauberndes Mädchen erobert. Die Schule hatte sich somit endgültig erledigt. Meine Noten schossen in schwindelerregende Höhen und mein Gewissen betäubte ich mit Tagträumereien über Claudia und der Tatsache, dass ich sowieso ein berühmter und gefeierter Rockmusiker werden würde.
Außer der Schule hielt uns jetzt auch noch der lästige Konfirmanden-Unterricht in Atem. Pfarrer Herrenkind sorgte an zwei Tagen in der Woche dafür, höchste Vorsicht walten zu lassen. Herrenkind hatte mich getauft und sollte uns in wenigen Monaten konfirmieren. Jeden Mittwoch gab es den von ihm zelebrierten Konfirmanden-Unterricht und sonntags zwang uns ein Stempelkärtchen in den Gottesdienst, was uns am frühen Morgen aus dem Bett riss. Es hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass es mit der Konfirmation Essig sei, sollte man zu wenige Stempel auf seiner Karte haben. Außer der Blamage bedeutete dies, auf den erwarteten Geldsegen und die Geschenke verzichten zu müssen.
Der Pfarrer war ein Mann wie ein Orkan. Vor ihm kapitulierte sogar Elle. Vor allem war Herrenkind unberechenbar. Entweder erschien er ordentlich besoffen zum Unterricht, war bestens gelaunt und ließ uns in Ruhe - oder er war nüchtern und ungenießbar. Dann gab es nichts zu lachen. Er ließ uns Verse aus der Bibel zitieren und machte jeden fertig, der die Strophen nicht fehlerfrei herunterrasselte. Man wollte lieber tot sein, als von ihm aufgerufen zu werden. Hatte er sich besinnungslos gesoffen, übernahm die Gemeindehelferin Fräulein Minke den Unterricht. Fräulein Minke sah genauso aus, wie sie hieß. Sie war eine Frau in mittlerem Alter und wir waren uns sicher, dass sie noch Jungfrau war, obwohl sie uns immer wieder einen Einblick in ihr tiefgeschnittenes Dekolletee gewährte. Minke organisierte den Kindergottesdienst, leitete die Jungschar und war Herrenkinds rechte Hand. Bei unseren ersten Partys im Tischtennisraum des Gemeindehauses achtete sie peinlichst darauf, dass das Licht nicht zu dunkel und die Musik nicht zu langsam war. Stattdessen versuchte sie mühsam, uns mit Spielen wie „Faul-Ei“ oder „Sitz-Fußball“ von unserer Pubertät abzulenken. Misstrauisch beäugte sie selbst harmloseste Annäherungsversuche, um bei geringstem Verdacht sofort „deeskalierend“ einzugreifen. Eines Tages beobachteten wir vor dem Unterricht wie Herrenkind ziemlich angeschlagen auf das Gemeindehaus zutorkelte. Jetzt hatten wir das Gefühl, ihm endlich mal - ohne großes Risiko - eins auswischen zu können. Bevor er den Saal betrat, deponierten wir eine Handvoll Reißnägel auf seinem Stuhl. Fast gleichzeitig verließ uns der Mut, allerdings zu spät um die Sache rückgängig zu machen. Wir waren ziemlich sicher, dass wir einen riesigen Fehler begangen hatten. Als Herrenkind den Raum betrat, hatte ich das Gefühl keine Luft mehr zu kriegen und musste plötzlich fürchterlich aufs Klo. Elle versuchte vergeblich den Ahnungslosen zu spielen und einen unbeteiligten Gesichtsausdruck vorzutäuschen. Dabei sah er aus, als hätte er gerade einen Schlaganfall bekommen. Einige der Mädels hatten Tränen in den Augen und wünschten uns sicher die Pest an den Hals. Zum Glück blieben die Reißnägel von Herrenkind (warum auch immer) unbemerkt, aber wir bekamen so im „Religionsunterricht“ nun doch eine ungefähre Vorstellung davon, wie es in der Hölle sein musste.
Eindrucksvoll und berüchtigt waren auch die legendären Sonntagvormittag Auftritte in der nur spärlich besetzten Kirche. Bei genügend Pegel redete sich Herrenkind in Rage und ließ ein dramatisches Schauspiel vom Stapel. Selbst wenn er mit der riesigen Bibel in den Armen noch so bedenklich schwankte, gelang es ihm immer, auf den Beinen zu bleiben. Ich erstarrte entweder vor Ehrfurcht oder ich versuchte krampfhaft einen Lachanfall zu unterdrücken.
AUFTRITT
Genau eine Woche vor unserer Konfirmation spielten wir unseren ersten Auftritt. Webse, der vor kurzem mit seiner Mutter aus dem Hawaii weggezogen war, hatte den Gig an Land gezogen. In seiner neuen Clique gab es eine Party und er hatte uns als Band vorgeschlagen. Beim Bandnamen hatten wir uns schon einige Wochen zuvor auf SKYSCRAPERS geeinigt. Die Party fand in einem stinkenden Heizraum im Keller, unter genau der Gaststätte statt, in der am nächsten Sonntag meine Konfirmation gefeiert werden sollte. Es gab lediglich einige Stühle und einen Plattenspieler, auf dem ohne Unterbrechung der Song von Jane Birkins und Serge Gainsbourgs aktuellem Hit „Je t`aime…moi non plus“ lief. Das stahl uns mächtig die Show. Da nützten auch unsere, für den Auftritt extra übergestreiften, dunkelblauen Rollkragen Pullis nichts. Unsere Vorstellung schien niemanden sonderlich zu interessieren. Die Gäste waren einzig und allein scharf darauf, zu der Musik aus der Konserve Blues zu tanzen und nachdem mich Elle schon einige mal ungeduldig aufgefordert hatte, den gehörigen „Frauenüberschuss“ zu nutzen, tanzte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Blues im Stehen. Mit einem blonden Mädchen, das gut einen Kopf größer war als ich. Wegen Claudia brauchte ich keine Gewissensbisse zu haben. Unsere Beziehung war ins Leere gelaufen. Wir waren beide zu jung und zu unerfahren um die Vorzüge unserer Freundschaft auszukosten. Die intimste Situation die uns vergönnt war, war im Freibad auf einem Teppich zu liegen und zusammen Mickey Maus Hefte zu lesen.
Relativ gering war der Erfolg der kirchlich religiösen Gehirnwäsche, die uns zu gläubigen Christen machen sollte. Wir pickten uns nur die „Rosinen“ aus der Prozedur. Es gab eine Menge (auch unnützer) Geschenke zur Konfirmation und einen nicht zu verachtenden Betrag an Bargeld. Und einige Tage nach dem Fest einen Ausflug der uns nach Speyer führte. Mit an Bord des Omnibusses war das stets wachsame Fräulein Minke und ein ungewöhnlich gut gelaunter Pfarrer Herrenkind. Etwas unangenehm war allerdings die kurvenreiche Busfahrt, bei der ich vergeblich gegen die Übelkeit ankämpfte und kurzerhand in das Schallloch meiner Framus Wandergitarre kotzte. Wir gönnten uns nach der Ankunft in der Stadt eine Besichtigung des Doms während der ich mit Elle, Webse und drei Mädels das Weite suchte. Verborgen vor Fräulein Minkes misstrauischen Blicken orderten wir in einem Supermarkt Zigaretten und ein stimmungsförderndes Getränk. Es dauerte nicht lange bis Webse so gute Laune hatte, dass er sich in Folge eines Lachkrampfes die Hosen verpinkelte. Der ungewöhnlich kalte Märztag sorgte für den interessanten physikalischen Effekt, bei dem sich Wasser in Dampf verwandelt. Webses Jeans "rauchte" als hätte seine Hose Feuer gefangen. Immerhin ermöglichte mir der Geldsegen der Verwandtschaft den Kauf einer qualitativ besseren Akustikgitarre, der ich erst mal einen Satz Stahlsaiten verpasste. Die eigentlich vorgesehenen Nylon-Strings waren mir viel zu leise. Dass ich dadurch die Gitarre ruinieren könnte wusste ich damals nicht. Das neue Instrument kam gerade zur richtigen Zeit, da meine Framus nicht mehr lange zu leben hatte. Meine ständige Klimperei, auf einem von den beiden Instrumenten, brachte meinen Vater beinahe um den Verstand und eines Abends brannten ihm sämtliche Sicherungen durch. Er verpasste meiner Framus-Gitarre, die neben mir auf dem Boden lag, einen herzhaften Fußtritt, der ihr das Kreuz brach. Natürlich bereute er seinen Ausraster schon im selben Moment, aber tief verletzt lehnte ich den angebotenen Hundert-Mark-Schein grimmig ab und kostete mein Selbstmitleid voll aus. Trotz der schlimmen Beschädigung versuchte ich das ramponierte Instrument zusammen zu flicken. Es gelang mir somit immerhin noch das eierige Riff von „Satisfaction“ darauf zu spielen. Auf dieser Gitarre klang dies genau so schief und gemein, wie in dem „Stones“ Konzertfilm vom Hyde Park, den ich kurz zuvor im Fernsehen gesehen hatte. Zum ersten Mal „sah“ ich meine Idole, von denen ich bisher nur das „Theire Santanic…“ und „Beggars Banquet“ Album kannte. Der Auftritt der Stones war miserabel. Und trotzdem zogen mich die archaischen Klänge in ihren Bann. Die bluesig, wimmernden, aber zuckersüßen Töne von Mick Taylors Gitarre und die bellende, wohlig röchelnde Mundharmonika Jaggers im Vorspann des Films lösten ein eigenartiges Gefühl in mir aus. Die Tatsache, dass hier eine Band, ohne mit der Wimper zu zucken, mehr schlecht als recht und mit verstimmten Gitarren einen Gig vor 250.000 Leuten abzog, imponierte mir ungemein. Dies war ein erreichbares, realistisches Ziel. Drei Akkorde, schlampig gespielt, reichten also aus, um ganz schön auf den Putz zu hauen.
Wir hatten Dusel, dass ausgerechnet jetzt gerade ein Nachbar von Elle und Webse, namens „Gagge“ sein gebrauchtes Schlagzeug loswerden wollte. Er wollte für das sperrmüllreife Set 80 Mark. Wir kratzten unser restliches „Konfisgeld“ zusammen und schlugen zu, obwohl wir noch keine Ahnung hatten, wer den Job des Drummers übernehmen sollte. Das Schlagzeug bestand aus einer Bass drum, einer Snare, einem Hänge Tom und Stand Tom, Hi-Hatt und zwei Becken, deren Durchmesser nicht größer war als eine Langspielplatte. Wir trugen sämtliche Einzelteile durchs Hawaii bis zur Aukirche, wo wir Fräulein Minke, die dem Nervenzusammenbruch nahe war, vor vollendete Tatsachen stellten. In ihrer Not verlegte sie unseren bisherigen „Proberaum“ vom Gemeindesaal im ersten Stock, wegen des zu erwartenden Lärms in den Keller. Hier gab es, angrenzend an den Tischtennisraum einen Flur, in dem jede Menge Gerümpel, wie z.B. alte Schränke, Regale und Stühle gelagert wurden. Wir schaufelten uns eine Ecke frei und bauten mitten in diesem Durcheinander das Schlagzeug auf. Außerdem verlegte Minke die Übungszeiten auf den späten Nachmittag. Damit konnten wir leben. In einer Blitzaktion ermittelten wir in Form eines Wettbewerbs unseren zukünftigen Trommler. In Frage kamen eh nur Elle oder Webse. Als Testlied einigten wir uns auf den „Gin House Blues“. Ein Song, den ich von einer „Animals“ Platte kannte. Noch bevor Webse sich überhaupt hinters Schlagzeug gesetzt hatte war klar, wer das Rennen machen würde. Elle war der erste Kandidat und zeigte ungefähr so viel Taktgefühl für den simplen Blues, wie er Tricks auf der Gitarre für mich parat gehabt hatte. Webse setzte den Snareschlag schon mal an die richtige Stelle. Damit war schnell entschieden, dass er den Job sicher hatte.
Schon bei der ersten Probe realisierten wir, dass unsere Akustikgitarren keine Chance gegen das Drum hatten. Obwohl es nur ein kleines Set war, prügelten wir mächtig auf unsere Instrumente ein, ohne eine Chance gegen das Schlagzeug zu haben. Immer wieder gab es Krach zwischen Elle und Webse. Es machte Elle rasend, dass er kaum noch zu hören war. Sicher haderte er auch noch mit der blamablen „Niederlage“ bei unserem Schlagzeug - Casting.
MEINE ERSTE E-GITARRE
Und wieder war es Zapf, der neue Fakten schuf. Er lud mich, ohne einen Grund zu nennen, zu sich nach Hause ein, um mir dort seine neue elektrische Gitarre unter die Nase zu halten. Es war eine wunderschöne, weinrote Framus mit zwei Tonabnehmern. Er stöpselte sie mit einem modifizierten Kabel in ein Kofferradio ein und zeigte mir stolz das Intro von Jimi Hendrix „Burning Down The Midnight Lamp“. Laut Zapf „nur auf einer "Elektrischen“ spielbar. Dass die exotischen Klänge des Intros von einer Sitar gespielt wurden, erfuhren wir erst Jahre später. Es dauerte nicht mehr lange und Elle schlug ebenfalls zu. Er bestellte sich eine Kaufhaus Gitarre aus dem Katalog. Diese hatte drei Tonabnehmer und einen Tremolo Arm. In Sunburst. Dazu organisierte er sich ein altes Saba Röhrenradio und konnte jetzt doch immerhin auch schon eine Menge Lärm machen.
Es wurde Zeit, dass ich meinem Vater nun endlich die Gelegenheit bot, unsere noch offene Rechnung zu begleichen. Dazu nutzte ich die entspannte Atmosphäre einer warmen Julinacht. Es gab das jährlich stattfindende Sommernachtsfest der „Hasenfarm“. Hier traf sich das ganze Hawaii, um ordentlich einen drauf zu machen. Im Vorgarten vor der Gaststätte, in der der Vater meines Klassenkameraden Lallefatz Regie führte, waren auf der Wiese unter riesigen Apfelbäumen Tische und Bänke aufgebaut. Auf der kleinen Bühne musizierte eine Tanzkapelle, die technisch auf dem neuesten Stand war. Ich wusste um die Vorliebe meines Vaters für gepflegte Tanzmusik, wartete bis er einige „Halbe“ intus hatte und machte ihn immer wieder auf den Gitarristen der Band aufmerksam, der ihm ganz offensichtlich mit jedem weiteren Bier besser gefiel. In regelmäßigen Abständen versuchte ich ihn dabei von der Notwendigkeit einer E-Gitarre zu überzeugen und klärte ihn mit wehmütigem Blick darüber auf, dass ich der Einzige in unserer Band war, der noch mit der Akustikgitarre vergeblich gegen den Lärm der anderen ankämpfen musste. Je später es wurde umso größer wurde die Aussicht auf einen Erfolg meiner Mission. Sicherlich sah mein Vater auch endlich eine Chance seinen „Ausraster“ wieder gut zu machen. Und irgendwann in dieser lauen Sommernacht versicherte er mir, sich die Sache durch den Kopf gehen zu lassen.
Zwei Tage später machten sich Elle, Zapf, Webse, meine Eltern und ich auf den Weg in die HNer City. Dort gab es in einer schmalen Seitenstraße ein kleines, unscheinbares Musikgeschäft. Der winzige Laden war sofort brechend voll als wir dort alle einliefen. Im Schaufenster bewunderte ich schon seit Wochen eine Elektrogitarre für 220 Mark. Der Korpus des Instruments war mit rotem Kunstleder überzogen und nun durfte ich das Objekt meiner Begierde in der Hand halten und testen. Außer dieser „Ledergitarre“ gab es noch eine Framus-Gitarre in Sunburst, die der Verkäufer als qualitativ hochwertiger anpries. Sie kostete allerdings einige Mark mehr und als ich meinen Vater fragend anschaute, nickte er mir großzügig zu. Nun waren wir wieder quitt und ich verließ das Musikgeschäft mit der elektrischen Framus Gitarre. Sie besaß zwei Tonabnehmer und einen Tremolo Arm. Außerdem bekam ich vom Verkäufer ein Kabel, an das er einen dreipoligen Stecker lötete, sodass ich die Gitarre in ein Radio einstöpseln konnte. Schon am nächsten Tag stand Zapf mit seiner Gitarre und dem gerade erschienenen Stones Album „Let it Bleed“ im Gepäck vor der Tür und wir versuchten das Riff von „Gimmie Shelter“ herauszufinden. Das gelang uns nur, nachdem wir unsere Instrumente drei Halbtöne höher gestimmt hatten. Die Folge war ein immenser Verbrauch an Saiten und die erstaunten Blicke des Verkäufers in dem kleinen Musikgeschäft, den wir jetzt gezwungenermaßen täglich aufsuchten.
Mit der Schule ging es indessen weiter bergab, während gleichzeitig die Zensuren in schwindelerregende Höhen kletterten. Es war schon mal ein Wunder, wenn wir es überhaupt schafften in der Schule aufzukreuzen. Der kleine Bäckerladen, wenige Meter von der Schule entfernt, nahm uns nicht selten den Wind aus den Segeln. Hier trafen wir uns jeden Morgen, um anhand unserer finanziellen Lage erst mal zu prüfen, ob es überhaupt Sinn machte, sich von Laichert schikanieren zu lassen. Unsere sicherste Geldquelle war Karlheinz M., den wir alle „Lallefatz“ nannten. Seine Eltern waren die Pächter der Gaststätte des Kleintierzüchter-Vereins im Hawaii, im Volksmund „Hasenfarm“ genannt. Lallefatz plünderte regelmäßig die Kasse der Hasenfreunde und wir hauten das Geld beim Schulbäcker auf den Kopf. Meist sorgten wir für ein ausgiebiges Frühstück in Form eines riesigen Baguettes, das mit einer zentimeterdicken Schicht aus Leberwurst und Senf belegt war. Danach gab es für jeden einige Zigaretten zur besseren Verdauung. Frisch gestärkt machten wir uns nach dieser Mahlzeit auf den Weg zum Bolzplatz, nicht ohne vorher noch einen Ball in einem Spielwarenladen zu kaufen, den wir nach dem Spiel entweder anderen Kindern schenkten oder ihn einfach ins nächste Gebüsch kickten. Der Bolzplatz war nur einen Steinwurf von unserer Schule entfernt. Allerdings verhinderte ein Bahndamm zwischen Spielplatz und Schule, dass Laichert uns vom Klassenzimmer aus sehen konnte. Bei offenen Fenstern konnte er unser Geschrei aber sicher hören. Auf die erforderlichen Unterschriften der Eltern unter einer schriftlichen Entschuldigung wegen Fernbleiben vom Unterricht, hatten sich Elle und ich spezialisiert. Schnell hatten wir eine traumhafte Routine und Fingerfertigkeit entwickelt. Ich hatte schließlich noch Übung aus meiner Gymnasialzeit. So sicherten wir uns einen lukrativen Nebenverdienst, indem wir unseren Klassenkameraden zwei Mark pro Attest abknöpften. Dafür gab es ein täuschend echt kopiertes Autogramm eines Elternteils. Unsere Einnahmen setzten wir in Schallplatten um. Als wir Hankes ein dreitägiges Fehlen mit einem „akuten Nierenversagen“ attestierten, wurde Laichert zum ersten Mal stutzig und drohte uns damit, dass er sich unsere Eltern vorknöpfen würde. Es war ratsamer den Bogen nicht weiter zu überspannen und wieder auf realistischere Befunde zurück zu greifen.
Zum engsten Kreis unserer Truppe gehörte außer Webse, Elle, Hankes, Lallefatz und Rolf N. noch Hans-Dieter (Zyml) Z. und Roland G. Die Beiden waren die einzigen von den Jungs, die nicht aus dem Hawaii stammten. Zyml verdiente schon deshalb unseren Respekt, weil er so dreist war, acht Wochen am Stück die Schule zu schwänzen und in dieser Zeit hatte er sogar die Polizei an der Nase herumgeführt, die man ihm auf den Hals gehetzt hatte. Zyml wohnte fast fünf Kilometer entfernt in einem anderen, höher gelegenen Stadtteil und schaffte es, von seinem Fenster aus mit einem Fernrohr direkt in unser Klassenzimmer sehen zu können. Bei einem Blick durch seinen Sternengucker konnte ich sogar die auf die Tafel geschriebenen Zahlen erkennen. Lauer war der Frauenheld unserer Klasse und sorgte dafür, einige der Mädels in unseren Dunstkreis zu locken. Karin, Sabine, Andrea, Doris und Sonja sorgten so für die angemessene Frauenquote in der „Fünften Kolonne“. Andrea war die unangefochtene Chefin der Mädchen. Sie verliebte sich fast wöchentlich in einen anderen von uns, machte aber ein Höllenspektakel, wenn man sich an ihr vergriff. Sonja hatte Beine wie Gerd Müller und trug mit Vorliebe die damals angesagten super kurzen Miniröcke. Ihr Hintern war so hart und kantig, dass man Angst hatte, sich an ihm zu stoßen. Doris hingegen bestand aus weichen Kurven und üppigen Brüsten, sodass ich jede Gelegenheit nutzte, ihr an die Titten zu gehen, was ihr ganz offensichtlich recht wenig ausmachte. Von Karin und Sabine ließen wir lieber unsere Finger. Die beiden waren ein, zwei Jahre älter als wir und ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis gab es nur unnötig Ärger. Sie zogen mit Jungs durch die Gegend, die schon ein Motorrad besaßen und belächelten spöttisch unsere eher ungeschickten Annäherungsversuche. So langsam begann ich das Ende der Beziehung mit Claudia zu bedauern. Ich glaubte, jetzt die richtigen Handgriffe gelernt zu haben und startete einen zweiten erfolglosen Anlauf. Ich glaubte, ihr mit einer lässig im Mundwinkel hängenden Zigarette imponieren zu können und trieb mich bei jeder Gelegenheit in der Nähe ihrer Schule herum. Aber entweder ignorierte sie mich oder ich erntete nur ihren mitleidig, hochnäsigen Blick. Ich hatte es wohl doch ziemlich vergeigt.
BUDDY BARABAS
Fast ständig schleiften wir unsere Akustikgitarren mit uns herum. Es bot sich immerhin die Chance in unserem täglichen Treffpunkt, der Bäckerei, für die Inhaberin Frau Walter einige Liedchen zum Besten zu geben. Dafür gab es in der Regel für jeden „Musiker“ einen halben Meter Weißbrot mit Leberwurst und Senf. Vielleicht bekamen wir das Vesper aber auch nur, damit wir mit dem Lärm aufhörten. Um für genügend Aufmerksamkeit zu sorgen, verzichteten wir darauf, die Gitarren in eine Tasche zu stecken. So kam es, dass eines Tages auf unserem Heimweg durch die Unterführung am Vorstadtbahnhof Sülmertor ein ziemlich schriller Vogel auf uns aufmerksam wurde. Ich bemerkte, als er auf uns zulief, dass er ein Bein nachzog und mindestens einen Kopf größer war als ich. Er hatte lange, braune Haare, die bis zu seiner Schulter reichten, trug eine lilafarbene Samthose, deren ruinierter Hosenladen von einem dicken Bindfaden zusammengehalten wurde. Seine braunen Schnürstiefel reichten ihm bis zu den Knien. Über dem roten Rüschenhemd hatte er ein schwarzes Nadelstreifen-Jackett über der Schulter hängen. Er stellte sich als „Buddy Barabas“ vor und bat mich höflich um meine Gitarre. Er unterzog das billige Instrument einer kurzen, aber scheinbar fachmännischen Prüfung, nickte zufrieden, ging in die Hocke und begann einige „Licks“ abzufeuern, die verdammt nach Hendrix klangen. Wir standen mit vor Staunen offenen Mündern um ihn herum und versuchten zu kapieren, was der Typ da eigentlich gerade machte. Selbst wenn uns Gott persönlich gegenübergestanden hätte, wären wir nicht beeindruckter gewesen. Buddy war fünf Jahre älter als wir und verhielt sich uns gegenüber genauso respektvoll, als wären wir so alt wie er. Dies schmeichelte uns ungemein. Als er mir nach einigen Minuten die Gitarre zurückgegeben hatte, lud er mich, Elle, Zapf und Webse zu sich nach Hause ein, um uns seinen Verstärker zu präsentieren. Da er nur wenige Meter vom Schulbäcker entfernt wohnte, verabredeten wir uns auf den nächsten Vormittag.
Buddy wohnte mit seinem Bruder Klaus und seiner Schwester bei seinen Eltern in einer kleinen 3-Zimmer Wohnung. Er teilte sich das Zimmer mit Klaus, der an diesem Vormittag noch im Bett lag und selig schlief. Neben seinem Bett stand eine halbvolle Weinflasche. Klaus war der ältere der Beiden und laut Buddy ein unverbesserlicher Schluckspecht. In dem Raum standen lediglich zwei Betten. Auf einem davon lag Buddys E-Gitarre. Mitten im Zimmer standen zwei riesige Lautsprecher-Boxen übereinander, die mit jeweils vier 12 Zoll Speakern bestückt waren. Auf den Boxen stand das 100 Watt Verstärker-Top-Teil. Der Turm war größer als ich. Buddy schnappte sich seine Gitarre, schaltete den Amp ein und drehte den Lautstärkeregler der Anlage nach rechts. Es dauerte nur wenige Sekunden bis die Röhren des Verstärkers auf Betriebstemperatur waren und sofort war in der kleinen Wohnung die Hölle los. Mit Buddys erstem, völlig unvorbereiteten Schlag auf die Gitarre hatte ich das Gefühl, dass mir jemand einen mächtigen Schlag in die Magengrube verpasst hatte. Außerdem schienen alle Töne gleichzeitig den Weg in meine Gehörgänge zu suchen, wobei sie einen unglaublichen Schmerz auslösten. Klaus, der eben noch friedlich schlummerte, wurde wie an unsichtbaren Fäden, ähnlich einer Marionette nach oben gezogen und erwachte sitzend in seinem Bett. Reflexartig griff er nach seiner Weinflasche und begann gleichzeitig mit unkontrollierter Kopfstimme zu schreien. Der Lärm im Zimmer war unbeschreiblich. Kurz darauf erschienen zuerst Buddys Schwester und sein grinsender Vater auf der Bildfläche, was die zwei Brüder aber nicht aus der Fassung brachte. Erst als die Mutter weinend und um Ruhe flehend im Zimmer stand, hatte Buddy ein Einsehen und brach seine Demonstration ab. Klaus sank auf sein Bett zurück und nickte sofort wieder ein. Im Treppenhaus hatte sich mittlerweile ein großer Teil der Hausgemeinschaft versammelt. Der Mob verlangte kategorisch das Ende des Tumults. Die Ankündigung, dass die Polizei verständigt sei, war für uns der eindeutige Wink, den Schauplatz schleunigst zu räumen. Da wir schon seit Tagen nicht mehr in der Schule aufgetaucht waren, war es nicht ratsam den Bullen über den Weg zu laufen. Halb taub verließen wir Buddys Wohnung. Erst einige Tage später trafen wir ihn beim Schulbäcker wieder und lernten ihn näher kennen. Sein richtiger Name war Eberhardt und seine Eltern stammten aus Ungarn. Das Geld für den „Winston“ Turm hatte er sich durch Auftritte mit seiner Band in den amerikanischen Kasernen zusammengespart. Nun war er gerade ohne Job, nachdem ihn eine Konservenfabrik gefeuert hatte, weil er die riesigen Gurkenfässer in ein Schlagzeug verwandelte und die gesamte Belegschaft mit seinem Getrommel fast in den Wahnsinn trieb. Außer Gitarre spiele er auch vorzüglich Schlagzeug und er sei ein guter Sänger. Diese selbstbewusste Behauptung bewies er sofort an Ort und Stelle, indem er unvermittelt anfing eine kleine Kostprobe seines Könnens zu liefern. Er schrie plötzlich und völlig unerwartet aus vollem Hals irgendwelche Textzeilen in einem einwandfreien Englisch. Zwischen den Gesangsparts imitierte er erstaunlich „zungenfertig“ und taktsicher mit Schnalz- und Zischgeräuschen ein Schlagzeug. Seine Singstimme war eine Mischung aus Eric Burdon, Jimi Hendrix und Paul Rogers. Ich war begeistert – im Gegensatz zur leidgeprüften Nachbarschaft. Als Kind war Buddy an Kinderlähmung erkrankt gewesen. Deshalb auch seine Gehbehinderung. Außerdem war er Analphabet. Buddys Schwester kannten wir eigentlich schon länger. Sie war uns schon öfter beim Schulbäcker aufgefallen, wenn sie dort Zigaretten holte. Auch sie war eine durchaus auffällige Person mit knallrot gefärbten Haaren. Und sie trug stets die Klamotten ihrer Oma. Sie trieb sich entweder mit den hier stationierten amerikanischen GI-Soldaten oder mit ziemlich zwielichtigen Schlägern herum, vor denen vor allem Buddy gehörigen Respekt hatte. Die rasant wechselnden Liebhaber bezeichnete er jeweils als „Schwager“ und er hatte bald eine ordentliche Anzahl von Verwandtschaft beieinander. Das Familienoberhaupt bezog eine kleine Rente und betätigte sich, ausgerüstet mit einem Putzeimer, einer Kehrschaufel und einer ZAHNBÜRSTE als "freiberuflicher“ Straßenkehrer. Klaus ging ebenfalls keiner geregelten Arbeit nach. Er schnorrte sich durch die einschlägigen Kneipen in der City und meistens gelang es ihm auch, sich auf diese Weise einen Rausch anzusaufen. Oft besorgte er sich bei „Aldi“ eine Zwei-Liter-Flasche Lambrusco und schoss sich damit ab. Buddys Mutter sorgte dafür, dass die ganze Gesellschaft nicht völlig im Chaos versank.
Wir schwärmten noch tagelang von Buddys Winston Turm und kämpften weiterhin mit unseren alten Röhrenradios gegen den Lärm von Webses Drum. Ständig lagen wir uns wegen diesem Problem in den Haaren. Vor allem Webse und Elle gingen sich bei jeder Gelegenheit fast an den Kragen. Eines Tages war es dann soweit und die Auseinandersetzung eskalierte. Die Beiden lieferten sich eine handfeste Prügelei im Proberaum. Es war klar, dass Webse gegen Elle keine Chance hatte, allerdings war er auch noch blöd genug, den ungleichen Kampf nicht einfach aufzugeben. Die Schlägerei war erst zu Ende, als Elle ihm zwei Zähne ausgeschlagen hatte. Dies schien das Ende unserer Band zu sein. Webses Mutter beschloss Elle bei der Polizei anzuzeigen und verbot Webse den weiteren Umgang mit uns. Erstaunlicherweise rauften sich die zwei aber wieder zusammen und unser Drummer fuhr jetzt mit seinem Mofa „heimlich“ ins Hawaii, wo wir uns weiter stritten als wäre nichts geschehen.
FREIBAD
Einer der Gründe, weshalb sich die beiden Streithähne wieder so schnell vertrugen war sicher das „Freibad“, wo wir mit den Mädels aus der Schule unsere Nachmittage verbrachten. Wir hatten unsere Proben praktisch ins Freie verlegt. Hier war die Atmosphäre um einiges entspannter als im dunklen Au-Keller. Wir hatten uns ein etwas abseits hinter Büschen gelegenes gemütliches Plätzchen „reserviert“, wo wir unbeobachtet von den übrigen Besuchern unsere Klassenkameradinnen mit Sonnenöl eincremen durften. Unsere Instrumente hatten wir immer dabei und bald scharte sich jeden Tag eine kleine „Szene“ von Musikfreunden und „Gis“ um uns. Einer unserer regelmäßigen Stammgäste war „Bongo“. Er war Zigeuner und wenige Jahre älter als wir. Er tauchte nie ohne seine Mandoline auf. Bongo brachte mir das „Liverpool-Riff“ bei, ohne den ein Chuck Berry Song undenkbar wäre. Dieser Trick, mit dem kleinen Finger der linken Hand gespielt, sorgt dafür, dass „Get Back“ von den Beatles nicht wie ein deutsches Volkslied klingt. Bongo spielte mehrere Instrumente. Außer seiner Mandoline beherrschte er Gitarre, Mundharmonika und einige Blasinstrumente. Herbert (Hebe) Sch. servierte uns ein Lied, das er „Freibad Song“ nannte und das eine enorme Fingerfertigkeit erforderte. Daumen und Zeigefinger rutschten dabei auf der tiefen und hohen E-Saite vom dritten zum siebten Bund. Das war es aber auch schon. Diesem grandiosen Tipp verdankte er, dass sich Dorothea (Dorle) aus unserer Klasse in ihn verliebte, die er einige Jahre später heiratete. Unser Heimweg vom Freibad ins Hawaii führte uns durch eine zwei Kilometer lange Platanen-Allee am Neckar entlang. Auf halber Strecke gab es eine Betonbrücke über den Fluss. Hier legten wir jedes Mal eine kleine Rast ein, um unter der Brücke einige Songs zu jammen. Wir genossen den grandiosen Sound unter dem riesigen Bogen. Man hatte dabei das Gefühl in einer riesigen Halle zu stehen. Manchmal verloren wir bei solchen Sessions vollkommen das Zeitgefühl und spielten bis es dunkel wurde. An einem dieser Abende versammelten sich am Neckarufer entlang, völlig unerwartet, einige Dutzend Schaulustige und wir spielten wie im Rausch bis spät in die Nacht hinein. Wir gaben sicherlich das erste Open-Air Rockkonzert in Heilbronn und zu Hause gab es ein riesiges Theater, ich handelte mir eine Woche Hausarrest ein. Ein weiterer ständiger Reibungspunkt mit meinen Eltern war das leidige Frisör-Thema. Um meine Haare in „angemessenem Rahmen“ zu halten gab es das ungeschriebene Gesetz, einmal monatlich den schwulen Hawaii Frisör Willi Schön aufzusuchen. Dieser bewies wenig Einfühlungsvermögen und achtete während seiner Versuche seiner Kundschaft eine altbewährte Wehrmachtsfrisur zu verpassen vor allem darauf, seinen fetten Ranzen an das jeweilige wehrlose Opfer zu drücken. Ich versuchte die monatliche Prozedur zu umgehen und beauftragte meinen Freund Winne damit, mir anstatt von Willi von ihm einige Millimeter meiner Haarpracht abschneiden zu lassen. Dann versicherte ich meinen Eltern, bei Willi gewesen zu sein, der diesmal eben „nicht so viel“ abgeschnitten habe. So gelang es mir in winzigen Schritten, meine Haare ganz langsam, immer ein wenig länger, wachsen zu lassen. Die zwei Mark „Frisörgeld“ verjubelten wir bei „Glattbachs Kiosk“ am Luftschutzbunker, in dem wir das Geld in Hanuta und Marsriegel umsetzen. Nicht immer verliefen diese Aktionen reibungslos. Einmal wurden wir beim Haare schneiden beinahe auf frischer Tat von meiner Mutter ertappt, die sich dann aber doch von dem vor Angst zitternden Winne davon überzeugen ließ, dass ich tatsächlich beim Willi war. Dabei hielt er krampfhaft die abgeschnittenen Haarspitzen und die stumpfe Haushaltsschere hinter seinem Rücken versteckt und schwitzte Blut und Wasser, als ihn meine Mutter zweifelnd musterte.
GAFFENBERG
In den Sommerferien 1970 besuchten Elle, Webse, Hankes und ich eine vierwöchige Kinderfreizeit im nahen Stadtwald von Heilbronn. Ich hatte diese Einrichtung, die man „Gaffenberg“ nannte schon seit Jahren regelmäßig im Sommer besucht und in diesem Jahr meine Band-Kumpels dazu überredet, sich ebenfalls mit mir anzumelden. Das Waldheim bot unter der Regie der evangelischen Kirche für relativ wenig Geld, einen vierwöchigen Abenteuer-Urlaub in der Natur. Ehrenamtliche Betreuer, meist Abiturienten oder Studenten übernahmen die Aufsicht und der Jugendpfarrer Heilbronns war der Boss der Veranstaltung. Es gab vier Mahlzeiten pro Tag und Stadtbusse brachten die Jugendlichen am frühen Morgen auf den Berg - und am Abend wieder nach Hause. Nur für unsere Zigaretten mussten wir selbst sorgen, was sich aber schon nach dem ersten Tag erledigt hatte, weil wir so blöd waren, uns beim Rauchen erwischen zu lassen. Man stellte uns vor die Wahl einfach weiter zu rauchen und zu verschwinden - oder die Sache sein zu lassen. Wir entschieden uns ohne große Diskussion für die zweite Variante.
Schon einen Tag später schleiften wir unsere Gitarren mit auf den „Berg“, um gleich ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen. Mittlerweile nannten wir uns „The Poisen Devils“. Neues Mitglied in unserer Truppe war Hankes, der miserabel B-Flöte spielte, die bei unserem Radau aber sowieso nicht zu hören war. Er begleitete Lieder wie „Venus“ oder „Hitchin a Ride“, dessen Text Zapf umgeschrieben hatte und das er dem verstorbenen Brian Jones gewidmet hatte. Es dauerte nicht lange bis wir mit unseren Wandergitarren unser Image ganz schön aufgemöbelt hatten. Als ich unserem Betreuer den Vorschlag machte, mit unserer Band in der „Roten Halle“ einen Auftritt zu spielen, stieß ich überraschend auf große Zustimmung und wir begannen sofort mit den notwendigen Planungen. Um die Lautsprecheranlage der Halle anzusteuern mussten unsere Gitarrenkabel umgelötet werden. Webses Mutter hatte sich bereit erklärt das Schlagzeug und Zapf ins Waldheim zu transportieren. Zapf war der Einzige von uns, der nicht an der Freizeit teilnahm. Das Konzert sollte schon zwei Tage später stattfinden und wir bereiteten uns in dieser Zeit auf den Gig vor. Zwei Betreuer (Gaby und Mike) wollten uns als Gastmusiker unterstützen und wir probten mit ihnen „Venus“ und „Honky Tonk Woman“ ein. Der Rahmen, in dem die Veranstaltung ablaufen sollte, war das tägliche Erzählen einer Geschichte aus der Bibel mit der anschließenden Singstunde. Dieses Programm fand immer vor dem Abendessen in der vollbesetzten „Roten Halle“ statt. Diese Halle war vollständig aus Holz gebaut und hatte nach dem Krieg als Baubaracke für die Steinmetze an der Kilianskirche in der City gestanden. Neben der kleinen Bühne befand sich der Raum, den die Betreuer „Studio“ nannten. In diesem war die Technik für die Lautsprecheranlage des Waldheims untergebracht. Es war geplant unseren Auftritt statt der Singstunde durchzuziehen. Webses Mutter lieferte uns wie verabredet das Schlagzeug und unseren Sänger auf den Berg. Elle machte sich solange dünne. Die Wogen hatten sich zwar wieder etwas geglättet, allerdings hatte Webses Mutter die Prügelei noch nicht vergessen. Nachdem sie wieder weggefahren, und die Luft wieder rein war, begannen wir hinter dem geschlossenen Bühnenvorhang mit den Vorbereitungen zu unserem ersten „Soundcheck“ überhaupt. Es gelang uns mit unseren Gitarren das erste Mal genauso laut wie Webses Drum zu sein. Wir hatten die Ehre über eine 110 Watt starke Dynacord Gesangsanlage zu spielen. Während der Pfarrer vor der voll besetzten Halle mit seiner Geschichte loslegte, suchten wir noch immer hinterm Vorhang versteckt auf der Bühne unsere Position. Zapf hatte sich im „Studio“ verkrochen und war nicht mehr ansprechbar. Er war apathisch vor Angst und bereute es zutiefst, sich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben. Mit einem solch großen Publikum hatte er nicht gerechnet. Gutes Zureden oder wüsteste Drohungen hatten keinerlei Wirkung auf ihn. Er hatte furchtbares Lampenfieber. Vielleicht erinnerte er sich an seinen vergeigten Theaterauftritt vor fast sieben Jahren. Wir stritten noch immer miteinander, als sich plötzlich der Vorhang öffnete. Wir waren genauso überrascht wie die rund siebenhundert Kinder, da wir den Auftritt bis jetzt hatten geheim halten können und wir genossen es, in die verdutzten Gesichter des Publikums zu blicken. Wir begannen unser Set mit dem ungewöhnlichen „2000 Light Years From Home“ der Stones. Ein Lied das Elle sang. Zapf ließ sich nicht blicken. Nachdem sich die Zuschauer vom ersten Schock erholt hatten und wir auf gefälligeres Material wie „Get Back“ oder „Venus“ zurückgriffen, kam schnell Stimmung in den Laden und die umjubelten Einlagen unserer Gastmusiker rissen Zapf aus seiner Lethargie. Als er sich das Mikrofon geangelt hatte, erinnerte nichts mehr an das Häufchen Elend im Technikraum wenige Minuten zuvor. Souverän, als hätte er nie etwas anderes gemacht, zog er seine Show ab. Nach dieser überaus erfolgreichen Art Lärm zu machen wurde noch an diesem Abend beschlossen, das Konzert eine Woche später zu wiederholen.
So hatten wir uns also in eine recht komfortable Situation gebracht. Selbst die bisher für uns ziemlich unnahbaren Mädchen aus der französischen Partnerstadt, die jedes Jahr auf den Berg eingeladen waren, tuschelten jetzt bewundernd und kichernd, wenn wir uns auf dem Waldheimgelände über den Weg liefen. Selbst Harry M. (ein hartnäckiger und mir meist überlegener Gegner auf dem Fußballplatz) der selbst gerade Musiker suchte um eine Band zu gründen, beneidete uns nach diesem Auftritt. Bis zu diesem Tag waren meine eher ungeschickten Annäherungsversuche stets erfolglos geblieben. Ich hatte wirklich alle Register gezogen und erntete bei den, zumindest gleichaltrigen Französinnen meist nur ein mitleidiges Grinsen. Oft provozierte ich durch mein aufdringliches Balzverhalten eher ihren Unmut - und das gutmütige Unverständnis meines Betreuers, der mir noch zwei Jahre zuvor den Spitznamen „der liebestolle Klaus" verpasst hatte. Die Chance anständig auf die Pauke zu hauen bot sich, als ein groß aufgezogenes Fußballspiel der beiden besten Mannschaften im "Gaffenberg-Stadion" stattfinden sollte. Sämtliche Gruppen wurden zu diesem Ereignis auf den Sportplatz im nahegelegenen Steinbruch gelotst und sollten eine stimmungsvolle Kulisse bilden. Hier würde meine große Stunde schlagen! Als unbezwingbarer, wieselflinker Mittelstürmer meiner Mannschaft. Und tatsächlich schien ich einen außerordentlich hervorragenden Tag erwischt zu haben. Ich strotzte vor Selbstvertrauen, die Anfeuerungsrufe der Mädchen gaben mir den Rest und brachten mich beinahe um den Verstand. Dies offenbarte sich nach dem Seitenwechsel in der zweiten Halbzeit. Unter dem Gejohle und Gekreische der am Spielfeldrand sitzenden Mädchen, machte ich mich nach einem präzise zugespielten Pass mit dem Ball auf den Weg zum Tor. Scheinbar gelang es nicht einem der Mit- und Gegenspieler auf dem Platz mich aufzuhalten. Ich umspielte wie im Rausch sämtliche Akteure und legte meine ganze Kraft in einen fürchterlichen, satten und schnurgeraden Schuss, der den erstaunten und offenbar wehrlosen Torwart erstarren ließ. Der Ball landete mit unglaublicher Präzision und Wucht geschossen, unhaltbar in der linken oberen Ecke des Gehäuses. Allerdings brandete statt dem erwarteten Torjubel nur das Gelächter mehrerer hundert Zuschauer auf. Und erst als mir mein ärgerlich kopfschüttelnder Torwart den Ball zuwarf, begriff ich, dass ich bei meinem kompromisslosen Slalom in die falsche Richtung gelaufen war und die irrsinnige Aktion mit einem prächtigen Eigentor abgeschlossen hatte.
Das neue Schuljahr im Herbst begann ohne Webse. Laichert hatte ihn nach zahllosen Verwarnungen wegen schlechtem Betragens von der Schule geworfen. Vielleicht hatte auch Webses Mutter die Versetzung an eine andere Schule forciert, um das Thema „Elle“ abzuschließen. Die restliche „Kolonne“ hatte Laichert mit der Höchstnote im damals noch üblichen Fach für „Betragen“ und „Mitarbeit“ belohnt. Mit solchen Zensuren im Bewerbungszeugnis war nicht viel Staat zu machen. Da wir also eh nichts mehr zu verlieren hatten, gab es auch im letzten Schuljahr keinen Grund für uns, sich unnötig ins Zeug zu legen. Der Rauswurf Webses änderte nichts an der weiterhin miserablen Mitarbeit oder unserem Verhalten – und Webse blieb bis jetzt weiterhin unser Schlagzeuger.