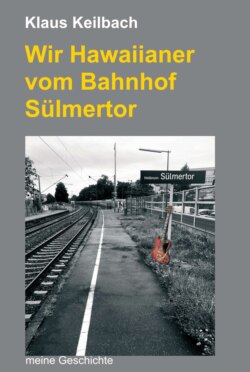Читать книгу Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor - Klaus Keilbach - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1972
BEI CHARLY
Die Sonntage verbrachten wir oft bei Charly, im vom Hawaii zehn Kilometer entfernten Nachbarort Ellhofen. Hier hatte seine Mutter ein kleines Häuschen gemietet und Charly war in ein Zimmer im Erdgeschoss eingezogen. Außer ihm und seiner Mutter lebte noch seine jüngere Halbschwester im Haus. Charlys Zimmer sah aus wie Daniel Düsentriebs Erfinderwerkstatt. Auf dem Bett, dem Tisch und auf dem Fußboden lag alles voll mit Kondensatoren, Kabelresten, Lötzinn und Lötkolben. Bei diesen Sonntagnachmittag-Sessions war auch Zapf regelmäßig mit von der Partie. Hier gab es schließlich reichlich Dope und hin und wieder besorgte Charles LSD. Grund genug, um sich mit uns an die Straße zu stellen und den Daumen in die Luft zu halten. Oft genug hatten wir das Vergnügen, Charlys unverzichtbaren Kofferverstärker vom Au-Keller nach Ellhofen zu transportieren, was die Chance im Auto mitgenommen zu werden um einiges erschwerte. Charlys ganzer Stolz war ein Philips Kassettenrekorder, den er sofort auf Aufnahme schaltete und so jeden Ton aufzeichnete, den wir von uns gaben. Wir spielten bei unseren Improvisationen, ohne uns dessen bewusst zu sein, eine Art Krautrock. Eine Mischung aus „CAN“ und „AMON DÜLL“, mit vorwiegend akustischen Instrumenten die bei Charly, genauso wie sein „Kabelsalat“, im Zimmer verstreut herumlagen. Es gab Flöten, Bongos, Mundharmonikas und Akustikgitarren. Dazu jaulte der Multivibrator und versetzte die gesamte Nachbarschaft in Angst und Schrecken. Manchmal gelang es uns, einen hypnotischen Trance-Zustand zu erreichen und ich hatte dann das Gefühl, dass nicht WIR die Musik spielten, sondern die Musik UNS. Wenn wir schon samstags bei Charly auftauchten übernachteten wir auch dort. In diesem Fall übernahm Charles die Regie über den Verlauf der Nacht indem er LSD besorgte. An Schlaf war dann nicht zu denken. Entweder lagen wir auf dem Fußboden und philosophierten bis zum nächsten Morgen, oder wir schlichen zugedröhnt von Haschisch oder LSD über die angrenzenden Felder außerhalb des Ortes. Bei einer dieser Wanderungen sprach Charly im LSD Rausch eher beiläufig davon, dass er sich gerade vorstelle, der gesamte Ackerboden sei von unzähligen Igeln übersät. Selbst mir, der ich LSD nie anrührte, lief bei diesem Gedanken ein kalter Schauer über den Rücken und ich hatte das Gefühl mit jedem Schritt auf einen der Millionen Igel zu treten. Cebe war sofort völlig von der Rolle und weigerte sich strikt weiterzulaufen. Er zitterte am ganzen Leib und war kaum zu beruhigen. Während wir uns um Cebe kümmerten, hatte sich Zapf dünnegemacht. Wir trafen ihn erst zwei Tage später im Hawaii wieder. Laut seinen Worten war er in Panik geraten und vor lauter Angst mitten in der Nacht, völlig traumatisiert, den zehn Kilometer langen Weg nach Hause gelaufen. Cebe brauchte, wie so oft, einige Tage bis er wieder auf dem Damm war. Die Schilderungen seiner „Erlebnisse“ auf solchen Trips waren der Grund für mich, diese Pillen nicht anzurühren. Ich hasste die Vorstellung, die Kontrolle zu verlieren und konnte nicht verstehen, warum sich Cebe immer wieder auf dieses „russische Roulette“ einließ. Charles war so ziemlich der Einzige, der diese Droge völlig unbeeinflusst von schlechten „Vibes“ genießen konnte. Für ihn bestand so gut wie kein Risiko wahnsinnig zu werden, während Cebe nicht selten an einer Katastrophe vorbeischrammte.
PEARL DRUM
Mit jeder Probe wurde es offensichtlicher, dass wir lautere Verstärker brauchten. Ich hatte im Schaufenster eines Musikgeschäfts eine gebrauchte Dynacord-Anlage entdeckt. Sie hatte die Größe einer 4+12 Lautsprecherbox, war sechzig Watt stark und sollte 600 Mark kosten. Ich beschloss den Amp zusammen mit Cebe zu kaufen. Wir teilten uns die Summe und entschieden nach einem Soundcheck, dass die Anlage den Bass verstärken solle. Das Ding war zwar unglaublich laut, aber da es ein Transistorverstärker war der einen 15 Zoll Speaker antrieb, klang meine Gitarre unverzerrt und somit absolut harmlos. Kurz darauf zog Charles nach. Ihm war in der Zeitung eine Anzeige aufgefallen, in der jemand ein fast neuwertiges „Pearl“ Schlagzeug mit zwei Basstrommeln anbot. Sein derzeitiges Drum Set war völlig heruntergekommen. Die mechanischen Teile quietschten in allen Tonarten und die Becken klangen stumpf. Charles setzte sich mit dem Besitzer des Schlagzeugs in Verbindung und verabredete einen Besichtigungstermin. Da wir uns nicht vorstellen konnten, wie Charles eine größere Summe zusammenkratzen wollte, ließen wir es uns nicht nehmen an den Verhandlungen teilzunehmen. Außerdem wollten wir endlich mal ein Schlagzeug mit zwei Basstrommeln sehen. Das Instrument stand in einer alten Schlosserwerkstatt, über welcher der „Verkäufer“ eine Wohnung besaß. Dieser erinnerte mich verdächtig an meinen früheren Klassenlehrer aus dem Gymnasium und es stellte sich heraus, dass er tatsächlich der Sohn „von Oppers“ war. Nachdem er mit einigen Lästereien über seinen Vater hergezogen hatte, wobei ich voll auf seiner Seite war, bot er Charles an, einige Takte auf dem riesigen Schlagzeug zu trommeln. Als ich in das Gesicht von Charles blickte, während dieser mit leuchtenden Augen die Felle bearbeitete war mir klar, dass dieser alles daran setzen würde, um sich dieses Drum-Set unter den Nagel zu reißen. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die Beiden auf die für uns unglaubliche Summe von 1500 Mark, die Charles in Raten abbezahlen wollte. Charles unterschrieb den Vertrag ohne mit der Wimper zu zucken – und ohne einen Pfennig in der Tasche zu haben. Erst auf dem Heimweg realisierte Charles, auf was er sich da gerade eingelassen hatte. Wir suchten nach Möglichkeiten das Geld aufzubringen und waren uns einig, die erste Anzahlung von fünfhundert Mark zusammen zu berappen. So gewannen wir erst mal Zeit. Den Rest würde Charles schon irgendwie aufbringen. Es dauerte nicht lange bis „Oppers“ dahinterkam, wer seinen Kaufvertrag unterschrieben hatte. Die Anschrift seines Vertragspartners ließ ihn das Schlimmste befürchten und er stattete Charles und seiner Pflegemutter Emma einen Besuch im Hawaii ab. Dieser hatte seine Mutter natürlich noch nicht eingeweiht und sie verlor beinahe den Verstand als Oppers ihr das unterzeichnete Papier unter die Nase schob. Charles zog alle Register seiner Redekunst (und davon hatte er schließlich einiges zu bieten) um Emma und Oppern davon zu überzeugen, dass es kein Problem für ihn sein würde das nötige Geld aufzubringen. Tatsächlich stand er am Ende seiner Ausbildung zum Karosseriebauer und würde bald einige Scheine mehr in der Lohntüte haben. Emma beruhigte sich und Oppers legte misstrauisch den Rückwärtsgang ein. Wenige Tage später stand das neue Schlagzeug im Proberaum und Charles legte eine nie vermutete Putzfreudigkeit an den Tag. Er verbrachte Stunden damit, jedes einzelne Teil seines neuen Instruments sorgfältig zu polieren. Sicher war er noch nie in seinem Leben so stolz gewesen. Trotz aller Beteuerungen klappte es mit den Ratenzahlungen dann doch nicht so reibungslos wie versprochen. Charles hatte Glück, dass sich Oppers nach seinem ersten Besuch nicht mehr ins Hawaii traute. Dafür hatte Emma das Vergnügen die Mahnbescheide wegen der versäumten Ratenzahlungen entgegenzunehmen.
EMMAS KUR 1972
Im April 72 war Emma urlaubsreif. Alleinerziehende Mutter von zwei Pflegekindern, wovon Eines davon nicht unbedingt einfach zu handeln war. William, der jüngere der Beiden, war ein eher stiller, unauffälliger Schüler in meiner Parallelklasse. Auch sonst stand er meist im Schatten seines dominanteren Stiefbruders und akzeptierte diesen als den Leitwolf. Einmal pro Woche besuchten Charles und William das öffentliche Hallenbad in Heilbronn, um in den Genuss eines Vollbades zu kommen. Zuhause gab es diese Möglichkeit nicht. Emma kassierte nur eine kleine finanzielle Unterstützung die gerade so zum Überleben reichte. Jetzt hatte ihr der Hausarzt eine vierwöchige Kur verordnet. Am Tag ihrer Abreise ging Charles zum Quacksalber seiner Mutter und ließ sich krankschreiben. Anschließend schloss er sämtliche Fensterläden in der Wohnung und richtete sich ein „Krankenlager“ aus Matratzen im Wohnzimmer ein, das er in den folgenden Wochen nur noch zum pinkeln verließ. Vera legte sich neben ihn – und wir zogen ein!!!
Emmas Wohnung wurde für die nächsten vier Wochen unser Zuhause. Charles hatte schon im Vorfeld für eine ausreichende Menge Haschisch gesorgt, sodass auch Zapf regelmäßig auf der Matte stand. Schon am frühen Nachmittag waberten dichte Rauchschwaden durch die Bude und unablässig drehte sich auf dem Plattenspieler das Hendrix Album „Electric Ladyland“. Zapf fühlte sich wie im Schlaraffenland und drehte einen Joint nach dem anderen. Selbst wenn alle anderen schon erschöpft abwinkten hatte er noch lange nicht genug. Spätestens gegen acht Uhr am Abend war an eine vernünftige Unterhaltung nicht mehr zu denken. Jeder hatte sich in eine Ecke verkrochen, starrte dumpf ins Leere und lauschte der Musik. Die Küche war der einzige Ort, an dem noch so etwas wie Konversation betrieben wurde. Hier trafen sich die hungrigen Kiffer und kreierten am Herd die phantasievollsten Gerichte aus Brot, Butter, Wurst und Senf. Dass der Senf nach einigen Tagen die Zimmerdecke verzierte war William zu verdanken. Mit unbändiger Kraft versuchte er aus einer verschlossenen Tube den Inhalt auf sein Brot zu drücken – bis die Tube platzte und der Senf in die falsche Richtung gegen die Küchendecke klatschte. Es dauerte nur wenige Tage bis Emmas Wohnung langsam aber sicher im Chaos versank und es aussah wie in einer Opiumhöhle. Die Blumen litten an fehlendem Wasser – und fehlendem Tageslicht. Licht spendeten höchstens ein paar Kerzen, deren flüssiges Wachs auf das Tischtuch und den Teppich tropfte, wo es bizarre Muster hinterließ. Glimmende, auf den Boden fallende Jointreste sorgten zudem für markante Brandlöcher auf Emmas Teppichen. William hatte immerhin in der Küche versucht das Schlimmste zu verhindern. Nach seiner Senfattacke gab er jedoch resigniert auf. Schmutziges Geschirr und schimmelnde Essensreste sorgten bald für einen abartigen Gestank der durch die mittlerweile verstopfte Toilette fast unerträglich wurde. Jede Menge Abfälle hatten wir einfach das Klo runtergespült und so dafür gesorgt, dass das Rohr seit Tagen hoffnungslos verstopft war. Es dauerte Stunden bis eine Spülung langsam durch die inzwischen zusammengepresste Masse gesickert war. Karle, der uns weiterhin mit dem Shit seines türkischen Arbeitskollegen versorgte und deshalb auch regelmäßig bei Charles auftauchte, begann einen aussichtslosen Kampf gegen die Kloake, indem er seinen Arm in eine Plastiktüte steckte und in der Scheiße rührte. Der Erfolg war spärlich. Wenigstens sorgte die Rettungsaktion für eine willkommene Abwechslung. Mit ausdruckslosen Blicken verfolgten die anwesenden Gäste Karles nutzlose Bemühungen. Jeder neue, fehlgeschlagene Versuch den Fluss wieder in Gang zu bringen, brachte noch nutzlosere Ratschläge und sorgte lediglich für etwas Heiterkeit. Nachdem sich kein durchschlagender Erfolg einstellte, beschlossen wir ab jetzt, die Pausen zwischen den jeweiligen Toilettenbesuchen zu verlängern, damit die Brühe bis zur nächsten „Sitzung“ wieder ein wenig abgelaufen war. Nachdem Charles zwei Wochen krankgeschrieben war, weigerte sich sein Arzt die Krankmeldung zu verlängern – und Charles kündigte seinen Job. Seine Ausbildung hatte er erst vor kurzem beendet und verdiente als Facharbeiter relativ gut. Sein Schlagzeug hatte er noch lange nicht abbezahlt und hätte dies nun ohne Schwierigkeiten erledigen können. Emmas Kur hatte dies nun aber durcheinandergewirbelt. Charles war eben gerade wunschlos glücklich. Er hatte alles was er brauchte: eine bequeme Matratze, seine Freundin Vera, Electric Ladyland auf Dauerrotation, seine Kumpels und jede Menge feinstes Haschisch. Warum also sollte er an dieser Situation etwas ändern? Alles was ihm im Magen lag, war die Frage, wie man Emmas Wohnung wieder rechtzeitig auf Vordermann bringen sollte. Aber noch war ja genügend Zeit. Die Party ging weiter…
Das Klo hatte sich nun endgültig verabschiedet. Der Wasserpegel hielt sich konstant bis knapp unter den Rand, dafür herrschte bei den Topfblumen weiterhin Dürre. Am Abend lungerten oft mehr als zwanzig Leute in dem kleinen Wohnzimmer herum und sorgten dafür, dass der Raum im Rauch zu ersticken drohte. Die, durch die Senftuben-Explosion verursachten Ornamente an der Küchendecke hatte William erfolglos versucht abzuwischen, hatte damit aber alles nur noch schlimmer gemacht. Nach seiner Behandlung mit einem Schwamm sah es aus, als hätte jemand gegen die Küchendecke gepinkelt. Dann erschien Emma völlig überraschend einige Tage früher als erwartet. Wir suchten schleunigst das Weite, da wir keine große Lust hatten zwischen die Fronten zu kommen.
ROCK MEETING GERMERSHEIM
Es dauerte einige Zeit bis Emma ihre Wohnung wieder in Schuss hatte. Charles genoss seine neu gewonnene Freiheit und quälte sich, Emma und uns stattdessen mit seinen noch ausstehenden Ratenzahlungen an „von Oppers“. Um ein wenig Abstand von dem ganzen Stress zu gewinnen beschlossen wir, über die Pfingstfeiertage ein Rock-Festival am Rhein zu besuchen. Es war als das bis dahin größte Festival Deutschlands angekündigt worden und sollte drei Tage dauern. Die Liste der Bands die hier auftreten sollten war sensationell. Auf dem Plakat, das ich in meinem Zimmer an die Wand genagelt hatte, standen u.a. Namen wie: „Humble Pie“, der damals noch großartige „Joe Cocker“, die Band „Family“ mit Roger Chapman, die „Faces“, die „Kinks“ und als Top Act „Pink Floyd“! Charles, Vera und Charly hatten sich schon am Freitagvormittag per Anhalter auf den Weg an den Rhein gemacht. William, Bomber und ich wurden am Nachmittag von „Bombers“ Eltern in den Ort in der Pfalz gefahren. Wir trafen uns dort wie verabredet am Abend, in einem Park vor dem Bahnhof. Von dort aus machten wir uns auf den Weg zum Festivalgelände. Wir folgten ganz einfach dem riesigen Strom an Menschen, die bepackt waren mit Rucksäcken und Zelten. Am Rand der Straße boten fliegende Händler alle Arten von Drogen an. Vorwiegend Haschisch und LSD. Die Polizei hielt sich erstaunlicherweise im Hintergrund und hatte laut dem Veranstalter keinen Zutritt auf das Festgelände. Dafür gab es jede Menge Zelte des Roten Kreuzes und der Drogenhilfe. Sie sorgten für erste Hilfe, wenn irgendwas aus dem Ruder gelaufen war. Der Marsch vom Ort bis zur Halbinsel am Rhein dauerte über eine Stunde und es war schon dunkel als wir unsere zwei kleinen Zelte aufbauten. Von unserem Zeltplatz bis zur Bühne waren es nochmal einige hundert Meter, aber auch über diese Entfernung war die Musik verdammt gut zu hören. Zwischen den Zelten herrschte ein emsiges Treiben. Wildfremde Freaks boten Shit oder Trips an. Zum Teil wurde der Stoff verschenkt oder einfach getauscht. Es gab definitiv niemanden, der nicht unter Drogen stand. Überall brannten Lagerfeuer, um die sich die Hippies gruppierten und um die Wette kifften. Charles und Vera waren die ersten, die sich in ihrer „Hundehütte“ verkrochen. Sie beanspruchten ein Zelt für sich, während sich Charly, Bomber, William und ich das zweite Zelt teilten.
Am nächsten Nachmittag machte ich mich auf den Weg zur Bühne. Für die paar hundert Meter bis dorthin brauchte ich eine Ewigkeit. Ich irrte durch ein Labyrinth aus Zelten, Plastikplanen, Teppichen, Decken und unzähligen, auf dem Boden sitzenden Menschen, die auf den Beginn der Veranstaltung warteten. Auf dem Gelände hatten sich an diesem ungewöhnlich warmen Pfingstsamstag über 100.000 friedliche, bekiffte Hippies versammelt. Hier lag noch der Geist von Woodstock in der Luft. In diesem entspannten Chaos stieß ich völlig überraschend auf Webse, der eigentlich so gar nicht hierher passte. Er prahlte damit auf LSD zu sein, was ich ihm nicht abkaufte. Webse war kein Drogentyp. Wenige Minuten später sah ich plötzlich Zapf inmitten einer Horde von Amerikanern. Er war schon so hinüber, dass es für ihn ganz selbstverständlich schien, mich hier zu treffen, ohne dass er darüber im Geringsten überrascht zu sein schien. Oder er wusste schon nicht mehr wo er war. Einer der GIs reichte ihm gerade eine Gasmaske, die er sich aufs Gesicht drückte. An dem Ding war ein halber Meter langer Schlauch befestigt und am Anfang des Schlauchs steckte ein Chillum mit dem Durchmesser einer Bratpfanne. Darin kokelte ein ganzes Pfund Haschisch. Zapf holte unter der Gasmaske tief Luft und fiel augenblicklich nach hinten auf eine der ausgebreiteten Zeltplanen. Nachdem ich die freundlich angebotene Maske dankend abgelehnt hatte, kämpfte ich mich weiter in Richtung Bühne. Die ersten Bands, die ich mir vor einem der Boxentürme ansah, waren „Frumpy“ mit der phantastischen Inga Rumpf und die holländische Band „Beggars Opera“. Mit der Abenddämmerung begannen die Vorbereitungen für den Auftritt von „Pink Floyd“. Das Gedränge vor der großen Bühne war fast unerträglich geworden und ich saß auf einer gerade noch Din-A-4 großen Fläche. Meine Beine begannen langsam abzusterben - vor allem das Bein, auf dem es sich ein Mädchen unfreiwillig bequem gemacht hatte. Als bei Einbruch der Dunkelheit ein angenehm warmer Wind über das Gelände strich und es ganz leicht zu regnen begann, erklang aus den riesigen Boxentürmen das Intro zu „One Of These Days“. So viel Zufall konnte fast nicht sein. Ich war mir in diesen Minuten sicher, dass „Pink Floyd“ an diesem Abend sogar für das Wetter verantwortlich waren. Es wurde eine großartige Show, mit den Mammutsongs „Atom Heart Mother“ und „Echoes“. Außerdem spielte die Band Material vom „Umma Gumma“ Album. Die Atmosphäre war passend zur nächtlichen Kulisse: gespenstisch und unwirklich, feierlich und ergreifend. Die Luft roch nach Lagerfeuern und Dope und ich hatte Tränen in den Augen.
Der nächste Tag begann wolkenlos und es wurde schnell warm. So langsam dämmerte uns, dass wir zwar mit genügend Shit versorgt waren und Charly sogar einige Konservendosen mitgebracht hatte, aber an Getränke hatte keiner von uns gedacht. Wir beschlossen, uns auf den elend langen Weg in den Ort zu machen. Die Preise auf dem Festivalgelände für etwas Trinkbares waren entschieden zu hoch für uns. Schon ein Apfel war hier teurer als ein Gramm Haschisch. Wir brauchten eine gute Stunde in der brütenden Mittagshitze bis wir einen Supermarkt erreichten, und nach einer weiteren Stunde Rückweg hatten wir unseren Getränkevorrat fast schon wieder aufgebraucht. Unser Hunger war irgendwann so groß, dass wir den Inhalt von Charlys wässriger Tomatensoßendose mit Erde vermischten, um wenigstens das Gefühl zu haben, irgendwas in den Magen zu kriegen. Die restlichen zwei Tage verbrachten wir vorwiegend bei unserem Zelt und verzichteten auf das Gedränge vor der Bühne. Die Musik war auch hier gut zu hören. Und um in der Hitze nicht zu verdursten, war es wichtig sich möglichst wenig zu bewegen. Außerdem setzte uns die enorme Menge an verfügbarem Haschisch ganz gehörig außer Gefecht. In den Nächten wurde uns auch die Kehrseite des „love and peace“-Spektakels bewusst. Ständig hörten wir die Durchsagen von der Bühne, die vor schlechtem Stoff warnten. Die Sirenen der pausenlos fahrenden Krankenwagen wurden zur gewohnten Hintergrundmusik. In einem Artikel berichtete die „Bild Zeitung“ wenige Tage später über das Festival und prangerte an, dass mindestens 80 % der Besucher unter Drogen gestanden hätten. Ich war mir sicher, dass diese Behauptung um 20 % untertrieben war.
AMSTERDAM
Einige Wochen nach unserem Germersheim-Abenteuer beschlossen Charles, Vera, Charly und Cebe nach Amsterdam zu trampen. Wir hatten von den paradiesischen Zuständen durch die recht laxen, holländischen Drogengesetze gehört, und vor allem Charles wollte sich davon selbst ein Bild machen. Er wurde nicht enttäuscht. Die Vier versorgten sich im Vondelpark mit LSD, und während Charles, Vera und Charly auf die übliche farbenfrohe Reise gingen, kämpfte Cebe wieder einmal gegen seine unvermeidlichen bösen Geister. Dieses Mal schienen sie allerdings hartnäckiger zu sein. Als die anderen schon lange wieder im „Heimathafen“ eingelaufen waren, hatte Cebe die Einfahrt verpasst. Sein Zustand wurde so besorgniserregend, dass er mit einem Krankentransport nach Heilbronn gebracht werden musste, wo er sofort in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. Als wir ihn wenige Tage später im Krankenhaus besuchten machte er einen ziemlich desolaten Eindruck und war durch die ihm verabreichten dämpfenden Medikamente kaum ansprechbar. An eine baldige Entlassung war nicht zu denken. Dies bedeutete auch einen Rückschlag für unsere Band. Wir waren Freunde und hatten mächtig Spaß mit unserer Musik. Cebe war also nicht einfach durch jemand anderen zu ersetzen. Aber noch hofften wir, dass er bald wieder auf die Beine kommen würde.
Außer Cebes Dilemma lag aber noch anderer Ärger in der Luft. Charles musste seit seiner Musterung jederzeit mit seiner Einberufung zur Armee rechnen. Bis jetzt hatte er, trotz immer wieder geäußerter Versicherungen dem Verein nicht beizutreten, noch nichts unternommen um den Wehrdienst mit der Waffe zu verweigern. Wir legten unsere Band erst mal auf Eis. Ohne Cebe machte es wenig Sinn zu proben. Zum Glück hatte ich seit Kurzem die Bekanntschaft mit einem „Verzerrer“ gemacht (einem Gitarreneffekt, der die Röhren eines Verstärkers „anbläst“, und so für den amtlichen Hardrock-Sound einer Gitarre sorgt). Dieses Teil, von der Größe eines Backsteins, verkabelte ich zwischen meiner Gitarre und dem Radio meines Vaters. So hatte ich auch zu Hause in meinem kleinen Zimmer die Möglichkeit jede Menge Lärm zu machen. Ich nahm mir die Lieder meiner Lieblingsbands „Collosseum“ und den „Allman Brothers“ vor und versuchte, die ewig langen Solopassagen mitzuspielen. Dabei kopierte ich so gut es ging die prägnanten Stellen der Leadgitarre. Zu den restlichen Teilen der Solos improvisierte ich mit den „sechs!“ mir zur Verfügung stehenden Tönen, die ich einfach so schnell wie möglich durcheinanderwirbelte. Der Schaller-Verzerrer war mit einem Wah-Wah Pedal kombiniert, was die Sache noch ein wenig gefährlicher klingen ließ. Manchmal gelangen mir geniale Licks, die ich allerdings nicht wiederholen konnte. Aber ich blieb am Ball und wartete auf weitere unverhoffte Glücksmomente. An diesem Lernprozess ließ ich die gesamte Nachbarschaft teilhaben. Das Fenster zum Hinterhof hatte ich meist geöffnet und provozierte so immer wieder die Unmutsäußerungen der Anwohner. Immerhin - und darauf spekulierte ich schließlich – gab es auch jede Menge Bewunderer für meine Tricksereien. Vor allem Winne, der nur wenige Meter entfernt im Nachbarhaus wohnte, wurde mein wichtigster Kritiker und brachte mein Selbstvertrauen oft ganz schön auf Vordermann. Unsere, von Fräulein Minke festgelegten Probezeiten nutzten wir trotzdem. Manchmal schnappte sich Zapf das Gibson SG Bassmodell von Cebe oder Charly versuchte sich als Bassist. Es kam aber nichts wirklich Konkretes dabei heraus.
MARIE-THERESE
Während der Sommerferien blieb der Au-Keller geschlossen und ich lungerte die meiste Zeit mit Karle am Kiosk bei der Bunkeranlage herum. Karle hatte sich schon vor Wochen Cebes Motorrad unter den Nagel gerissen und wir fuhren meist völlig ziellos durch die Gegend - auf der Suche nach nichts! Außer bei unseren abendlichen endlosen Federball-Turnieren langweilten wir uns gut gelaunt durch die freien Tage. Die warmen Nächte verbrachte ich mit aufgesetzten Kopfhörern am offenem Fenster, träge auf dem Fenstersims meines Zimmers sitzend, rauchte und lauschte dem Meddle Album von Pink Floyd. Doch dann brachte Helga plötzlich Leben in die Bude. Eher beiläufig schwafelte sie davon, dass sie für die nächsten drei Wochen wegen der jährlichen Gaffenberg-Freizeiten ein Mädchen aus der französischen Partnerstadt zu Gast habe. Karle wettete sofort um einige halbe Hähnchen, dass das Mädchen sicherlich hässlich wie eine Kröte sei und fuhr nach Ankunft der Französin (und nach unserer sorgfältigen Musterung) überglücklich mit seiner Garelli zum Wienerwald, um unser Abendessen zu besorgen. Nicht ohne vor der Abfahrt völlig übermütig den Satz des Jahres in unsere Runde zu schmeißen: „Wenn jemand nach mir fragt – ich bin im KZ Dachau“! (Eine humoristische Einlage, deren Gag sich nur eingefleischten Insidern der Clique erschließt). Das Mädchen war vierzehn Jahre alt, hieß „Marie-Therese“, hatte blonde Haare und einen Mireille Mathieu Pagenschnitt. Sie war gut zwei Köpfe kleiner als ich, und bei ihrem ersten Besuch mit Helga am Treffpunkt beim Kiosk zog ich gleich mal eine riesige Show ab. Ich „borgte“ mir Karles Motorrad und drehte einige waghalsige Runden auf der, an Wochenenden wenig befahrenen Straße beim Luftschutzbunker. Schon während meiner Gaffenberg-Zeit war es immer mein Traum gewesen, mir eine der Französinnen zu angeln, aber außer einigen zähen Brieffreundschaften war nie viel dabei herausgesprungen. Jetzt versuchte ich meinen „Heimvorteil“ zu nutzen. Außerdem schien es auch endlich an der Zeit zu sein, meine, im Schullandheim erlernten Kenntnisse wieder mal aufzufrischen. Abgesehen von einigen wenigen Romanzen, mit den von Elke vermittelten Klassenkameradinnen, hatte das letzte Jahr nicht viele Möglichkeiten dazu geboten. Erfreut registrierte ich, dass meine „Motorradnummer“ mächtig Eindruck auf Marie gemacht hatte, sodass ich weiterhin alle Register zog, um kräftig Werbung in eigener Sache zu betreiben.
Zwei Tage später erklärte mir Helga, dass sich Marie ungewöhnlich interessiert über mich erkundigt hätte. Grund genug um nun endgültig zur Hochform aufzulaufen und auf der Garelli „rückwärts auf dem Hinterreifen“ um den Kiosk zu düsen, na, ja… wenigstens gingen meine Planungen in diese Richtung. Nach einigen weiteren halsbrecherischen Vorführungen (die Karle den Angstschweiß auf die Stirn trieb, weil er sich Sorgen um sein Motorrad machte), machten mir Helga und die rothaarige Andrea unmissverständlich klar, meine Zirkuseinlagen auf ein erträgliches Maß zurückzuschrauben um mich endlich um Marie zu kümmern. Sie lockten uns Beide in eine stille Ecke hinter einem Häuserblock und machten sich gleich darauf diskret aus dem Staub. Mein hyperaktiver Übermut verwandelte sich augenblicklich in meine übliche Unsicherheit und ich begann erbärmlich zu frieren, obwohl es mindestens 25° Grad warm war… und dann erinnerte ich mich zum Glück an Brigittes Zungenküsse…
Ab sofort litt ich unter den heftigsten Nebenwirkungen des Verliebtseins, verlor jeglichen Appetit und das Bedürfnis zu schlafen. Ich sehnte mich nach unseren Verabredungen am Abend und hatte gleichzeitig fürchterlichste Magenkrämpfe, wenn ich nur daran dachte. Die Nächte verbrachte ich schlaflos und wie im Rausch und tagsüber genoss ich die Vorfreude auf Marie, was mir regelrecht körperliche Schmerzen bereitete. In den wenigen Stunden die uns am Abend zur Verfügung standen, seilten wir uns von den anderen ab und unternahmen Wanderungen durch die City oder durch die Weinberge. Ich hatte alle Prinzipien über Bord geschmissen und fand alles an Marie phantastisch. Als Fan von „progressiver“ Jazz-Rock-Musik tolerierte ich sogar Maries damaligen Lieblings Hit „POPCORN“.
Eines Abends präsentierte ich ihr den Kaiser-Wilhelm-Platz. Ich hatte das Bedürfnis ihr in der kurzen Zeit die uns noch blieb, so viel wie möglich von mir und meinem Leben zu zeigen. Staunend lernte sie an diesem herrlichen Sommerabend die beiden Barabas-Brüder kennen, die gerade völlig besoffen ein A-Capella-Free-Konzert gaben, oder den ziemlich gefährlich aussehenden „Johnny Schutt“, der seinen Spitznamen der Tatsache verdankte, dass er sich auf der städtischen Müllkippe mit dem Nötigsten versorgte. Johnny hatte keinen festen Wohnsitz und fühlte sich auf dem „KW“ unter Seinesgleichen. Er konnte keiner Fliege was zuleide tun, trank keinen Alkohol, rauchte nicht und nahm keine Drogen. Seine einzige Schwäche bestand darin, jeden Morgen ein Glas „ODOL“ Mundwasser zu trinken, da er diesem Genuss nicht widerstehen konnte. Belustigt beobachtete Marie Uwe B., der sich ständig mit einem Kamm durchs Haar fuhr und allen Umstehenden versuchte ein Kompliment über seine Frisur zu entlocken. Da er stotterte, dauerte es eine halbe Ewigkeit bis er einen Satz herausgebracht hatte, und meistens hatte ich am Ende einer seiner haarsträubenden Geschichten schon wieder vergessen, wie die Story eigentlich begonnen hatte. Uwe hatte in seinem Leben eindeutig zu viel LSD konsumiert und hatte den Bezug zur Realität schon lange verloren. Er glaubte Mick Jagger zu sein. Seine zu kurzen Schlaghosen reichten ihm nicht mal bis zu den Knöcheln und ständig zog er diese in regelmäßigen Abständen kräftig nach oben, sodass man sich Sorgen um seine Eier machte, denen er dadurch mit Sicherheit die Blutzufuhr abschnitt. Weiche Knie bekam Marie ganz offensichtlich, als der Hüne „Chappo“ mit seinen voluminösen Afro-Haaren auf uns zumarschierte und mir einige Gramm Haschisch in die Hand drückte. Chappo war ein radikaler Linker, der in die DDR geflüchtet war um dort Asyl zu beantragen. Allerdings schien auch der ostdeutsche Sozialismus nicht das Gelbe vom Ei zu sein, sodass er kurze Zeit später - unter Lebensgefahr, wieder in den Westen ausbüxte. Jetzt hauste er in einer Höhle in einem stillgelegten Steinbruch im Heilbronner Stadtwald. In einem abgelegenen Teil des Parks musizierten Bongo mit seiner Mandoline und Charly, der ihn auf der Mundharmonika begleitete. Einige zugedröhnte Zuhörer hatten sich hier versammelt und starrten zufrieden und gedankenverloren ins Leere. Alles in allem eine recht bizarre und bunte Gesellschaft und somit ein eindrucksvoller Abend für die kleine Französin, die Hippies oder Drogen nur aus der Zeitung oder aus dem Fernseher kannte. Bei unserem anschließenden Streifzug durch die oberhalb der Stadt gelegenen Weinberge registrierte ich mit Genugtuung, wie beeindruckt sie von der ganzen Szene war und gab noch einige kuriose Geschichten über die Freaks im Park zum Besten, die ich natürlich kräftig ausschmückte um Eindruck zu schinden. An ihren ungläubigen, grünen Augen konnte ich den Erfolg meiner Märchenstunde ablesen.
Bis zum vorletzten Tag ihres Besuches war es mir erfolgreich gelungen die Tatsache zu verdrängen, dass diese Beziehung ein „Verfallsdatum“ hatte. Ich schwebte wie auf rosa Wolken durch diese drei Wochen und hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Genauso wie mir mein Hungergefühl oder mein Schlafbedürfnis abhandengekommen war. Am Abend vor ihrer Abreise feierten wir auf einem Gartengrundstück in den Weinbergen eine rauschende Abschiedsparty. Nur am Rande registrierten wir eine dramatische Rettungsaktion, weil ein Freund von Karle aus Liebeskummer eine Flasche Whisky geleert hatte und nun drohte abzukratzen. Helga und die Freundin des unverbesserlichen Zechers waren die ganze Nacht mit dessen Lebensrettung beschäftigt. Marie und ich hatten uns indessen hinter einer Gartenhütte verkrochen und stellten, im hohen Gras versteckt, einen neuen Rekord im Dauerküssen auf. Bei Sonnenaufgang nahm ich Abschied von Marie und sie machte sich mit Helga auf den Weg zum Bahnhof. Jetzt hätte ICH die Flasche Whisky gebraucht. Heulend wie ein Schlosshund lief ich stundenlang durch die Weinberge und konnte mich nicht mehr beruhigen. Meine Gefühle wechselten von größter Trauer zu unbändiger Wut und Selbstmitleid. Ich empfand es als eine ungeheure Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet MIR das Schicksal so zusetzte.
PFARRER GEISTREICH
Es dauerte weitere zwei Wochen bis ich wieder zu essen begann. Zuerst hatte mir die Euphorie den Appetit geraubt - dann der Abschiedsschmerz. Um auf andere Gedanken zu kommen besorgte ich mir zuerst eine Querflöte und kurz darauf eine Geige, auf die ich mir einen Tonabnehmer schraubte. Mit der Flöte hielt ich es wie mit der Gitarre: ich spielte einfach zur Musik vom Plattenspieler, was die Nachbarschaft endgültig auf die Palme brachte. Immerhin gelang es mir in kürzester Zeit „Ruck Zuck“ von „Kraftwerk“ mitzuspielen. Mit Cebe war nicht mehr viel Staat zu machen. Nach seiner Entlassung aus der Klinik absolvierten wir ein paar Proben um einen Gig im Gemeindehaus der Aukirche zu spielen. Es waren mühselige Sessions und es wurde offensichtlich, dass Cebe nicht mehr bei der Sache war und keinen Spaß mehr an unserer Musik hatte. Kurz vor dem vereinbarten Auftrittstermin warf er das Handtuch. Charles, Charly und ich absolvierten den Gig alleine, während Cebe vor der kleinen Bühne im Publikum saß und geistesabwesend unsere Darbietung verfolgte. Immer wieder sorgte er jetzt mit überraschenden Aktionen für Aufregung, indem er sich zum Beispiel spontan dazu entschloss nach Amsterdam zu fahren. Er hoffte, an dem Ort, an dem die Katastrophe seinen Lauf genommen hatte wieder zurück in die Spur zu finden. „Der Kreis sollte sich schließen“. Auf der Fahrt nach Holland hatte er, laut einer Begleiterin plötzlich die Vision Jesus zu sein und stellte sich splitternackt, mitten in der Nacht auf die Autobahn. Nach dieser Aktion landete er wieder für Wochen in der Klinik.
Elke fühlte sich als meine „Schwester“ dafür verantwortlich meine miese Stimmung ein wenig aufzumöbeln. Noch Monate später vermisste ich Marie, und Elke machte sich ernsthafte Sorgen um mich. Sie verkuppelte mich mit ihrer rothaarigen Klassenkameradin Barbara. Dieses Mal hatte sie ein ausgesprochen gelungenes Exemplar für mich ausgesucht. „Babsi“ sah aus wie ein Fotomodell und ich wurde von allen beneidet. Ihre rotblonden Haare reichten ihr bis zur Taille und ihre Beine gingen bis zum Hals. Trotz ihrer erst fünfzehn Jahre waren ihre Brüste beneidenswert. Ihre Haut war makellos wie glattes Ebenholz und im Gesicht trug sie genau die richtige Anzahl an Sommersprossen um der Perfektion noch das Sahnehäubchen aufzusetzen. Barbara wohnte in einer der nobelsten Gegenden der Stadt und es hätte mich brennend interessiert, was wohl ihre Eltern zu ihrem Umgang mit einem „dahergelaufenen Rockmusiker“ aus dem „Hawaii“ gesagt hätten. Leider war sie dumm wie eine Kuh und ich beschränkte mich vor allem darauf, sie überallhin mitzuschleifen, um ordentlich mit ihr anzugeben. Ansonsten war nicht viel mit ihr anzufangen.
Im Herbst dieses Jahres strichen Pfarrer Herrenkind und Fräulein Minke die Segel und verabschiedeten sich in den Ruhestand. Mit dem Nachfolger Reinhold Geistreich wehte plötzlich ein frischer Wind im Gemeindehaus. Geistreich bezog mit seiner Frau Cordulla die winzige Wohnung über dem Kindergarten und stellte uns die Räume im Keller des Gemeindehauses ab sofort „täglich“ zur Verfügung. Er holte uns somit praktisch von der Straße. Wir begannen sofort damit, es uns im Keller so gemütlich wie möglich zu machen. Zuerst verbannten wir das eh schon dürftige Tageslicht, indem wir die Fenster mit schweren Stoffbahnen verhängten. Mit einer Holzwand trennten wir den Raum in zwei Hälften. In einem Teil lagerten wir unsere Verstärker und die Instrumente und benutzten das „Foyer“ als Proberaum. Durch einen schmalen Eingang, der mit einem Tuch zugehängt war, gelangte man ins „Wohnzimmer“, das mit alten Teppichen, Sofas und einem niederen, runden Holztisch eingerichtet war. Elektrisches Licht ersetzten wir durch unzählige Kerzen. Der schlauchartige Raum roch bald nach Kerzenwachs, Tabak, Shit und den muffigen Polstermöbeln vom Sperrmüll, die uns schon wenige Wochen später ganze Heerschaften von Filzläusen bescherten. Fletch war der Erste, der den lästigen Tieren Asyl gewährte und es dauerte nicht lange bis wir alle vollkommen verlaust waren. Eine von Fletch ins Spiel gebrachte Therapie mit Rasierwasser hatte keinen durchschlagenden Erfolg, sodass uns der Weg zur Apotheke nicht erspart blieb. In einer Ecke des Raums bauten Fletch, Heile und Werner eine Holztheke, die sie auch gleich mit den erlesensten, hochprozentigen Getränken ausstatteten. Zu den neuen Stammgästen im Keller gehörte außer Fletch, der frühere Schlagzeuger von Charlys Band Rainer M. (Metzi), auch Klaus H. (Holly), den Charly auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz aufgegabelt hatte. Fletch, der mit richtigem Namen Jürgen F. hieß, war der Einzige von uns der ein Auto besaß. Weil er ein Glasauge hatte, durfte er mit seinem orangefarbenen VW-Käfer nicht schneller als 80 km/h fahren, was aber vollkommen genügte. Wir hatten es selten eilig. Fletch hatte die gleiche Schule wie Charles besucht und arbeitete nach einer abgebrochenen kaufmännischen Ausbildung (weil man ihn beim Klauen erwischt hatte) als Getränkefahrer bei einer Brauerei. Er wohnte nur wenige Häuser von mir entfernt, direkt neben meinem schwulen „Haus- und Hof-Friseur“ Willi Sch. Schon als Kind hatte Fletch sein Auge verloren, als sich bei seinem Freund beim Hantieren mit einer Luftdruckpistole ein Schuss gelöst hatte, der ihn ins Gesicht traf. Fletch machte stets einen freundlichen und ausgeglichenen Eindruck und hatte meist ein gutmütiges Grinsen im Gesicht. Er strahlte eine angenehme Autorität aus, wozu sicher auch die Tatsache beitrug, dass er der Älteste von uns allen war. Holly war so alt wie ich und der Besitzer einer vorzüglichen Plattensammlung, wovon er einen Teil in unseren Keller schaffte. Er infizierte mich mit „King Crimson“, „Atomic Rooster“ und „Zappa“, während ich ihn mit meinem Geklimper ansteckte. Wir verstanden uns auf Anhieb. Holly betrachtete viele Dinge aus seiner ganz eigenen Perspektive und schuf so völlig neue Einblicke. Zusammen mit Charles landeten wir bei unseren Diskussionen nicht selten im Land der Phantasie und der Spinnerei, wozu Metzi den Gegenpol setzte. Metzi war durch und durch Realist, so dass es schon weh tat. Er hatte ebenfalls einen vorzüglichen Musikgeschmack, achtete aber penibel darauf seine – nur selten mitgebrachten Schätze - von „Softmachine“, „Family“ oder „Gentle Giant“ Platten nicht achtlos im Keller herumliegen zu lassen und verbot jedem streng, seine LP´s anzurühren. Dafür bediente er sich gerne und regelmäßig am kollektiven Tabakvorrat. Auch wenn er in seiner unvermeidlichen Kunstlederjacke, ohne die er nie das Haus verließ, eine volle Schachtel Zigaretten stecken hatte. Alle paar Sekunden schob er seine goldgerahmte Brille in die richtige Position und er verzichtete auch bei strahlendem Sonnenschein nicht auf seinen schwarzen „Knirps“ Regenschirm, was sein notorisches Misstrauen nur unterstrich.
Elke wurde jetzt ebenfalls zum ständigen Gast im Keller. Sie hatte sich mit Charles Stiefbruder William zusammengetan und belegte mit ihm die nächsten Monate das einzige einigermaßen saubere Sofa, während wir weiterhin alle paar Tage zum Apotheker rannten. Die Beziehung mit dem „Bruder“ von Charles musste streng geheim bleiben, weshalb sich Elke im Kindergottesdienst nützlich machte, um einen Vorwand für die regelmäßigen Besuche im Gemeindehaus zu haben. Vor allem ihr Vater durfte nicht spitzkriegen, dass Elke einen „Farbigen“ zum Freund hatte.
Die ersten exzessiven Partys feierten wir an Heiligabend und an Silvester dieses Jahres. Genau genommen war es nur eine Party, nämlich die von „Heiligabend bis Neujahr“ nächsten Jahres. Werner verlor zuerst die Kontrolle über unseren Spirituosen-Vorrat und dann über sich selbst, nachdem er sich hinter der Theke durch sämtliche Marken gekämpft hatte. Im Delirium drohte er dem Pfarrer an die Gurgel zu gehen, als sich dieser im Keller vergewissern wollte ob wir noch alle am Leben sind. Werner hatte ihn im Suff nicht mehr erkannt. Es gelang uns im letzten Moment eine Katastrophe zu verhindern, indem wir Werner so schnell wie möglich in unsere Stammkneipe zum „Taubenschlag“ lockten, um ihn in dort an der Bar abzuliefern, wo er, inzwischen wieder bestens gelaunt, erst mal einen halben Liter Bier bestellte. Meine Achtung vor dem Pfarrer wuchs enorm, als dieser später kein Wort über den Vorfall verlor.
1973
Zwischen seinen Krankenhausaufenthalten erschien Cebe immer wieder im Keller. Er saß dann meist wortlos auf einer Matratze und drehte sich eine Zigarette nach der anderen, die er jeweils nur halb rauchte, ausdrückte und sich die nächste drehte. Lauernd lauschte er unseren Diskussionen, als suche er in unserem hirnrissigen Gebrabbel nach einer Lösung für seine Probleme. Seine Bassgitarre rührte er nicht mehr an. Eines Abends überredete er mich, ihn zu einem Termin bei der Scientology-Kirche zu begleiten. Was mich hier erwartete überbot sogar locker unser haschischgeschwängertes sinnloses Gerede im Keller. Cebe war begeistert und buchte bei den Gangstern einen Kurs. Kurze Zeit später erschien er mit einem Album vom „Mahavishnu Orchester“. Das war definitiv Musik von einem anderen Stern. Jazz-Rock mit wahnwitzigen Improvisationen, gespielt von Musikern wie Billy Cobham und Jan Hammer und natürlich ihrem Chef und Ausnahmegitarrist John Mc Laughlin. Ich besorgte mir alle Alben dieser Band und wurde ihr Fan. Zu Cebes Verehrerinnen gehörten Dodo und Ellen. Dodo lebte ebenfalls im Hawaii. Ellen war erst vor wenigen Monaten mit ihrer Mutter Lore nach Heilbronn gezogen, nachdem diese sich von ihrem Mann getrennt hatte. Kennengelernt hatte ich Ellen aber schon zwei Jahre zuvor als sie mit Elle zusammen war. Wir hatten sie damals immer wieder zum Bahnhof Sülmertor gebracht, von wo aus sie mit der Bahn ins zehn Kilometer entfernte Kochendorf nach Hause gefahren war. Jetzt wohnte sie fünf Minuten vom Hawaii entfernt und besuchte mit Dodo, die mit Elle verwandt war dieselbe Schule. Bei den beiden Mädchen löste Cebes verträumt wirkende Ausgeflipptheit eine dramatische und romantische Verklärtheit aus und seine apathische Hilflosigkeit weckte wohl auch ihre Mutterinstinkte. Vor lauter Mitgefühl und Solidarität experimentierten sie ebenfalls mit LSD und gefielen sich darin, nach Gründen für Cebes Psychose zu forschen. Ellen hatte schwarze, lockige Haare und ihr Gesicht glich dem eines pausbäckigen Engels auf den religiösen Gemälden der Künstler aus dem Mittelalter. Sie hatte mir schon während ihrer Beziehung mit Elle gefallen. Als sie nun, zwei Jahre später mit Dodo im Keller auftauchte, drehte ich jedoch noch meine „Angeber-Schaulaufrunden“ mit der roten Barbara.
TEN YEARS AFTER
Anfang des Jahres besuchten Fletch, Charles, Ellen und ich ein „Ten Years After“ Konzert in Stuttgart. Die Band war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und wir sahen einen gigantischen Auftritt. Nach dem Gig stärkten wir uns in einem Schnellimbiss-Restaurant in Stuttgarts Innenstadt, bevor wir kurz nach Mitternacht die Heimreise antraten. Auf der schmalen Rückbank von Fletchs Käfer gab es die ersten Körperkontakte zwischen Ellen und mir. Wenige Kilometer vor Heilbronn fuhr Fletch auf den Parkplatz einer Autobahnraststätte und drehte einen mächtigen Joint. Innerhalb weniger Sekunden war der winzige Innenraum des VW völlig eingenebelt. Während Fletch und Charles in der Gaststätte noch etwas zu trinken besorgen wollten, blieb ich mit Ellen im Auto und wir wickelten uns in eine Decke. Draußen war es bitterkalt. Es dauerte nicht lange, bis zwei Polizisten auf das dampfende Auto aufmerksam wurden. Wir krochen unter die Decke und waren dank der Dunkelheit und des Rauchs unsichtbar. Die Gesetzeshüter suchten nach einer Möglichkeit den Käfer zu öffnen und wir waren heilfroh, dass Fletch die Türen verriegelt hatte. Als ihnen klar wurde, dass der Wagen nicht ohne Gewalt zu knacken war, liefen sie in Richtung Restaurant davon, um dort den Besitzer ausfindig zu machen. Sicher befürchteten sie einen Schwelbrand im Innern des Autos. Fast gleichzeitig tauchten grinsend Charles und Fletch auf, die hinter einer Hecke nur auf den Abzug der Beamten gewartet hatten und wenige Augenblicke später rollten wir langsam und ohne Scheinwerferlicht vom Parkplatz und verschwanden in der Nacht. Dankbar und übermütig beschlossen wir unserem neuen Pfarrer eine kleine Freude zu bereiten und den Gottesdienst an diesem Sonntagvormittag zu besuchen. Übernächtigt und high erreichten wir die Aukirche und zwängten uns zwischen eine der hinteren Kirchenbänke. Geistreich war so gerührt, dass er während seiner Predigt Tränen in den Augen hatte, trotz der missbilligenden Blicke einiger alter und ehrwürdiger Gemeindemitglieder in unsere Richtung.
Wenige Tage später waren Ellen und ich ein Paar. Der roten Barbara gab ich den Laufpass. Schließlich hatte ich lange genug mit ihr „angegeben“. Wir hatten rein gar nichts Gemeinsames miteinander gehabt und kaum fünf Sätze miteinander gesprochen. Auch Ellen musste man nicht verstecken. Ich war stolz darauf, wenn vorbeifahrende Autos hinter uns her hupten, weil Ellen mal wieder keinen BH unter ihrer durchsichtigen Freak-Bluse trug. Unsere Beziehung begann durchaus harmonisch. Meist trafen wir uns im Keller oder wir saßen im „Taubenschlag“, wo in regelmäßigen Abständen die Industriebahn auf den Gleisen auf der Straße direkt am Fenster der Kneipe vorbeifuhr (für Ortsfremde ein eher surreales Erlebnis). Unsere erste gemeinsame Nacht verbrachten wir - nach einer wüsten Faschingsparty in Goolys neuer Gaststätte „Zur Au“ - in Fletchs VW-Käfer, den er vor seinem Haus geparkt hatte und wo uns in der kalten Februarnacht fast die Füße erfroren. Ellen war als Hure verkleidet und trug über schwarzen Netzstrümpfen einen super kurzen Minirock, was die Temperatur im Innern des Autos wenigstens ein wenig in die Höhe trieb. Mit Ellens Mutter Lore verstand ich mich prima. Sie sorgte mit ihrer spontanen Einwilligung dafür, dass sich die fünfzehnjährige Ellen die Pille verschreiben lassen konnte. Erst später begriff ich Lores „großzügige“ Erziehungsmethoden. Eigentlich hatte sie gegen ihre Tochter keine andere Chance, wenn sie keinen Krach riskieren wollte. Und das wollte sie nicht! Sie überließ uns die Wohnung, wenn wir uns zu einem gemütlichen Fernsehabend entschlossen hatten und zog sich solange in die Küche zurück. Diese Abende wurden leider immer häufiger zur Regel. Wir nisteten uns in Lores Wohnung ein, vor allem auch weil ich hoffte, Ellen vom Au-Keller fernzuhalten, wo die Versuchung für „LSD-Experimente“ stets präsent war. Wir hörten „Crosby, Stills, Nash and Young“, färbten meine Haare - die nach einem handfesten Streit mit meinem Vater endlich nicht mehr vom schwulen Willi gekappt wurden – mit Henna knallrot und bestickten unsere Klamotten mit farbigen Blumen und Ornamenten. Oder wir erfüllten uns unseren T raum und „coverten“ John Lennons und Yoko Onos „Bed In“ - Aktion, wozu wir eine Woche nicht das Bett verließen, was allerdings - im Gegensatz zu Lennons Meeting – niemanden (außer Winne) interessierte, mit dem ich per Spielzeug-Telefon die einzige Verbindung zur Außenwelt aufrecht hielt.
Unsere Band war nun endgültig auf Eis gelegt seit Charles tatsächlich zur Armee eingezogen worden war. Charly war mit Dodo zusammen und versank im Liebes- und Haschischrausch. Es gab nur wenige Gelegenheiten eine Session durchzuziehen, und wenn, waren es absolut abgefahrene Jams mit Holly, Zapf oder Buddy, die meist übel aus dem Ruder liefen und die zudem dem Schlagzeug von Charles ziemlich zusetzten, weil sich vor allem Buddy recht intensiv mit dem Instrument auseinandersetzte. Nach diesen Lärmorgien gab es regelmäßig Zoff mit Ellen, die mir die Hölle heiß machte, weil sie sich von mir vernachlässigt fühlte. So sorgten wir dafür, dass wir uns gegenseitig mehr und mehr die Luft nahmen und die Freiheit raubten. Ich vermisste meine Freunde, meine Musik und die Federballturniere am Luftschutzbunker. Mein Versuch, Ellen vom LSD fernzuhalten waren dagegen sinnlos. Was sie tagsüber mit Dodo trieb, mit der sie zusammen die Schule besuchte, entzog sich meiner gutgemeinten Kontrolle.
Dann beschlossen wir, uns einem freiwilligen Arzneimittel-Test zu unterziehen, um die versprochene Wirkung der Anti-Baby-Pille zu testen. Lore hatte angekündigt über das Wochenende ihren Bruder auf dem Land zu besuchen. Ellen versicherte mir, dass Lore erst am Sonntagabend zurück sein würde. Eine günstige Gelegenheit. Am Samstagnachmittag machte sich Ellens Mutter auf den Weg zum Bahnhof und wir begannen mit den Vorbereitungen zu dem spektakulären Experiment. Kerzenlicht, Räucherstäbchen und gedämpfte Musik verwandelten Ellens Zimmer in eine wahre Liebeshöhle, die uns derart unter Druck setzte, dass erst mal gar nichts lief. Als es nach einer gefühlten Ewigkeit endlich begann interessant zu werden, klingelte es an der Tür. Es war schon weit nach Mitternacht, und ich wusste sofort, dass etwas schiefgelaufen sein musste. Es war klar, dass dies nur Lore sein konnte. Ellen blieb erstaunlich gelassen und weigerte sich konsequent die Türe zu öffnen. Stattdessen beichtete sie mir, dass Lore gar nicht geplant hatte über Nacht weg zu bleiben und sie deshalb den Hausschlüssel aus ihrer Handtasche geklaut hatte um wirklich ungestört zu sein. Immer wieder rasselte die verdammte Türglocke, wobei mir jeder Ton fast körperliche Schmerzen verursachte, während Ellen sich unter der Bettdecke verkroch und mir streng verbot die Türe zu öffnen. Durch einen Schlitz im Fenstervorhang beobachtete ich, wie Lore nach der minutenlangen Klingelorgie, mitten in der Nacht und in der Kälte in Richtung Telefonzelle lief, die ungefähr zweihundert Meter entfernt war. Ich fühlte mich hundsmiserabel. An weitere Tests war nicht mehr zu denken. Mein gesamtes Blut war in meinen Beinen versackt. Auf jeden Fall war es nicht dort, wo es für den Test nötig gewesen wäre. Noch vor Sonnenaufgang machte ich mich aus dem Staub um Lore nicht über den Weg laufen zu müssen. Diese hatte sich, nach dem vergeblichen Versuch in ihre Wohnung zu gelangen, ein Taxi gerufen und war zu ihrem Bruder zurückgefahren. Wie Ellen es schaffte, am nächsten Tag die ganze Geschichte zu beichten ohne das Lore sie zum Teufel jagte blieb mir ein Rätsel. Ich hatte sogar beinahe den Eindruck, dass es Lore peinlich war uns "gestört" zu haben. Ich ahnte nicht, dass ich bald selbst ein ähnliches Verhalten an den Tag legen würde, denn es wurde langsam immer ungemütlicher. Ellen war so launisch wie Aprilwetter und es erforderte eine Menge Kompromissbereitschaft den Frieden zu wahren. Immer wieder erwischte sie mich auf dem falschen Fuß. So erfuhr ich, dass Charles Dodo und Ellen heimlich mit LSD versorgt hatte. Dann beichtete sie mir, mit Dodo wochenlang die Schule geschwänzt zu haben. Was die Beiden in dieser Zeit getrieben haben, hab ich nie erfahren und wollte es auch nicht mehr wissen. Jetzt, da die Geschichte drohte aufzufliegen, weil ein Brief der Schulleitung an ihre Mutter unterwegs war, bat mich Ellen mit Lore zu reden bevor der blaue Brief eintrudelte. Weil sie wusste, dass diese ziemlich große Stücke auf mich hielt, hoffte sie, dass ich sie besänftigen könnte. Ein toller Job, wenn man bedenkt, dass mich die Sache selbst ganz schön mitnahm. Aber immerhin gelang es mir Lore mit einer kuriosen Story ruhig zu stellen. Weil Ellen die Pille eher zufällig statt regelmäßig einnahm, glaubte sie irgendwann schwanger zu sein. Irrsinniger weise wünschten wir uns in unserer mittlerweile absolut verfahrenen Lage nichts sehnlicher als ein Kind. Vielleicht weil wir hofften, so die entstandenen Risse in unserer Beziehung zu kitten. Als sich die Schwangerschaft als Irrtum entpuppte, hatte ich größte Mühe Ellens Wut zu besänftigen. Gleichzeitig sagte mir ein letzter Rest an Verstand, dass wir wohl mächtig Dusel gehabt hatten.
Bei einem meiner selten gewordenen Besuche im Au-Keller erfuhr ich, dass meine Framus-Gitarre verschwunden war. Dummerweise hatte ich sie wochenlang im Keller zurückgelassen. Angeblich hatte sie Buddy zu einer Session mitgeschleift und sie nicht mehr zurückgebracht. Nur vor lauter Angst, dass Ellen noch weiter im Drogensumpf versinken könnte schaffte ich es nicht unsere Beziehung zu beenden. Allerdings tat ich auch nichts mehr, um unser Verhältnis zu retten und nach einigen weiteren quälenden Wochen schaffte es dann wenigstens Ellen einen Schlussstrich zu ziehen. Es ging mir erst mal ziemlich mies und ich vermisste in den ersten Tagen sogar den verhassten täglichen Gang in Ellens qualvolles „Gefängnis“. Helga und die rothaarige Andrea kümmerten sich ab jetzt mütterlich um mich und versuchten mich mit Monopoly spielen und anderen Albernheiten auf andere Gedanken zu bringen. Nach einer Woche verzog sich der graue Nebel in meinem Kopf und es durchströmte mich ein wahres Glücksgefühl. Schlagartig wurde ich mir meiner wieder gewonnenen Freiheit bewusst und ich begann damit, alles was mich an Ellen erinnerte aus meinem Zimmer verschwinden zu lassen. Ich kramte meine Federballschläger hervor und meldete mich überglücklich bei meinen Kumpels am Luftschutzbunker zurück. Wenig später war Ellen mit „Bomber“ zusammen. Dieser lebte, nachdem sein Vater bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen war mit seiner Mutter auf der anderen Seite der Schienen in einer Drei-Zimmer-Wohnung unterm Dach. Aufgewachsen war er im selben Block wie Charles, Cebe, Charly, Werner, Heile, Hankes und Elle. Im Gegensatz zu mir hatte Bomber keine Probleme mit Ellens Drogenexperimenten, da er selbst kräftig mitmischte und es dauerte nicht mehr lange bis die Beiden an der Nadel hingen. Ein Typ namens Lutz war einer der ersten, der Heroin in den Keller brachte. Er war es auch, der Ellen und Dodo den ersten Schuss verpasste. Entgegen meiner Befürchtungen ließ mich die Tatsache, dass Ellen immer tiefer in den Schlamassel geriet relativ kalt. Mit der Beziehung war auch die vermeintliche Verantwortung von mir abgefallen. Fast panisch reagierte ich dagegen, als Ellen meinen Eltern zufällig über den Weg lief und diese mir hoffnungsvoll verkündeten, dass Ellen mich besuchen wolle. Sie wussten nichts von dem Desaster der letzten Monate und hatten eher mit Unverständnis auf das Ende unserer Beziehung reagiert. Ich verkroch mich daraufhin tagelang am nahe gelegenen Neckarufer (wo ich wenige Jahre zuvor noch als Huckleberry Finn „gelebt“ hatte). Dies war der einzige Ort, an dem ich mich einigermaßen sicher fühlte.
HAWAII
Überhaupt wurde mir in diesen Wochen die fast ländliche Idylle im Hawaii bewusst und wie sehr ich diese, während der Monate mit Ellen vermisst hatte. Wir lebten hier wie in einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Während unserer „Sitzungen“ am Luftschutzbunker beobachteten wir die „Szene“ und „überzeichneten“ dabei stundenlang die kuriosen Persönlichkeiten unserer kleinen Welt. Nicht selten wurden wir während unserer Studien Zeugen wüster Prügeleien in - oder vor der Gaststätte „Traube“, direkt gegenüber unseres Treffpunkts. Bei diesen willkommenen Abwechslungen unterbrachen wir sogar unser Federballspiel und nahmen unsere Plätze in der ersten Reihe ein - einem würfelförmigen Bunker-Notausstieg aus Beton. Hier schlossen wir mit Karle Wetten über den Ausgang der Boxkämpfe ab. Weitere Zaungäste solcher Darbietungen waren „Onkel Helmut“ nebst Familie. Er war der Onkel von Karle, wohnte im Haus nebenan und hatte uns, als wir noch Kinder waren immer damit gedroht, uns die „Ohrlappen abzuschneiden“. Dann war da noch Karin. Sie hatte mit ihren geschiedenen Eltern und ihren zwei Schwestern ein Stockwerk unter uns gewohnt. Karin wog gute zweieinhalb Zentner und wohnte mit ihrem etwa zehnjährigen Sohn Thommy im gleichen Haus wie Winne. Mit ihrer gleichaltrigen Freundin Elke S., die eine Etage über uns gewohnt hatte, war sie oft der Grund für die Schlägereien in der Kneipe, da sie den besoffenen Gästen mit ihrem ordinären Geschwätz den Kopf verdrehte. Dafür gab es für Karin regelmäßig Prügel von ihrem Lebensgefährten. Der Krach, den die zwei dann nachts veranstalteten hallte vielfach verstärkt durch den Hinterhof zwischen den beiden Häusern, sodass an Schlaf nicht mehr zu denken war. In der Wohnung unter uns in der Karin aufgewachsen war, lebte seit einigen Monaten die Familie Sch. Frau Sch. war ebenfalls alleinerziehend und einer ihrer erwachsenen Söhne teilte mit seiner Mutter das Ehebett. Wenn er Einen in der Krone hatte war er fürchterlich eifersüchtig und machte seiner Mutter die Hölle heiß. Als ich eines nachts leicht benebelt von einem Besuch auf dem jährlich stattfindenden Volksfest nach Hause kam, hatte sich die bedauernswerte Frau gerade in der Wohnung meiner Eltern verschanzt, weil sie von ihrem betrunkenen Sohn mit einer geladenen Flinte bedroht worden war. Wie ich durch meinen „Nebel“ heraushören konnte, hoffte die Frau, dass ihr Sohn inzwischen eingeschlafen war. Damit würde keine Gefahr mehr von ihm ausgehen: „Wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, erinnert er sich eh an nichts mehr!“
Dann wurde ihnen bewusst, dass ich als Einziger noch in den Kleidern steckte und sie machten mir den beneidenswerten Vorschlag die Lage zu peilen und nachzusehen, ob der Trunkenbold tatsächlich hinüber war. Durch die damals noch ungewohnte Dosis an Alkohol in meinem Blut dachte ich keine Sekunde an eine mögliche Gefahr und schlich barfuß ein Stockwerk tiefer. Die Wohnungstüre war nur angelehnt, sodass ich geräuschlos in den Flur gelangte. Die Tür zum Schlafzimmer war ebenfalls geöffnet und der Sohn von Frau Sch. lag zum Glück friedlich schlummernd, mit dem Gewehr im Arm im Bett. Ansonsten hätte er mich wohl erschossen. Ich machte, dass ich nach oben kam, gab Entwarnung und verschwand sofort in meinem Zimmer, das ich sicherheitshalber verriegelte.
Nicht ganz so glimpflich verlief eine Prügelei vor der „Traube“, in die ich selbst verstrickt war. Durch meine relativ langen Haare und die Tatsache, dass wir unsere Erdnussschalen und unseren Speichel regelmäßig vor der Kneipe verteilten gab es Ärger mit dem Wirt. Nach einem Wortwechsel war ich der erste und auch einzige, den er zu fassen kriegte und den er sich dann auch gleich gehörig zur Brust nahm. Gegen den robusten Riesen mit der Statur eines Catchers hatte ich keine Chance. Das Ergebnis dieses ungleichen Kampfes war eine aufgeplatzte Lippe, eine blutende Nase und ein „Hähnchen vom Wienerwald“ als Trost von Karle, der sich köstlich amüsiert hatte. Außerdem war ich als „Opfer“ für einige Stunden der unangefochtene Held unserer Truppe. Solche Erlebnisse förderten das Nachbarschafts-Zusammengehörigkeitsgefühl ungemein.
Die heißesten Tage dieses Sommers verbrachte ich in der Paketabfertigung des Zollamtes. Ein angenehmer Job, da die tägliche Kontrolle, der aus dem Ausland zu verzollenden Postsendungen, in höchstens drei Stunden erledigt war. Spätestens gegen halb zwölf machte ich mich dünne und verschwand entweder in Richtung Freibad oder auf den Kaiser-Wilhelm-Platz. Die restlichen Stunden, an zu absolvierender Arbeitszeit vermerkte ich im Berichtsheft als „Selbststudium“ was eh niemand hinterfragte. Einmal im Monat wurde zur stichprobenartigen Untersuchung der Rauschgiftspürhund durch die, mit Paketen vollgestopften Diensträume gejagt. Ich hatte das Glück wenigstens einmal Zeuge dieser Nummer zu sein. Es wäre jedoch von Vorteil gewesen, mich vorher vor der feinen Nase des Köters zu warnen, denn dann hätte ich sicher eine frisch gewaschene Hose angezogen. Nach Eintreffen des riesigen Schäferhundes dauerte es nämlich nur wenige Sekunden bis er mich gewittert hatte. Den völlig überraschten Zollbeamten hinter sich herziehend steuerte er direkt auf mich zu und attackierte mich unfair knapp unter der Gürtellinie. Offensichtlich hatten ihn einige mikroskopisch kleine Haschisch-Krümel in meiner Jeans auf Trab gebracht und nur das konsequente Einschreiten der Beamten konnte verhindern, dass mir das Tier die Hose in Stücke riss, wobei diese auch dann nicht viel schlimmer ausgesehen hätte. Ich versuchte gar nicht erst mich mit fadenscheinigen Ausreden herumzuschlagen und verbrachte den Rest der Hunde-Suchaktion auf der Toilette.
Gleichzeitig mit Charles war auch Werner zum Wehrdienst eingezogen worden, brannte aber schon während der Grundausbildung durch und beantragte Asyl bei unserem Pfarrer. Dieser erlaubte ihm, wenn auch widerwillig, wenigstens vorübergehend im Keller zu hausen. Selbst Emma, seine Mutter hatte keine Ahnung, dass Werner nur wenige hundert Meter von zu Hause entfernt vorübergehend im Au-Keller eingezogen war und konnte den Feldjägern, die auch bei ihr nach dem Fahnenflüchtigen suchten keine Auskunft geben. Während sich der Pfarrer sicher mit seinem Gewissen herumschlug und die Staatsmacht weiter nach ihrem Abtrünnigen fahndete, labte sich Werner an unserer noch immer reichlich bestückten Hausbar um die Zeit totzuschlagen. Wenn wir am späten Nachmittag im Keller auftauchten war er schon dementsprechend angeschlagen und entweder derart melancholisch, dass er sterben wollte, oder auf Ärger aus war. Wir hatten alle Mühe ihn auf andere Gedanken zu bringen. Es war offensichtlich, dass sein selbstgewähltes Gefängnis keine längerfristige Lösung war. In immer kürzeren Abständen wurde er unvorsichtig und streifte am Abend durch die Kneipen im Hawaii, wo er oft eine Spur der Verwüstung hinterließ, bis ihn die Militärpolizei dann doch schnappte und in seiner Kaserne in eine Arrestzelle steckte.
Die Kaserne von Charles war etwa zweihundert Kilometer entfernt, sodass er nur am Wochenende aufkreuzte. Genau wie ich hatte er in den letzten Monaten sein Instrument aus den Augen verloren, welches für jedermann zugänglich in unserem Proberaum stand und sich langsam aber sicher auflöste. Als er es endlich in der Besenkammer einschloss war es für das Drum schon fast zu spät. Unsere Lage war ziemlich verfahren. Cebe hatte seinen Bass an den Nagel gehängt und versuchte verzweifelt wieder zu sich selbst zu finden. Meine selbstgebastelte Gitarrenanlage hatte endgültig den Geist aufgegeben und gab nur noch Pfeiftöne von sich, während meine Gitarre verschwunden blieb. Das Schlagzeug war größtenteils ruiniert und Charles nur an den Samstagen im Keller und bei unserem Dynacord-Verstärker waren die Transistoren durchgebrannt, was einem Totalschaden gleichkam. Wenn ich nicht bis in alle Ewigkeit nur Federball spielen wollte, musste eine neue Gitarre her. In dem Musikgeschäft das auf meinem Weg zur Arbeit lag hatte ich eine, im Schaufenster hängende Fender-Stratocaster entdeckt. Ich rechnete mir aus, dass ich ein halbes Jahr brauchen würde um das nötige Geld dafür zusammenzukratzen. Ich schaffte es in vier Monaten, indem ich mit dem Rauchen aufhörte. Zweimal am Tag lief ich in dieser Zeit am Laden vorbei und atmete jedes Mal auf, wenn die Gitarre noch im Schaufenster hing. Ende Oktober hatte ich es geschafft. Mit einem ganzen Bündel Geldscheine ging ich ins Musikgeschäft und erlöste die „Sunburst-Strat“ von ihrem Haken.
GITARRE; RADIO UND KONGAS
Ab jetzt war es mit der Ruhe im Haus wieder vorbei. Das Radio meines Vaters wurde erneut zur Gitarrenanlage zweckentfremdet. Mit meinem Freund Peter H., der sich Bongos und Kongas zugelegt hatte, gründete ich eine Band. Wir spielten eine Mischung aus Pink Floyd und Krautrock. Um in Ruhe proben zu können und den Junkies aus dem Weg zu gehen, die sich dank Lutz, Ellen und Bomber mittlerweile im Keller ganz schön breitgemacht hatten, nisteten wir uns in der Waschküche des Gemeindehauses ein und machten mit dem Tonbandgerät von Annette - einer Freundin von Peter – Aufnahmen von unseren Jams, zu denen ich das riesige Radiogerät von zu Hause jedes Mal mit in die Waschküche schleifte. Dank meines Verzerrers machte das Teil immerhin genug Lärm um sich gegen die Trommeln von Peter durchzusetzen. Außerdem benutzte ich den verfügbaren Reverb-Effekt des Radios um einen „wall of sound“ zu erzeugen, mithilfe meines Wohnungsschlüssels, den ich wie einen Geigenbogen über die Saiten direkt am Tonabnehmer gleiten ließ.
Annette war die beste Freundin von Peters Flamme Tina und hatte sich, laut Peter, in mich verliebt. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, da ich von einer festen Beziehung erst mal die Schnauze voll hatte. Ich genoss es lieber frei von partnerschaftlichen Verpflichtungen und angefeuert von einigen Schlucken Hochprozentigem aus unserer Bar, den Draufgänger zu spielen. Es verirrten sich hin und wieder neugierige Mädels in unseren Raum, von denen ich schnell eine um den Finger wickeln und auf eines unserer verlausten Sofas locken konnte. Nach einer solchen, meist spontanen Aktion, spielte ich dem verdutzten Opfer am Tag darauf eine alkoholbedingte Amnesie vor und stellte so den Zeiger wieder auf Null. So täuschte ich einen Kontrollverlust vor, um die Affären zu kontrollieren. Nach der atemlosen, traumatischen Zeit mit Ellen wollte ich einfach erst mal nur „Luft holen“. Erstaunlicherweise ließ sich Annette nicht so leicht abwimmeln. Obwohl ich ihr klargemacht hatte, dass ich für eine neue Beziehung noch nicht bereit war, fuhr sie fast jeden Tag mit der Bahn die zwanzig Kilometer von ihrem Heimatort nach Heilbronn, setzte sich auf mein Bett, trank unzählige Tassen Tee und drehte eine Zigarette nach der anderen. Im Gegensatz zu den One-Night-Stands im Au-Keller behandelte ich Annette mit Respekt und ersparte ihr die lausige Couch im Au-Keller, da sie wirklich in Ordnung war. Vielleicht war Annette nicht ganz so hübsch wie meine Ex-Freundinnen, aber sie war charmant und intelligent. Zudem war sie recht selbstbewusst. Sie war fast so groß wie ich und hatte eine klasse Figur, wenn auch ziemlich wenig Busen. Meistens trug sie schwarze Hosen und schwarze Pullis, die sie offensichtlich selbst strickte. Ihre halblangen Haare waren schwarz gefärbt und passten gut zur schwarz-gerahmten, runden Brille. So wie auch ihr stets leicht melancholischer Blick durch ihre verspiegelten Gläser. Dieser Blick suggerierte mir ständig, der Schuldige an ihrer chronischen Traurigkeit zu sein. Sie legte eine unglaubliche Geduld an den Tag, und erst eine vierwöchige Fortbildung kurz vor Weihnachten unterbrach die täglichen Besuche. Peter und ich teilten uns in dieser Zeit ein Zimmer in einem Postwohnheim in Stuttgart, das zur Schule gehörte in der wir täglich unseren Unterricht genossen. Wir wurden Zeugen, wie sich unsere Arbeitskollegen einen Monat lang kollektiv ins Koma soffen und ihre Zimmer, ihre Betten und die Flure vollkotzten. Ich badete mich stattdessen in wohligem Selbstmitleid, verschwand in meiner freien Zeit im nahe gelegenen Wald, malte, las Hermann Hesse und Albert Camus und glaubte dem Sinn des Lebens ganz dicht auf der Spur zu sein. Nach dem Seminar wurde es dann doch noch eng, als ich Annette in einem unüberlegten Reflex zum Abschied küsste. Sie hatte mir auf unserem regelmäßig abendlichen Weg zum Bahnhof ein kleines Weihnachtsgeschenk zugesteckt und ich war wirklich gerührt. Zum Glück sahen wir uns erst nach den Feiertagen wieder und ich tat so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Dennoch litt ich unter der gestiegenen Erwartungshaltung und grübelte über einen Ausweg aus der verfahrenen Situation. Statt in Ellens Gefängnis saß ich nun immer öfter in meinem Zimmer, trank Rauchtee und hörte “Folk- Rock“. Zudem versuchten Peter und Tina mich in ihren Bekanntenkreis zu integrieren, wo eine Menge Rauchtee getrunken, Folk- Rock gehört und altklug daher gefaselt wurde. Zu Silvester hatte Peters Freundin Tina eine Party geplant und natürlich waren Annette und ich zu dem Fest eingeladen. Verzweifelt suchte ich nach einer triftigen Ausrede und täuschte eine Magenverstimmung vor, als Annette am Abend auftauchte um mich abzuholen. Ich begleitete sie noch bis zu Tinas Haus, „bekam unterwegs einige Magenkrämpfe“ und machte mich nach dem Abschied von Annette direkt auf den Weg zum Au-Keller. Hier traf ich überraschend auf Zapf. Wir besorgten uns einen Kasten Bier, bauten die letzten funktionierenden Reste unserer Verstärker auf und begannen eine Session die erst beendet war, als der Kasten leer und das alte Jahr längst vorbei waren. Wir zelebrierten eine wahre Rock‘n Roll-Messe mit Liedern wie „Good Morning Little Schoolgirl“, „Little Queenie“ und „Carol“ und verpassten so glatt den Jahreswechsel. Dafür beschlossen wir, sofort eine Band zu gründen und Johnny Winter nachzueifern. Damit waren die Würfel gefallen! Annette hasste den Au-Keller, Rock‘n Roll und Bier und ich traf mich ab jetzt so oft es ging mit Zapf. Es dauerte nicht mehr lange, bis Annette die Schnauze voll hatte und sich ausgerechnet in einen der Junkies im Keller verliebte. Mit diesem seilte sie sich ab und wir verloren uns aus den Augen.