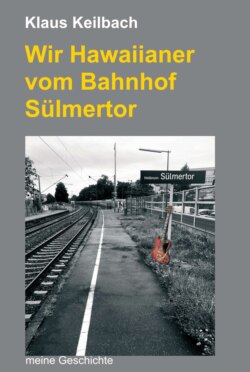Читать книгу Wir Hawaiianer vom Bahnhof Sülmertor - Klaus Keilbach - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1971
CHARLES
Unseren Proberaum im Au-Keller teilten wir seit kurzem mit der Band von Charly S. „Red Ballon“. Mit Charly hatte ich den Kindergarten, ein Stockwerk über dem Au-Keller besucht. Charly war einer der nicht wenigen Farbigen im Hawaii. Er lebte bei seiner Oma ebenfalls in der Christophstraße. Sein amerikanischer Vater hatte Deutschland schon lange verlassen. Seine Mutter wohnte mit Charlys Stiefschwester in einem Nachbarort. Charly spielte Gitarre und sang. Sein Bassist war Andreas (Cebe) C., der mit seinem jüngeren Bruder und seiner Mutter im selben Haus wohnte. Sein Vater war vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Die Familie stammte ursprünglich aus Polen. Cebe hatte ebenfalls das Gymnasium besucht. Er war ein relativ ruhiger, introvertierter Zeitgenosse. Er hatte lange blonde, bis zu den Schultern reichende Haare. Der Schlagzeuger von „Red Ballon“ hieß Charles Koch. Er lebte ebenfalls mit einem Stiefbruder bei seiner Pflegemutter „Emma“ im selben Haus wie Elle. Auch der Vater von Charles war ein farbiger GI-Soldat, der Charles Mutter verlassen hatte. Diese hatte ihn daraufhin in ein Heim gegeben und Emma hatte ihn und seinen „Bruder“ William adoptiert. Charles war drei Jahre älter, aber fast einen Kopf kleiner als ich. Auch er hatte dunklere Haut und lockige, schwarze Haare, die durch einen akkuraten Seitenscheitel eine unsymmetrische Frisur abgaben. Durch seine Statur und seine Haare glich er optisch noch ein wenig dem Schauspieler Charly Japlin. (oder auch dem späteren „Tanzbär“ von Frank Farians Plastik Pop Band „Boney M“). Red Ballon versuchten sich an Songs wie „Bad Moon Rising“ oder „House Of The Rising Sun“. Seit wir den Proberaum mit ihnen teilten, begannen unsere Diskussionen über einen Drummer Wechsel. Das Verhältnis zwischen Elle und Webse hatte sich zwar wieder etwas normalisiert, aber dicke Freunde würden sie wohl nicht mehr werden. Elle brachte das Thema immer wieder auf den Tisch. Er hoffte, dass wir uns Charles angeln könnten, der tatsächlich der bessere Schlagzeuger war. Außerdem hatte Charles schon Erfahrung mit Haschisch gemacht, was uns mächtig imponierte. Webse hatte schließlich auch noch seinen Heimvorteil verspielt, als er mit seiner Mutter vom Hawaii weggezogen war. Wir lagen also auf „Lauerstellung“ und warteten nur noch auf den günstigen Moment. Und plötzlich ging es ganz schnell: Elle hatte mit Charles verhandelt, dem die Möglichkeit in einer besseren Band zu spielen sicher schmeichelte. Bei unserer nächsten Probe ließ es sich Elle nicht nehmen Webse rauszuschmeißen. Gleichzeitig forderte er ihn auf, auch gleich sein Drum verschwinden zu lassen. Er wollte wohl auf „Nummer sicher“ gehen. Webse, der stets mit seinem Mofa in den Au-Keller fuhr, blieb nichts weiter übrig, als seine Trommeln und Stative auf dem Mofa zu verschnüren und weinend machte er sich, am hämisch grinsenden Elle vorbeifahrend aus dem Staub. Charlys Band hatte sich somit aufgelöst und wir hatten den Abstellraum wieder für uns alleine.
Die wöchentlichen Proben wurden immer öfter zu richtigen kleinen Auftritten. Mit jeder weiteren Probe tauchten mehr Leute im Keller auf. Darunter auch die Klassenkameraden von Charles, Werner (Wänn) Carle, Günther (Heile) Heilemann und Jürgen Sparwasser. Werner wich Charles nicht von der Seite. Er fühlte sich für ihn verantwortlich. Er war die Sorte Mensch, die zuerst zuschlägt und dann fragt, „um was es eigentlich geht“. „Heile“ sah dagegen um einiges gefährlicher aus. Er hatte schwarz gefärbte, nach hinten gekämmte Haare und trug am liebsten seine Jeansjacke mit den abgeschnittenen Ärmeln. Heile sah aus wie einer der Hells Angels Rocker, die ich im Hydepark-Film der Stones gesehen hatte, war aber eigentlich ein eher sanfter Mensch. Sparwasser war ein dünner Schlacks, der mit seiner Rock‘n Roll Frisur aussah wie der junge Rudi Carrell. Höhepunkt unserer „Konzerte“ war unsere halbstündige Version von „Satisfaction“. Der ständige sich wiederholende Refrain versetzte den ganzen Keller in Trance. Eines Abends fiel Elle während der Darbietung des Songs in Ohnmacht und musste „wiederbelebt“ werden. Nachdem man ihn wachgerüttelt hatte schüttelte er sich kurz und spielte weiter, als wäre nichts gewesen. Charles verpasste unserer Musik jede Menge mehr Druck und war somit sicherlich ein Gewinn für die Band.
Die Schule hatte sich für uns fast vollständig erledigt. Wir sorgten für einen gehörigen Sicherheitsabstand, während Laichert eher froh war, uns nicht zu sehen, um mit dem Rest an Lernwilligen einen einigermaßen geregelten Unterricht durchziehen zu können. Auf die Vorlage von schriftlichen Entschuldigungen verzichtete er großzügig. Statt Schule war für uns also der „Schulbäcker“ angesagt. Rolf war nach Webse der Nächste, der mit dem Mofa auftauchte. Bisher war ein Klapprad sein ständiger Begleiter gewesen. Sein Mofa hatte er mit allem möglichen Schnickschnack ausgestattet. An der Lenkstange hatte er auf einem Holzbrett ein selbst konstruiertes Armaturenbrett angebracht, mit dem er über unzählige Schalter und kilometerlange Kabelstränge, Scheinwerfer und Blinklichter ansteuerte. Außerdem hatte er ein Kofferradio installiert, an das er mindestens vier Lautsprecher angeschlossen hatte. Alle Blinklichter und Hebel konnten jedoch nicht verhindern, dass das Zweirad eines Tages unbemannt, bei laufendem Motor vom Ständer sprang und führerlos gegen die Hauswand vom Schulbäcker krachte. Es dauerte nicht lange bis Rolf nach dem Totalschaden mit einem neuen Moped aufkreuzte. Weil es geschneit hatte, hatte er Seile um die Räder gewickelt, die Schneeketten ersetzten sollten. Genau genommen war Rolf unser erster Roadie und Techniker überhaupt. Noch während wir auf Wandergitarren spielten, hatte er über sein Kofferradio unsere Gitarren verstärkt, die wir mit einem Tonabnehmer ausgestattet hatten. Das Radio befestigte er mit einem Haken an der Zimmerdecke, wo es freischwebend über unseren Köpfen baumelte. Die Ausbeute an Lautstärke war äußerst gering. Man hörte praktisch nichts, wenn man nicht sein Ohr direkt auf den winzigen Lautsprecher presste. Mittlerweile flickte er vor allem unsere anfälligen Gitarrenkabel und suchte Mittel und Wege, um unsere alten Röhrenradios lauter zu machen. Auch hier war die Ausbeute eher gering. Vom Schulbäcker hielten sich die Mädchen weitestgehend fern. Die Späße, die wir hier zum Teil abzogen, waren ihnen dann doch eine Nummer zu krass. Vor allem das berüchtigte und äußerst unterhaltsame „Dotsches“, was nichts anderes war, als dem Nächstbestem unerwartet und mit voller Wucht in die Eier zu hauen. Lauer und Lallefatz liefen in dieser Disziplin stets zur Höchstform auf. Angefeuert von der ganzen Meute jagten sie sich immer wieder den Gehweg entlang, um sich gegenseitig zeugungsunfähig zu schlagen.
Etwa um diese Zeit, am Anfang des letzten Schuljahres, verkehrten Elle und Charles öfter in der Diskothek Top Ten Club. Die Gäste dieses Lokals waren überwiegend Amerikaner, die sich hier vom eintönigen Kasernenalltag erholten und nebenbei einen kleinen florierenden Haschisch-Handel betrieben. Elle besorgte sich eines Abends einige Gramm Shit und stopfte beim Schulbäcker nach dem Unterricht ein kleines Pfeifchen. Nachdem wir alle kräftig gezogen hatten fühlten wir uns endlich wie Rockstars. Außer einem leichten Schwindel und dem Gefühl, alles etwas klarer zu sehen, spürte ich nichts, war aber stolz wie Bolle. Wir überboten uns bei den Schilderungen am nächsten Tag über unsere sensationellen Bilder und Filmrisse, obwohl die Wirkung einer starken Tasse Kaffee wohl um einiges heftiger ausgefallen wäre. Um dem Klischee eines Rock‘n Rollers vollends zu entsprechen und außerdem meinen Kumpels zu imponieren, zettelte ich im Anflug einer Überdosis Selbstvertrauen eine Schlägerei mit einem anderen Schüler an. Schon als ich zum ersten Schlag ausholte, bereute ich meine Dummheit, als mir bewusst wurde, dass ich meinem provozierten Gegner wehtun musste. Der Kampf war zum Glück schnell beendet, hinterließ aber einen ziemlich üblen Nachgeschmack, auch wenn ich als Sieger den Ring verlassen hatte. Richtig unangenehm wurde die Geschichte, als mich der unterlegene Gegner bei seinem Onkel verpfiff. Dieser war ein berüchtigter Kleinkrimineller und hatte schon einige Vorstrafen auf seinem Konto. Unter anderem auch wegen Körperverletzung. Durch seinen Neffen ließ er mir ausrichten, mir bei nächster Gelegenheit die Fresse zu polieren. Der Typ nannte sich „Schlotti“ und war gegen meine Gitarrenkünste mit Sicherheit immun. Ich konnte nicht auf Gnade hoffen. Schlotti wohnte keine fünfhundert Meter entfernt und ich musste ständig damit rechnen, ihm über den Weg zu laufen. Ich traute mich fast nicht mehr aus dem Haus und war drauf und dran paranoid zu werden. Nach einigen endlos scheinenden Wochen voller Angst erfuhr ich dann von seiner erneuten Verhaftung und fühlte mich ab diesem Moment pudelwohl.
MAJOR
Nach Webses Rauswurf entschlossen wir uns zu einem neuen Namen für unsere Band. Wir einigten uns nach einer kurzen Diskussion auf einen Vorschlag von Heile. Er trug auf seinem Unterarm ein tätowiertes Kreuz mit einer aufgehenden Sonne im Hintergrund. Darunter stand in krakeliger Schrift der geheimnisvolle Begriff >Major<. Elle fand das Symbol und den Namen ideal und weil mir nichts Besseres einfiel war die Sache geritzt. Was der ominöse Name auf seinem Arm zu bedeuten hatte, wusste allerdings nicht mal Heile selbst. Etwa um diese Zeit stieg „Shorty“ als Bassist bei uns ein. Auch Shorty war Farbiger und hieß mit bürgerlichem Namen Peter K.. Er war mit uns zusammen in der ersten Klasse gewesen. Jetzt besuchte er eine Sonderschule. Shorty war einer der regelmäßigen Besucher unserer Proben und hatte seine Mutter dazu überredet, ihm eine Bassgitarre zu besorgen. Er wohnte in einem der ärmlichsten Blocks im Hawaii und wuchs ohne Vater auf. Für Shorty erfüllte sich ein Traum, als er bei uns eingestiegen war. Sein musikalischer Einfluss war aber eher gering. In langwieriger Kleinarbeit mussten wir ihm die Grundtöne der jeweils gespielten Lieder zeigen. Außerdem konnte er nur dann mitspielen, wenn Charly seinen neuen GEM Kofferverstärker mit in den Au-Keller brachte, weil dann eines der Röhrenradios für den Bass frei war. Charlies Verstärker hatte elf Watt und kam uns im Vergleich zu unseren alten Radios so laut vor wie ein Düsenflugzeug. Um selbst ab und zu ein wenig Krach zu machen, brachte er das Gerät immer wieder mal in den Proberaum mit und ließ uns darüber spielen. Probleme gab es immer wieder mit Zapf, dessen Unzuverlässigkeit uns gehörig auf den Wecker ging. Einige Wochen lang ersetzte ihn deshalb sein Bruder Emmerich, der Zapf jedoch bei weitem nicht das Wasser reichen konnte. Dann fiel uns Herbert S. ein, den wir bei unseren Freibadsessions kennengelernt hatten. Hebe hatte sich inzwischen mit einer Klassenkameradin von uns zusammengetan und war vielleicht nicht so eindrucksvoll wie Zapf, aber immerhin besser als Emmerich. So hatten wir endlich unsere neue Stammbesetzung gefunden. „All Right Now“ von „Free“ war der erste Song bei dem es mir gelang das Gitarrensolo originalgetreu nachzuspielen. Das nicht zahlende Publikum im Keller war begeistert und die Bewunderung schmeichelte mir. Stand mir Charlys Verstärker zur Verfügung, dehnte ich das Solo bis auf zehn Minuten aus, indem ich einfach weiter improvisierte, womit Elle nur schwer zurechtkam. Weil er aber, um selbst weiter in der Band zu spielen auf mich angewiesen war, verkniff er sich einen abfälligen Kommentar.
SCHULLANDHEIM
Im Juni waren es nur noch zwei Monate bis zur Beendigung unserer Schulzeit und zum krönenden Abschluss sollte es noch einen zweiwöchigen Schullandheim-Aufenthalt im Schwarzwald geben. Außer Laichert begleitete uns mit Frau Kögel eine der jüngsten und hübschesten Lehrerinnen der Schule. Schon die Fahrt im Reisebus wurde zum Fiasko. Laichert hatte uns erklärt, dass es eh sinnlos sei uns das Rauchen zu verbieten. Stattdessen würde er jedem, den er beim Rauchen erwischt zehn Mark abknöpfen. Alles was er erreichte war, dass wir die zehn Mark im Voraus bezahlten. Laichert hatte wohl unseren Bargeldvorrat unterschätzt. Nachdem wir fast alle unseren Geldbeutel erleichtert hatten, machten wir es uns in den hinteren Sitzreihen bequem und steckten uns erst mal eine an. Am Ende der fast dreistündigen Fahrt stand für Laichert fest, dass das Projekt wohl gewaltig aus dem Ruder laufen könnte und er ordnete den sofortigen Rückzug an. Der Fahrer des Busses weigerte sich jedoch mit aller Entschiedenheit, mit uns als Passagieren wieder zurückzufahren. Er fürchtete um die Einrichtung seines Fahrzeugs, da manche seiner Polstersitze schon mit Brandlöchern, Essensresten und anderen Flecken verziert waren. So checkten wir gezwungenermaßen in der Herberge am Feldberg ein. In jedem der Zimmer gab es sechs Betten und wir sorgten dafür, dass der „harte Kern“ bestehend aus Elle, Lallefatz, Zyml, Nonnenmacher, Hankes und mir eine Bude belegten. Die Mädchen waren nur durch eine Wand von uns getrennt. Allerdings gab es keine Möglichkeit von unserem Zimmer aus in den Mädchen-Trakt zu gelangen. Ohne die unüberwindbare Sperre in Form einer Holzwand im Hausflur wären es nur wenige Schritte von Tür zu Tür gewesen. So blieb uns nur der Weg an der äußeren Hauswand entlang. Da der schmale Mauerabsatz zu schmal und somit verdammt gefährlich war, spannten wir „bei Bedarf“ zusammengeknotete Betttücher von einem Fenster zum anderen, um uns daran festzuklammern, und so relativ gefahrlos an der Außenwand entlang zu klettern. Solange man sich vom zweiten Stock aus den Blick in die Tiefe verkniff war diese Methode recht sicher. Unser Zimmer wurde so zu einer Art Durchgangslager. Nach dem obligatorischen letzten Kontrollgang von Laichert und Frau Kögel begann jeden Abend nach 22.00 Uhr ein reger Grenzverkehr und wir machten die Nacht zum Tage. Diese Partys liefen stets in gedämpfter Lautstärke und ohne Licht ab, da sich die Aktivitäten hauptsächlich unter der Bettdecke abspielten, wobei ich öfter als einmal die Orientierung verlor und bei der völligen Dunkelheit nicht wusste, wer neben mir lag und wen ich da gerade befummelte. Morgens um acht beim Frühstück im Speisesaal, herrschte oft üble Katerstimmung, da sich in der Nacht neue Konstellationen ergeben hatten, die Misstrauen oder Eifersucht weckten. Als ich mit Elle dann auch noch in fremdem Revier wilderte und wir uns mit zwei Mädchen einer anderen Schule zusammentaten, gab es die ersten unschönen Szenen mit Tränen und Selbstmorddrohungen. Sonja F., die sich mit ihrem stählernen Körper immer wieder gern in mein Bett verirrt hatte, hörte nicht mehr auf zu weinen und musste von ihren Klassenkameradinnen getröstet werden. Hankes, der von seinem Schwarm einen Korb kassierte, drohte, sich aus dem Fenster zu stürzen und wurde im letzten Moment von Elle daran gehindert. Er verpasste ihm eine ordentliche Ohrfeige, die ihn glücklicherweise wieder zu Verstand brachte. Meine Flamme hieß Brigitte und war zwei Jahre älter als ich. Sie besuchte eine Realschule in einem Ort der ungefähr zwanzig Kilometer von HN entfernt war und unterrichtete mich ab jetzt täglich in dem Fach „Zungenkuss“. Ihr Altersvorsprung garantierte einiges an Erfahrung, die sie gerne an mich weitergab. Brigitte war ein wenig drall, ohne dick zu sein und um einiges kleiner als ich. Sie hatte lange, lockige, braune Haare und blitzende blaugrüne Augen. Elle kümmerte sich um ihre beste Freundin Sabine. Eine blonde langbeinige Schönheit, die mir zu dünn gewesen wäre. Den Versuch, die zwei Damen eines nachmittags in unser Zimmer zu locken verhinderte ziemlich resolut unser aufmerksamer Klassenlehrer, indem er kurzerhand die mit einem Stuhl verbarrikadierte Türe eintrat, um gnadenlos von jedem von uns zwanzig Mark „Strafe“ abzukassieren. Als ich mir den Mittelfinger der rechten Hand durch eine zugeschlagene Tür quetschte, blühte mir eine kilometerlange Wanderung mit Frau Kögel. Diese führte durch den Wald zum nächsten Arzt im Nachbarort. Der Arzt zog mir den lädierten, schwarz angelaufenen Fingernagel und verpasste mir eine Tetanusspritze. Auf dem Rückweg hatte ich dann das unbehagliche Gefühl, dass bei Frau Kögel die Hormone verrückt spielten. Auf einer Bank, auf der wir eine kleine Rast einlegten, rückte sie verdächtig nah an mich heran um mich ein wenig allzu fürsorglich zu bemitleiden. Dabei strich sie mir unablässig mit ihrer warmen Hand über den Rücken und meinen Arm. Mehr als einen erst kürzlich erlernten Zungenkuss hätte ich wohl aber kaum ins Rennen werfen können, sodass ich mich ziemlich ahnungslos gab. (Wenn das Uli S. gewusst hätte.)
In unserer Freizeit nach dem Unterricht unternahmen wir wahre Raubzüge in einem kleinen Kiosk auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es war kein Problem die einzige Verkäuferin des kleinen Ladens in ein Gespräch zu verwickeln um sie abzulenken. Meist übernahm diesen Job Rolf, da er noch am vertrauenswürdigsten erschien. Wir füllten uns in dieser Zeit in dem engen unübersichtlichen Durcheinander des Shops die Taschen mit Zigaretten, Jägermeister-Fläschchen und Sonnenbrillen. Einige Tage später beobachteten wir von unserem Zimmerfenster aus einen Polizeiwagen der vor dem Kiosk parkte. Wir unternahmen sofort alles, um unsere Beute verschwinden zu lassen. Eine kurz darauf durchgeführte Durchsuchung der verdächtigen Zimmer, darunter auch unseres, blieb erfolglos. Laichert ahnte sofort wer ihm den anschließenden Ärger mit den Bullen eingebracht hatte, die auch ihn befragten. Er verschwieg ihnen gegenüber aber glücklicherweise unsere neue Sonnenbrillen-Kollektion, die auch ihm aufgefallen sein musste und stellte uns ein letztes Ultimatum. Er versicherte uns, beim nächsten geringsten Vergehen dafür zu sorgen, dass wir nach Hause gebracht werden, notfalls auf seine eigene Rechnung oder zu Fuß. Da wir aber gar keine Lust mehr hatten von hier früher als nötig zu verschwinden beschlossen wir, uns die restlichen Tage an die Regeln zu halten. Dennoch gab es einen Unglücklichen, der frühzeitig dieses Schlaraffenland verlassen musste, wenn auch nicht aus disziplinarischen Gründen. Roland G. trat die Heimreise an, weil er sich bei einer – aus gutem Grund geheim gehaltenen Aktion – das Bein gebrochen hatte. Statt unsere freie Zeit mit etwas Sinnvollem wie Lesen oder einfach nur Relaxen zu verbringen, hatten wir uns in den Wald geschlagen und nur wenige Kilometer von der Herberge entfernt eine Sommer-Skisprungschanze entdeckt. Neben der Anlage fanden wir in einer Holzhütte, deren Schloss ziemlich leicht zu knacken war, die notwendige Ausrüstung für eine zünftige „Trainingseinheit“. Wir begannen mit leichten Aufwärmübungen auf der Auslaufbahn unterhalb des Schanzen-Tisches, um bald darauf den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Roland war der Erste, der es sich zutraute einen Sprung von der Schanze zu wagen. Statt eines Sprungs gelang ihm aber lediglich ein unkontrollierter Flug mit einer ebenso unglücklichen und unkontrollierten Landung. In der Zeit, die wir brauchten um zu ihm zu gelangen, war sein Bein am Knöchel schon mächtig angeschwollen und man konnte sehen, dass das Gelenk gebrochen war. Zuerst waren wir erleichtert, dass offensichtlich nichts Schlimmeres passiert war. Dann suchten wir nach einer Möglichkeit, den Verletzten ohne großes Aufsehen zur Herberge zurück zu bringen. Wir mussten den wahren Hergang des Unfalls auf jeden Fall vertuschen, um unsere Heimreise nicht zu forcieren. Hinter der Hütte fanden wir ein geeignetes Brett, auf das wir Roland legten. So trugen wir ihn mühsam durch den Wald zur Herberge zurück. Hier erzählten wir Laichert eine Geschichte vom „Fußballspielen hinterm Haus“ und waren so versicherungstechnisch auf der sicheren Seite. Roland wurde sofort ins Krankenhaus und von dort am nächsten Tag nach Hause gebracht. Leider warteten wir vergeblich auf Hebe und Charles, die in Aussicht gestellt hatten uns per Anhalter im Schwarzwald zu besuchen. Charles hatte in einem Brief an uns großspurig getönt einige Gramm feinstes Marihuana mitzubringen. Vielleicht war es besser, dass die Beiden ihr Versprechen nicht wahrgemacht hatten. Auch wenn wir versuchten, uns an die Regeln zu halten, hätte es immer noch genügend Gründe für Laichert gegeben, die Zelte sofort abzubrechen. Offensichtlich drückte er bei vielen Dingen beide Augen zu. Aber bei Drogen wäre sicher Schluss mit Lustig gewesen.
ABSCHLUSSFEIER
Nach vierzehn Tagen Schullandheim gab es praktisch keinen Grund mehr einen Bogen um die Schule zu machen. Es begannen die Proben für die Abschlussfeier der Schulabgänger. Elle und ich spielten dabei eine zentrale Rolle als Musiker der eigens dafür gegründeten Band. Das Schlagzeug spielte Rainer M. aus unserer Parallelklasse. Sein Vater war Musiklehrer und Metzi hatte tatsächlich Schlagzeug-Unterricht genossen. Er war seit kurzem der Drummer in Charlys neu formierten Kombo, den „Nightflowers“. Die Show, die wir einstudierten, bestand aus bekannten Hits, deren Texte von Frau Kögel, der „Regisseurin“ umgeschrieben worden waren. Jeder Song war eine Parodie auf eine/n der Lehrer oder Lehrerin, mit denen wir uns als Schüler hatten herumschlagen müssen. Durch die ab jetzt täglich stattfindenden Proben fiel der Unterricht für die teilnehmenden Akteure flach. Niemals zuvor hatten wir so regelmäßig die Schule besucht wie in diesen Wochen. Außer Charlys GEM Verstärker, den Elle benutzte, hatte ich das Glück meine Gitarre über einen 22 Watt starken Amp eines Klassenkameraden jagen zu dürfen, der darüber üblicherweise sein Akkordeon spielte. Der Background-Chor bestand aus mindestens fünfundzwanzig Mädchen, zusammengewürfelt aus den zwei Abschlussklassen. Als Lohn für unsere Mitarbeit hatten wir ausgehandelt, das Finale mit einem eigenen Song beenden zu dürfen. Nach den lustigen Parodien gelang es uns dann auch mühelos, das Publikum an den Rand des Wahnsinns zu treiben und verständnislose Blicke auf die Gesichter der meisten Eltern zu zaubern, als wir ein sogenanntes „progressives Lied“ ankündigten und diese Drohung auch wahrmachten. Brigitte, meine Freundin vom Schullandheim, traf ich noch einige Male in Heilbronn. Sie absolvierte in der City einen Tanzkurs. Einmal pro Woche unterbrachen wir deshalb unsere Proben und Shorty fuhr mich auf seinem Motorrad zur Tanzschule. Während der 30minütigen „Tanzpause“ verzog ich mich mit Brigitte in einen Hinterhof. Danach ging es zurück in den Au-Keller. Als der Tanzkurs mit Ende des Schuljahres vorbei war, schrieben wir uns noch einige Briefe, in denen ich das Blaue vom Himmel log und von unserer aufstrebenden Karriere als Rockmusiker schwadronierte, aber dann verlief die Sache vollends im Sande.
JAM-SESSION IN LEINGARTEN
Noch während der letzten Schultage erfuhren wir von einer geplanten Jam-Session in einem Nachbarort, zehn Kilometer entfernt. Hier hatten einige Musiker die Gemeindehalle gemietet, um anderen Bands einen Auftritt zu ermöglichen. Die Lautsprecher Anlage sowie ein Schlagzeug wurden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die Chance in einer größeren Halle aufzutreten wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bis zur Halle fuhren wir per Anhalter und als wir dort eintrafen wurden wir Zeuge einer gut besuchten aber elend langweiligen Darbietung. Die Verstärker, Boxen und das Schlagzeug waren in der Mitte des Saales aufgebaut und einige intellektuelle Jazzmusiker quälten das Publikum mit eigensinnigem Gedudel. Wir meldeten uns beim Veranstalter, der uns erstaunt musterte, da wir mit Abstand die jüngsten Besucher der Session waren. Dann hatte ich das unverschämte Glück meine Gitarre in einen „ORANGE“ Verstärker stöpseln zu dürfen, der eine große 100 Watt Box befeuerte. Schon nach unseren ersten Takten kam Bewegung in die Zuhörer. Sie waren wohl heilfroh endlich eine Struktur in einem Lied zu erkennen. Wir spielten all unsere derzeitigen Favoriten und zum Schluss eine überlange Version von „Gimmie Shelter“. Wir genossen den Applaus, der vorwiegend um einige Jahre älteren Zuschauer ohne zu ahnen, dass dies unser letzter gemeinsamer Auftritt war.
VOID
Die Wege von Elle und mir trennten sich mit dem Ende unserer Schulzeit. Auch Hebe Scholz und Shorty verließen die Band. Shorty hauptsächlich deshalb, weil er auch selbst realisierte, dass er zu schlecht auf seinem Instrument war. Elle und Hebe hassten dagegen die progressivere musikalische Ausrichtung die Charles und ich eingeschlagen hatten. Sie sahen sich in die Rolle von Statisten gedrängt. Elle kümmerte sich von nun an um seine neue Freundin aus der Nachbarschaft und Hebe um „Dorle“, meine Klassenkameradin. Nur noch einmal trafen wir uns alle gemeinsam auf einem Open-Air-Festival im HNer Pfühlpark. Die „fünfte Kolonne“ mitsamt den Mädels unserer Schulklasse. An diesem Abend spielte die Krautrock Band „Eulenspygel“ aus Stuttgart. Heile, unser Roadie, lud uns auf einen Joint ein und wir suchten uns ein ruhiges Plätzchen abseits des Festivalgeländes. Nur kurze Zeit später haute mich Heiles Stoff fast aus den Latschen und ich hatte meine liebe Mühe nicht in Panik zu geraten. Weiß der Teufel, was für Zeug wir da geraucht hatten. Es war der reinste Horrortrip. Als ich das Gefühl hatte, die Sache nicht in den Griff zu kriegen, machte ich mich schleunigst auf den Heimweg. Das Laufen beruhigte mich wieder einigermaßen und als ich nach fast einer Stunde endlich zu Hause ankam, war ich wieder einigermaßen klar im Kopf. Dies war sozusagen unsere Abschiedsparty. Ab jetzt genoss ich meine letzten langen Ferien und Karle G.s guten Draht zu einem türkischen Arbeitskollegen, der ihn regelmäßig mit besonders starkem Haschisch versorgte. Charles war hin und weg von dem Stoff und wir verbrachten unsere Abende meist in der Unterführung des Vorstadtbahnhofs am Sülmertor. Hier gab es genug versteckte Winkel, wo wir unbeobachtet unser Dope rauchen konnten. Die Mitglieder der neuen Clique waren Vera M., die neue Freundin von Charles, eine ehemalige Klassenkameradin von Karle, sowie Cebe und Charly, William und Bomber, der eigentlich Günther W. hieß. Außerdem Heile und Werner Carle und noch einige andere Halbstarke aus dem Hawaii, die allein durch ihre Anwesenheit dafür sorgten, dass wir bei unseren Meetings ungestört blieben. Karle gefiel sich derweil in seiner ungewohnten Rolle als Drogenlieferant und latschte nur noch mit einem riesigen Chillum durch die Gegend, das zentimeterweit und für jeden sichtbar aus seiner Jackentasche schaute. Vera vergötterte Charles und die Beiden waren unzertrennlich. Als sie eines Abends ihrem Idol ein Kompliment machen wollte und unsere Musik „süß“ nannte, verbot ihr Charles jemals wieder über unsere Band zu reden. Ich hatte eine kurze Affäre mit Sybille aus meiner früheren Parallelklasse die aussah wie Dunja Reiter, eine Schlagersängerin, die mir gar nicht gefiel.
Nach einer dreiwöchigen Ferienpause im Au-Keller begann ich mit Charles wieder zu proben. Ich hatte mir einige Gitarren-Riffs einfallen lassen, die wir, nur zu zweit, auf ihre Tauglichkeit hin testeten, mit der Erkenntnis, dass eine Bassgitarre und ein Sänger der Sache wohl nicht schaden könnten. Ich beschloss mit Charles bei Cebe und Charly anzufragen. Deren Band dümpelte ziemlich ziellos vor sich hin, sodass die Chance groß war, die Beiden zu uns zu locken. Sie überlegten nicht lange und stiegen bei uns ein. Leidtragender war Metzi, der mit seinem Schlagzeug wieder auf dem Trockenen saß. Mit den „Neuen“ waren wir eine recht bunte Truppe. Charles, der seine Haare mittlerweile in der Mitte scheitelte und zu einem mächtigen „Afro“ frisierte, wirkte durch seine relativ dunkle Hautfarbe und seine Klamotten wie eine Inkarnation von Jimi Hendrix. Charly war eh ein Exote, weil er ein Farbiger war und Cebe hatte langes, glattes, blondes Haar, das ihm schon bis über die Schultern hing. Er trug ständig einen Afghanmantel aus Ziegenfell und bunt bestickte Jeans. Alle drei wuchsen bei ihrer Mutter auf und hatten, im Gegensatz zu mir, nicht das Handycap, sich noch mit einem Vater herumschlagen zu müssen, um dem Frisör zu entkommen. Ich wirkte optisch im Vergleich zu meinen Mitmusikern noch relativ harmlos, obwohl ich auch schon im Freibad Ärger mit dem Bademeister bekam, der von mir verlangte meine „langen Haare“ in einer Badekappe verschwinden zu lassen. Meine Genugtuung darüber ließ ich mir nicht anmerken und spielte den Empörten. Wir spielten immer noch über unsere alten Röhrenradios. Charly, unser Sänger sang über seinen GEM Verstärker, an den er auch seinen selbst zusammengelöteten „Multi Vibrator“ anschloss. Mit diesem zigarettenschachtelgroßen Plexiglaskasten, der mit Transistoren und Widerständen vollgestopft war, erzeugte er die furchtbarsten Brumm- und Pfeiftöne, die die Welt je gehört hatte. Mit einem kleinen Drehknopf konnte er die Frequenzen von fast unhörbar tief, bis extrem hoch regeln. Und diesen Effekt nutzte Charly exzessiv. Nach einem Songtitel vom Black Sabbath Album „Master Of Reality“ nannten wir uns „VOID“. Langsam aber sicher entwickelten wir in diesen Wochen unseren eigenen Stil, der sich zwischen dem Riff-betonten Black Sabbath Hardrock und den psychedelischen Pink Floyd bewegte. Und dies alles unterlegt mit der unvorstellbaren Geräuschkulisse von Charlys Mörder Kiste. Charly selbst schrie eher als dass er sang, wurde aber sowieso von seinem eigenen Lärm, den er mit seinem Effekt Gerät veranstaltete mühelos übertrumpft.
WIR KAUFEN EINEN VERSTÄRKER
Wir brauchten unbedingt lautere Verstärker und Cebe bekam ein „super Angebot“ von den Mitgliedern einer Rockergang. Diese hatten einen angeblich achtzig Watt starken Amp anzubieten, jedoch ohne Lautsprecher Boxen. Der Röhrenverstärker steckte in einem metallenen Gehäuse, das ziemlich heruntergekommen aussah. Laut den Rockern, die uns im Proberaum besuchten, sei das Gerät aber einwandfrei. Wir machten das Geschäft, weil wir uns nicht getrauten einen Rückzieher zu machen und bezahlten zweihundert Mark ohne das Teil getestet zu haben. Es war uns in diesem Moment wichtiger, dass die mit Ketten und Schlagringen bewaffneten Motorradfreunde wieder verschwanden. Unter dem Gerümpel im Keller des Gemeindehauses gab es einige uralte Holzspinte. Diese waren etwa zwei Meter hoch. Einen der Schränke sägten wir in der Mitte auseinander. Rolf sorgte mit einer Stichsäge für unzählige runde Löcher in den Rückwänden und schraubte in diese Aussparungen seine ganzen gesammelten Werke an Radiolautsprechern, die er eigentlich für sein Mofa reserviert hatte. Er verkabelte anschließend alles miteinander und verband den Verstärker mit den zwei Lautsprecherboxen. Diese hatten wir der Optik zuliebe auf der mit den Speakern bestückten Frontseite, mit einem glänzenden weißen Tuch bespannt. Ob der Amp die versprochene Leistung brachte wussten wir nicht, aber er war lauter als die alten Röhrenradios über die wir bisher gespielt hatten. Da die Bassgitarre die kleinen Lautsprecher wohl schon mit dem ersten Ton durchgeblasen hätten, durfte ich mit meiner Framus Gitarre über den mehr als zwei Meter hohen Turm spielen und genoss schon allein die Prozedur, den Amp einzuschalten und mich dabei auf die Zehenspitzen stellen zu müssen. In regelmäßigen Abständen ersetzte Rolf die durchgeschossenen Lautsprecher, da diesen nur eine kurze Lebensdauer vergönnt war. Der Sound der Anlage war nach normalen Maßstäben miserabel, für mich jedoch ideal. Ich drehte den Amp auf volle Lautstärke und die übersteuerten Röhren ergaben, zusammen mit den flatternden Membranen der beschädigten Speaker, einen einzigartigen Overdrive-Sound. Noch während der Schreinerarbeiten am Holzspint besuchte uns Harry M., der Sänger und Gitarrist unserer Konkurrenz Combo „The Gang“. Er plante einen Band Wettbewerb im Heilbronner Deutschhofkeller, weswegen es noch einige Punkte zu besprechen gab. Er war überwältigt von unserem Arbeitseinsatz und beneidete ganz offensichtlich die Freundschaft unter den Musikern und unseren Roadies. Dies vermisste er bei seiner eigenen Truppe. Außerdem war er als „Südviertel-Bewohner“ stark beeindruckt vom Hawaii. Nur wenige Wochen zuvor hatte ich Harry bei seinem Gaffenberg-Auftritt beobachtet. Er hatte unseren Auftritt vor einem Jahr mit seiner Band genau ein Jahr später und an gleicher Stelle abgezogen. Noch zusammen mit Elle hatte ich mich über die kommerzielle Musik der „Gang“ lustig gemacht. „Lady In Black“ von „Uriah Heep“ war, zumindest für mich, ein absolutes Tabu.
POST
Am 1. September 1971 begann ich meine Ausbildung bei der Post. Für die Wahl meines Jobs gab es zwei Gründe: Ich wollte auf keinen Fall in einer Fabrikhalle oder einer Autowerkstatt landen. Die Post brachte ich in Verbindung mit Briefträgern, was mir einen Platz an der frischen Luft garantieren würde. Außerdem hatte ich in einem Interview mit Keith Richards gelesen, dass auch er Briefe ausgetragen haben soll. Grund genug, dies ebenfalls mal zu versuchen. Außerdem sollte es sowieso nur eine Übergangslösung sein, bis ich es „geschafft“ hatte und mit der Musik mein Geld verdienen würde. Nach den langen Ferien hatte ich erst mal meine liebe Mühe in den neuen Rhythmus zu finden. Das Haschisch von Karle hatte ich abgesetzt, was mir trotz des warmen Wetters ein, zwei Tage unangenehmen Schüttelfrost bescherte. Der Stoff war wohl mit einem ziemlich hohen Anteil an Opium gestreckt gewesen.
Anfangs meiner Ausbildung war ich unter meinen Arbeitskollegen nicht groß aufgefallen. Einer der ersten, mit dem ich ins Gespräch kam, war Peter H.. Er hatte lange, braune Haare und trug ständig eine der damals modischen Nato-Jacken und viel zu kurze, eng anliegende Cordhosen. Dazu knöchelhohe Wildlederboots. Ich beneidete ihn um seine langen Haare und seine coolen Klamotten. Wir unterhielten uns über Musik und er dachte wohl, mich über die neusten Trends aufklären zu müssen. Er schwärmte von „Hawkwind“ und „Pink Floyd“ und seinem wunderbaren „Dual“ Plattenspieler. Als er meinen Namen seiner Mutter gegenüber erwähnte, stellte sich heraus, dass sie und mein Vater in ihrer Jugend eng miteinander befreundet gewesen waren und sich nach dem Krieg aus den Augen verloren hatten. Wir setzten somit mit „unserer“ Freundschaft diese alte Verbindung fort. Eher beiläufig erklärte ich Peter eines Tages, dass ich als Gitarrist in einer Rockband spiele, was er sich offensichtlich nur schwer vorstellen konnte. Ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck gemacht, mehr als nur der gelegentliche Hörer einiger aktuellen Schallplatten zu sein. Während der Arbeit rauchte ich nicht, meine Haare waren für damalige Verhältnisse eher durchschnittlich lang und ich trug keine besonders ausgeflippte Kleidung. Mein ganzer Stolz war eine grüne Levis Cord Jacke, mit der man nun wirklich keinen großen Staat machen konnte. Natürlich war Peter nun neugierig geworden und freute sich über meine Einladung zu unserer Probe. Als ich ihm erklärte, wie er unser Domizil finden würde wurde er nervös. Das Hawaii kannte er nur vom Hören-Sagen und er befürchtete, dort in einen „Hinterhalt gelockt zu werden“. Ich konnte ihm seine Bedenken ausreden, musste ihm aber versprechen, seine Ankunft in unserem Keller meinen Kumpels gegenüber anzukündigen. Er hatte keine Lust eine aufs Maul zu kriegen, nur weil er hier unbekannt war. Als Peter zum vereinbarten Probetermin aufkreuzte, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Er realisierte, dass ich eine Doppelrolle spielte. Als er den Keller betrat, stand ich direkt vor meiner turmhohen Anlage, spielte gerade eines meiner endlosen Gitarrensolos und hatte eine qualmende Zigarette im Mundwinkel hängen. Charles, der ohnehin recht verwegen aussah, hatte sich gerade in Trance getrommelt und wirkte in solchen Momenten wie ein wahnsinnig gewordener Voodoo Priester. Er verkörperte den Leibhaftigen, der mit seinen Kochlöffeln in Töpfen voll brodelndem Zaubertrank herumrührte. Gleichzeitig wirkte Cebe wie ein vom Himmel herabgestiegener Engel. Seine langen, blonden Haare verdeckten fast vollständig sein Gesicht und er wippte hypnotisiert mit seinem Kopf vor und zurück. Dass wir mit Charly einen schwarzen Sänger hatten, der nebenher die verrücktesten Geräusche aus einer Plexiglasschachtel zauberte, gab Peter den Rest. Ganz zu schweigen von unserem wilden Haufen von Roadies und Zuhörern, die Haschisch-rauchend im Keller herumlungerten. Peter war überwältigt. Er hatte nicht mit so einem abgefahrenen Ort voller Freaks und Idealisten gerechnet. Fast demütig griff er in einer Spielpause nach dem kreisenden Joint und nahm seinen ersten Zug überhaupt, der ihn vollends in die faszinierende Welt des Lärms und der Ekstase katapultierte.
INDUSTRIEPLATZ
Mit der Band traf ich mich an zwei Abenden in der Woche zum Proben. Solange es noch einigermaßen warm war und die Tage noch länger waren, lungerten wir den Rest der Woche in der Unterführung am Sülmertor herum. Als es ungemütlicher wurde traf ich mich eher mit den Freunden vom Industrieplatz am Kiosk beim Luftschutzbunker. Außer Karle und Elke waren hier noch „Winne“, „Aslam“, der kleine Bruder Karle`s Martin, Gaby B. Uschi N., Dittmar und Helmut, die Schwestern Andrea und Mona, sowie Helga, die mindestens einhundert Kilogramm wog. Sie hatte mir wenige Jahre zuvor die schlimmste Tracht Prügel verabreicht, die ich je von jemandem bekommen hatte. Damals hatte ich es gewagt, ihr frech „Schlägerbaby“ hinterherzurufen. Ein Ausdruck, mit dem sie in der Schule schon gehänselt wurde. Dabei hatte ich nicht einkalkuliert, wie schnell Helga sein konnte und nach einer Verfolgungsjagd saß ich plötzlich in einem Hinterhof in der Falle. Es gab kein Entrinnen und ich war Helgas purer Gewalt ausgeliefert. Danach waren wir quitt und gute Freunde geworden. Mit Karle, den ich am längsten von allen kannte, hatte ich den Kindergarten besucht. Karle arbeitete in einer Maschinenbau-Fabrik, wo er eine Lehre begonnen hatte, die er kurz darauf hinwarf, um als „Arbeiter“ mehr Geld in der Lohntüte zu haben. Von diesem „Mehr“ profitierten wir jetzt alle. Karle versorgte uns mit Pommes, Cola, Hähnchen aus dem Wienerwald, Zigaretten und Reblaus-Weinfläschchen vom Kiosk, einem Schlauchboot, Federballschlägern, einem Fernglas oder einem Boxsack und vielem anderen unnötigen Kram mehr. Außerdem zettelte er immer wieder bizarre Wetten an. So versprach er Helga und den beiden Schwestern Andrea und Mona ein üppiges Abendessen bei „Gohly“, unserer Stammkneipe, wenn es ihnen gelingen würde mich am ganzen Körper mit Knutschflecken zu übersäen. Bei einem unserer allabendlichen Spaziergänge, vorbei an Chemie-Alkohol-Firmen, Tanklagern und Gelatine-Fabriken, machten die Mädels ernst, und zerrten mich plötzlich hinter eine schmuddelige Imbissbude und rissen mir die Kleider vom Leib. Ich hatte nicht die geringste Chance gegen die beiden Schwergewichte Helga und Mona (auch Mona war ein ordentliches Kaliber). Sie warfen mich zwischen einem Gebüsch und den Gleisen - der hier tagsüber verkehrenden Industriebahn - neben der Wurstbude auf die Erde. Helga setzte sich mit ihren zwei Zentnern auf meine Beine und Mona hielt mich an den Armen fest. Je mehr ich versuchte mich zu befreien, umso fester drückten sie mich zu Boden und ich hatte das Gefühl in einem Schraubstock eingespannt zu sein. Ich kapierte schnell, dass es klüger war mich nicht mehr zu bewegen, wenn ich unnötige Schmerzen vermeiden wollte. Auf Hilfe konnte ich nicht hoffen. Es war schon lange dunkel geworden und es waren in dieser unwirtlichen Gegend um diese Uhrzeit gewöhnlicher weise keine Menschen mehr unterwegs. Karle und der Rest der Clique standen grinsend einige Schritte weit entfernt, und die lüsternen Gaffer gaben den drei „Vergewaltigerinnen“ noch Tipps und feuerten sie an. Andrea saugte sich wie ein Blutegel an den verschiedensten Stellen meines Körpers fest und ich bedauerte es zutiefst, dass ich die unglaubliche Situation nicht genießen konnte. Nach einigen Minuten, die mir wie Stunden erschienen, war ich überall mit roten Flecken übersät und sah aus wie ein Aussätziger. Ich hatte vor Schmerzen noch Tränen in den Augen, als ich nach dem Überfall meine auf dem Gehweg verstreuten Klamotten zusammensammelte. Dabei verfluchte ich Karle und seine Schnapsideen. Dieser hatte an solchen Spielchen seine wahre Freude und bezahlte großzügig seine Wettschulden, wovon unsere ganze Meute profitierte, da nach so einer Aktion in der Regel ALLE Anwesenden mit Essen und Trinken belohnt wurden. Eher unbeholfen klangen meine Ausreden meinen Eltern gegenüber. Die Flecken waren noch tagelang sichtbar und sie befürchteten wohl das Schlimmste, nachdem jeden Abend zwei, drei Mädels aus der Nachbarschaft ums Haus schlichen und mich durch die Finger pfeifend aufforderten bei unserem Treffpunkt am Kiosk aufzukreuzen. Bei Regine erforschte ich im Schutz der Dunkelheit immer wieder das Innenleben ihrer engen Jeans. Ihre Freundin Petra, die einen recht zweifelhaften Ruf genoss und die an Hässlichkeit nicht zu überbieten war, (außer dass sie einen tollen Arsch hatte) bot mir großzügig an, auf der öffentlichen Toilette des Industrieplatz-Kiosks einen zu blasen. Darauf hatte ich nun wirklich keinen Bock und redete mich damit heraus, mir keine ansteckende Krankheit von ihr einhandeln zu wollen. Sie drohte mir daraufhin wütend, dass ihr Freund mir für diese Frechheit das Maul polieren würde. Zu meinem Entsetzen erfuhr ich kurze Zeit später, dass Petra mit „Schlotti“! zusammen war.
An den Wochenenden widmeten wir uns unseren endlosen Federball-Turnieren unter der Straßenlaterne vor meinem Geburtshaus. Wir spielten nach eigenen kuriosen Regeln und bewiesen dabei eine außerordentliche Ausdauer. Ein Match konnte Stunden dauern, wobei wir uns immer wieder in die Wolle kriegten und uns übel beschimpften. Mit „Winne“, der selbst kein Instrument spielte, verband mich die gemeinsame Liebe zur Musik. Winne besaß ein Tonbandgerät, mit dem er die aktuellen Hits vom Radio mitschnitt. Oder wir unternahmen stundenlange Aufnahme-Sessions, bei denen wir meine neusten Langspielplatten auf sein Gerät überspielten. Winne war zwei Jahre jünger als ich und wohnte im Nachbarhaus. Zwischen den beiden Häusern hatten wir über den Hinterhof eine Telefonleitung gespannt, die zwei batteriebetriebene Spielzeug-Telefone miteinander verband. So konnten wir uns Tag und Nacht auf dem Laufenden halten und spielten uns gegenseitig unsere Lieblingslieder durch die knisternde Leitung.
Andrea und Mona waren ziemlich gegensätzliche Geschwister. Während Mona etwa so schwergewichtig war wie Helga, und herrliche, schwarze, lockige Haare hatte, war ihre Schwester eine rassige rothaarige Schönheit mit einer perfekten Figur. Einen Antrag von mir konterte sie mit den Worten „sie hätte nicht geplant Kinder in die Welt zu setzen“ da ihr sonst ein faltiger Bauch und Hängebrüste drohten. Stattdessen sollte ich mich lieber um Mona kümmern, die das schon alles habe. Gegen so viel scharfsinnige Logik hatte ich keine stichhaltigen Argumente, ließ aber meine Finger von Mona.
Die Mittagspausen verbrachte ich mit Peter H. entweder an dem beliebten Treffpunkt vor dem „Janssen“ Stehcafe gegenüber der Hauptpost, wo wir zu Beginn unserer Ausbildung im „Briefabgang“ beschäftigt waren. Hier traf ich auch regelmäßig auf Herbert S., unseren ehemaligen Major-Sänger und seinen Arbeitskollegen Arno J.. Oder wir versorgten uns mit belegten Brötchen und schlenderten einige Meter weiter zum „Elektro-Weber“. Hier gab es die Möglichkeit, sich vom Verkäufer der Schallplattenabteilung ein Album auflegen zu lassen, um es in einer telefonzellengroßen Kabine anzuhören. Nach einer halben Stunde sah man in dem winzigen Raum kaum noch die Hand vor den Augen. Rauchen war noch überall gestattet und wir orientierten uns bei unserer Zigarettenwahl an dem gerade angesagten filterlosen Rothändle-Boom.
KAISER-WILHELM-PLATZ
Stand uns der Sinn eher nach selbstgedrehten Zigaretten mit berauschendem Inhalt verzogen wir uns auf den Kaiser-Wilhelm-Platz. Dieser Park, nur dreihundert Meter von der Post entfernt, war Dreh- und Angelpunkt der Heilbronner „Freak-Szene“. Der Park war ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Es gab Rasenflächen, Springbrunnen, Parkbänke und genügend Büsche und Hecken um sich vor den Blicken der stets misstrauischen Öffentlichkeit zu schützen, um entweder in Ruhe zu kiffen oder kleinere Deals abzuwickeln. Harte Drogen spielten so gut wie keine Rolle und es herrschte eine wunderbar freundschaftliche und friedliche Atmosphäre. Grund genug für die Obrigkeit in regelmäßigen Abständen Razzien durchzuführen. Der Erfolg solcher Aktionen war in der Regel relativ gering und trug höchstens zur erfreulichen Abwechslung und Belustigung der Parkbesucher bei. Es war ein lustiges Volk, das sich hier vor allem am Nachmittag herumtrieb. Es gab einige Hippies und Lebenskünstler, wie zum Beispiel „Bongo“ oder die „Buddy-Brüder“, sowie ein paar harmlose Klein-Dealer. Von den umliegenden Gymnasien besuchten nach Unterrichtsende die Schüler den Park und es gab jede Menge amerikanische GIs, die sich hier in ihrer Freizeit bei einem Joint entspannten. Wenn wir uns für den „Park“ entschieden, bedeutete die Mittagspause eigentlich „Feierabend“. Meist gelang es uns nicht mehr, die Arbeit nochmal aufzunehmen. Es gab immer eine Gelegenheit bei irgendjemandem einige Züge an einer Pfeife oder einem Joint zu schnorren und sofort waren Briefe und Postleitzahlen vergessen. Sorgen, dass unser Fehlen auffliegen könne brauchten wir uns nicht zu machen. Wir hatten schnell kapiert, dass die unübersichtlichen Dienstpläne und der Schichtdienst der Vorgesetzten eine Kontrolle unserer Anwesenheit unmöglich machten. So etwas wie eine Stechuhr gab es nicht, und man verließ sich lediglich auf unsere Eintragungen in einem Berichtsheft, für die sich wiederum niemand von unseren Vorgesetzten so richtig interessierte. Um am Arbeitsplatz in Erinnerung zu bleiben, durchquerten wir unsere Abteilung im Erdgeschoss am frühen Morgen und begrüßten im Vorbeigehen sämtliche Anwesenden. Danach verdrückten wir uns in Richtung „Park“. Dasselbe Spiel wiederholten wir - wesentlich entspannter - am Nachmittag. So sicherten wir uns ein einigermaßen passables Alibi, während wir in Wirklichkeit oft den ganzen Tag im Park vertrödelten. Eine weitere Möglichkeit sich mit Haschisch zu versorgen, gab es in der „Palette“ in der Wilhelmstraße. Die Bar lag nicht weit von den amerikanischen Kasernen entfernt und hier wurde ein großer Teil, des von den Amerikanern eingeschleusten Haschischs und LSD umgesetzt und weiter verhökert. Außer Drogen gab es hier auch noch die beste Musik zu hören. Nur die Beleuchtung ließ zu wünschen übrig. Durch die dichten Haschisch-Schwaden konnte man kaum jemanden erkennen, selbst wenn derjenige direkt vor einem stand. Es kursierte das Gerücht, dass am Haus gegenüber des Eingangs vom Rauschgift-Dezernat eine versteckte Kamera installiert worden war. Die Aufnahmen würden von der Polizei registriert und ausgewertet. Daher achteten wir beim Verlassen des Lokals stets darauf einen einwandfreien Eindruck zu hinterlassen. Wichtig waren ein hochgeschlagener Jackenkragen und eine Sonnenbrille. Charles zupfte sich zudem immer sorgfältig seinen „Afro“ zurecht.